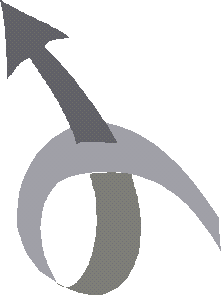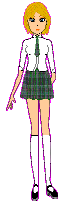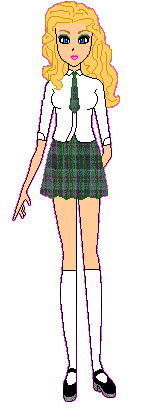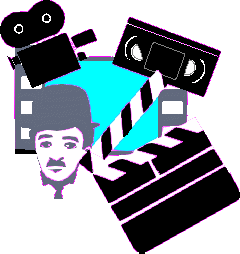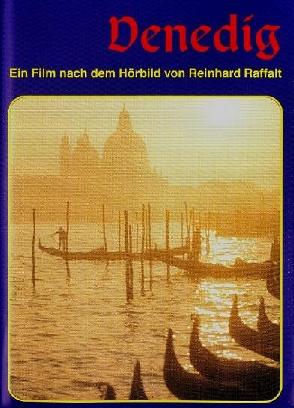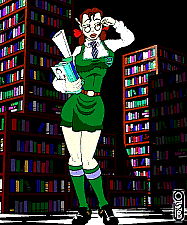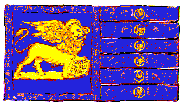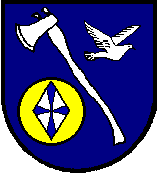|
Venezianische Vorlesegeschichten – gar kontemplative - undװaber Hörbild |
|
|
‚Anleitung‘: |
Man und/oder frau schaffe sich zunächst eine »Insel der Ruhe«. |
||||
|
Die vorlesende / erzählende / imaginierende Person stellt sich ganz [mit zunehmender kontemplativer Erfahrung, mache gar weniger isolativ / 'handlungs- bis rationalitätsunfähig'] auf Ruhe ein. Die Stimme ist ruhig, langsam und sanft – eine »Schonstimme«. Die durch » - « angegebenen Pausen im Text einhalten! Zur Entspannung betont langsam, ruhig und auch etwas monoton vorlesen! Ruheformeln können am Anfang der Geschichte gesprochen werden, sie müssen aber nicht vorgegeben werden. |
||||||
|
|
Besonders wichtig ist die »Zurücknahme« nach dem Ende der »Reise«, die auch Ihren physiologischen Kreislauf wieder anregt. |
|
||||
|
[Aktivität und Kontemplation schließen einander nicht notwendigerweise aus] |
|
Nach den »Reisen« sollten Sie über Ihre Gefühle, Gedanken und Erlebnisse, die Sie während des Vorlesens hatten, sprechen, musizieren, malen oder wie Sie sich sonst ausdrücken wollen. Selbst Tränen bedeuten nicht nur Traurigkeit, sie können [& dürfen] auch als Zeichen der Entspannung oder Entlastung verstanden werden. Sie sollten aber immer miteinander darüber reden. |
||||
|
Beachten Sie bitte: Die Geschichten langsam vorlesen, damit Zuhörer genügend Zeit haben, sich in die Bilder einzufühlen. Von den weit über hundert Inseln der Lagune kommen zwar extensiv jene der ‚schwimmenden‘ Stadt, jene von Burano und Torcello vor, doch geht es der Autorin – in zunehmenden Intensitäten – auch/hauptsächlich um andere, so gerne ‚innere/innerliche‘ genannte, Inseln. |
|
|||||
|
Venedig Nur zwei Stunden von deiner Heimat entfernt fällst du vom Himmel - aus einem Flugzeug - in eine andere Welt - der Flughafen, wie viele andere - hektisch drängen, stupsen, schieben dich Menschen - du stehst ein wenig verloren, fragst dich, was soll ich hier? - |
||||
|
|
|
doch bald danach in einem Motorboot, nur wenige Leute mit dir - das Boot schießt durch die schmale Wasserstraße am Airport der offenen Lagune zu - der Märchenstadt entgegen - |
||
|
schon von weitem scheinst du allen Zauber zu spüren - er kommt näher dieser Zauber, der Traum von einer Stadt - du fährst auf verschiedenen Kanälen - biegst in den Canal Grande ein - |
|
|
||
|
|
|
wie aus einem Geschichtsbuch liest du rechts und links von den Palästen - die Sonne spiegelt sich in bleiverglasten Fenstern wider - unter weißen, steinernen Brücken gleitet das Boot hindurch der blaue Himmel färbt das Wasser im Kanal erträglich - |
||
|
du versuchst zu übersehen, was alles dort schwimmt und treibt - liegt der Zauber dieser Stadt nicht auch in ihrer Dekadenz? - du lässt deinen Blick über die Fassaden gleiten - welch eine Pracht und Verschwendung - Fassaden geschmückt durch filigran in Stein - Bögen, spitz und rund - verziert und glatt - Balkone, pompös und auch bescheiden - |
|
|
||
|
|
|
du siehst sie vor dir, die Reichen dieser vergangenen Zeit - geschmückt in Samt und Seide - du ahnst den Neid, den Hass, Intrigen, Leid und Lust - Karneval vor deinen Augen - du siehst Masken huschen - wie oft versteckt den Dolch - du erinnerst dich an Gift, an Mord, doch auch an Musik Freude, Tanz, Vergnügen, Lust und Ausschweifung - |
||
|
du siehst den Reigen der Menschen dieser Zeit - du siehst sie tanzen auf all den Plätzen - immer und immer wieder das gleiche Spiel der Vergänglichkeit du fühlst dich wohl - so ruhig und gelöst - du bist ganz ruhig und entspannt - |
|
|
||
|
|
Du
atmest jetzt tief durch - |
Burano - Insel bei Venedig
Viele, viele Menschen am Pier -
endlich bist du auf dem Schiff -
eng stehst du mit anderen -
es gleitet durch den Kanal -
vorbei an der prächtigen, menschenvollen Uferpromenade -
vorbei an großen Schiffen mit Kanonen und Soldaten -
unter einer schmalen Brücke hindurch in ein großes Fort -
Napoleons Soldaten haben hier gelebt - gebaut -
das Fort bewacht von zwei phönizischen Löwen aus Stein -
nach der Enge des Kanals wieder die offene Lagune, das Meer -
der Blick wird frei -
weit voraus ahnst du mehr, als du sie siehst, die Inseln -
Murano,
Burano, Torcello, San Francisco, San Michele -
Namen wie Gesang -
heiter - nach Sonne klingend -
San Michele - der alte Friedhof von Venedig -
dort findest du Gräber einst berühmter Menschen -
doch schon vergessen fast und verloren -
tausend, abertausend, Schubladen gleich in Mauern, Gräber von Menschen wie du und ich -
es kommt dich keine Trauer an -
die Sonne vermittelt so viel Wärme und Wohlbehagen -
dir, dem Fremden aus dem kalten, feuchten Norden -
dort sind keine Zypressen, Oleander, Sonne und Meer -
die Insel jetzt, Burano -
putzig kleine, bunte Häuser -
geputzt - zur Schau gestellt -
in Reihen längs den kleinen Kanälen, Grachten gleich -
alles peinlich sauber und geordnet -
wie in Szene gesetzt - Kulissen -
du machst Rast im Cafe am Kanal -
nichts stört dich mehr -
du bist ruhig und entspannt -
eine tiefe Ruhe durchströmt dich -
du willst diesen Augenblick festhalten -
diese Ruhe -
du bist ruhig und vollkommen entspannt -
|
|
|
|
|
|
|
Du
atmest jetzt tief durch - |
Torcello - Insel bei Venedig
Nach einer Fahrt vorbei an San Michele und Murano hält dein Schiff in Torcello -
der Name klingt schön -
die Insel, klein und kaum höher als das Meer -
sehr wenig Grün nur - zwei, drei Häuser -
im Hintergrund ein Kirchturm, helles, braunes Gemäuer -
du gehst mit wenigen anderen, entlang dem winzig - schmalen Kanal -
Boote, kleine, liegen dort vertäut -
ein kleiner Platz, links und rechts ein Haus, Paläste -
ein paar Schritte weiter Zeugen hoher Zeit -
ein Rundbau, Kirche, byzantinisch -
dahinter eckig, herb mit hohem Turm, der Dom -
die Steine lehmbraun - fast unversehrt -
als einzige Zeugen vergangener Zeit -
einer Zeit, als dieser Ort eine blühende Stadt noch war -
niemand weiß, bis heute nicht, warum hier nichts mehr ist -
nur die beiden Kirchen - und zwei Paläste -
in dem Dom die Apsis, von fast überirdischem Zauber, aus Mosaik -
das ganze Rund strahlend, wirklich strahlend im Dunkel der Kirche -
Gold, Gold und Farben -
auf goldnem Grund in Blau Maria, mit dem Kind -
es berührt dich – wie fein sie, oder doch Venezia, mit dir/ihr knickst -
welche Opfer stecken in diesem Prunk -
der Glaube, die Anbetung
hat fast tausend Jahre
überdauert
du gehst still wieder in die Sonne -
sitzt auf alten Säulenresten und träumst vor dich hin -
die Ruhe dieses Ortes spürst, fühlst du -
auch in dir - du gehst gestärkt von diesem Ort -
weißt nicht wieso -
du bist so ruhig, gelöst und sehr
entspannt -
|
|
|
|
|
|
Du
atmest jetzt tief durch - |
 Kontemplative Texte exemplarisch
in drei Steigerungsstufen ihrer Schlussteile, frei nach: E. Müller 2003, S. 30ff. u. 69-73, ‚Das Gras unter
meinen Füßen ...‘ – mit manchen, gar verlinkenden, Hervorhebungen und (auch – hier vielleicht eher zu unterlassenden, da –
optischen) Illustrationen, bis
Modifikationen, auch O.G.J.'s.
Kontemplative Texte exemplarisch
in drei Steigerungsstufen ihrer Schlussteile, frei nach: E. Müller 2003, S. 30ff. u. 69-73, ‚Das Gras unter
meinen Füßen ...‘ – mit manchen, gar verlinkenden, Hervorhebungen und (auch – hier vielleicht eher zu unterlassenden, da –
optischen) Illustrationen, bis
Modifikationen, auch O.G.J.'s.
|
Ansager einer Ausstrahlung im Juni 2000: «Schließen sie mal, für einen kurzen Moment, die Augen und denken Sie an Venedig. Was sehen Sie? Den Canal Grande, den Campanile, huschende Katzen und arienschmetternde Gondolieri? Ja so entstehen Bilder im Kopf[sic!]. Und vor 40, 50 Jahren – lange vor dem Massentourismus – setzte man sich an sein Radio und ging mit faszinierenden Hörbildern auf Entdeckungsreise. Wenn Sie also das spätherbstliche Venedig so beeindruckend selten erlebt haben, dann liegt das an dem einmaligen Versuch – eine Rundfunksendung zu bebildern.» |
|
Alternative Ansage des Videos (bzw. der Erstausstrahlung): «Verehrte Zuschauer, es ist sicherlich ein ungewöhnlicher Anfang. Sie wollen einen Film über Venedig sehen und stattdessen hält der Regisseur einen Prolog. - Aber so ungewöhnlich der Anfang, so ungewöhnlich war auch die Ausgangsidee für das Nachfolgende. Filme über Venedig gibt es zahllose, ebenso auch Rundfunksendungen. Aber mit diesem Film wurde erstmalig der Versuch unternommen, eine Rundfunksendung – in diesem Falle ein Reisehörbild – originalgetreu, also mit Originalsprache, Text, Geräusche und Musik in Bilder umzusetzen, sprich: zu verfilmen. Was ein Reisehörbild ist, werden jetzt sicher einige fragen. Nun, in den 50er, 60er Jahren war Tourismus noch ein absolutes Fremdwort, auch das Fernsehen steckte noch in den Kinderschuhen. Man saß also vor dem Radio und lauschte eben jenen Reisehörbildern, die Schilderungen fremder Städte waren, Beschreibungen fremder Landschaften oder Ereignisse. Man hörte nur, aber je besser der Autor war, desto plastischer konnte sich die eigene Phantasie, die[sic!] entsprechenden Bilder dazu mahlen. Der diese Kunst, der akustischen Darstellung, brilliant beherrschte, war einer der großen Hörbildautoren des Bayrischen Hörfunks, der 1976 verstorbene Schriftsteller Dr. Reinhard Raffalt. Hören Sie nun seine aus den 50er Jahren stammende Rundfunksendung und sehen Sie die Impressionen über Venedig, die – eine letzte Ungewöhnlichkeit – ich als dessen Neffe rund 44 Jahre später [also etwa 1955 erstmals im Radio ausgestrahlt; O.G.J.] dazu visualisierte. Genießen Sie vor allem die Ruhe, die darin zum Ausdruck kommt. Es ist die Ruhe einer vergangenen[sic!] Zeit, der Hauch der letzten Jahrzehnte: Als man noch Zeit für die Zeit hatte. - Ich wünsche Ihnen dazu: Gute Unterhaltung.» |
|
|
|
|
|
|
Städte die die Welt bedeuten
Ein Film
nach einem Hörbild
von
Reinhard Raffalt
[Aufblende-Musik]
„Ich
nahm am Abend eine Gondel. – Der Gondoliere ruderte
ein Stück den ![]() Canal Grande [sic!] hinauf [sic!]. – Am Dogenpalast bog
er in den Kanal ein, über den die Seufzerbrücke
führt. Wir glitten durch verborgene Schluchten in denen der Lärm, der sich in
den Gassen Venedigs drängt, verstummt war.
Canal Grande [sic!] hinauf [sic!]. – Am Dogenpalast bog
er in den Kanal ein, über den die Seufzerbrücke
führt. Wir glitten durch verborgene Schluchten in denen der Lärm, der sich in
den Gassen Venedigs drängt, verstummt war.
[Musik und Wassergeräusche]
Es ist merkwürdig, welch eine phantastische Rolle im Leben dieser Stadt der Schall spielt. Man hört, wie die Fußgänger, mit eiligen Schritten – es ist kalt und feucht am frühen Abend – in der Hasst aufgescheuchter Marionetten, die Fondamenta entlang eilen. Die Kais, die auf den vierzehnhundert-jährigen Eichenrosten ruhen, worauf [sic!] die Grundmauern Venedigs sich erheben. Der Hall läuft den Häuserfronten entlang, fängt sich an den spitzbogigen Fenstern und Loggien, mit den weißen ziselierten Säulchen. Das Licht nimmt ab, und immer tiefer rudert mich der Gondoliere in die Stille.
[Wassergeräusche]
Jetzt hört man nur noch das Tropfen des Wassers vom Ruder. Kein Fenster ist erleuchtet. Überall sind die Läden dicht geschlossen. Es ist ganz unangebracht, das Bild eines solchen verlassenen Kanals unheimlich oder gespenstisch zu finden. Wahrscheinlich bewohnen die Leute im Winter die Zimmer gegen den Hof zu. Aber man kann nicht gegen das Gefühl an, hier durch ein Reich der Vergangenheit zu gleiten, das durch nichts mehr lebendig erhalten wird, als durch die kaum hörbaren Geräusche, die das Eintauchen des Gondelruders verursacht.
[Wassergeräusche dann Musik]
Die Vergangenheit – ist sie für Venedig eine Last, ein Gewinn oder ein verlorenes Gut? Wer im Winter nach Venedig kommt, und die Stadt entblößt findet, von dem leichten Flitter, den der Fremdenstrom des Sommers jährlich veranlasst, wird erschrecken – wie wenig lebendig geblieben ist [sic! scheint], von einer Stadt, die einmal – durch tausend Jahre – ‚die Welt bedeutet‘ hat.
[Musik]
Inzwischen waren wir an dem palastartigen Gebäude des ehemaligen ![]() Ospetale della Pietà
angekommen. In dem der große Meister
Ospetale della Pietà
angekommen. In dem der große Meister ![]() Antonio Vivaldi im 18.
Jahrhundert, dem letzten glanzvollen
Jahrhundert der venezianischen Geschichte, seine
Abendmusiken zur Aufführung brachte. Der Präsident
Antonio Vivaldi im 18.
Jahrhundert, dem letzten glanzvollen
Jahrhundert der venezianischen Geschichte, seine
Abendmusiken zur Aufführung brachte. Der Präsident ![]() Charles
de Brosses aus
Charles
de Brosses aus ![]() Dijon hat im Jahre 1739 diese Abendmusiken gehört, und darüber in
einem vertraulichen Brief an seine Freunde berichtet: «Die
beste Musik wird hier
Dijon hat im Jahre 1739 diese Abendmusiken gehört, und darüber in
einem vertraulichen Brief an seine Freunde berichtet: «Die
beste Musik wird hier ![]() in
den Hospitälern veranstaltet. Es gibt davon vier, alle ausschließlich für Waisen
und illegitime Kinder, deren Eltern keine Möglichkeit
haben, sie zu ernähren. Die jungen Mädchen werden auf Kosten des Staates erzogen und ausschließlich der
Musik zugeführt. Sie singen wirklich wie die Engel, spielen Geige, Flöte, Oboe,
Violoncello und Fagott. – Kurz, kein Instrument ist so schwer, oder so groß,
dass sie davor zurückschrecken würden. Sie leben in Klausur, wie die Nonnen, die Aufführungen werden nur von
ihnen bestritten, so dass in jedem Konzert ungefähr 40 junge Mädchen mitwirken. Ich kann mich verbürgen, dass nichts auf der Welt graziöser ist, als so ein junges Mädchen zu
sehen, das im weißen Kleid einer Novizin erscheint, mit einem Zweig von
Apfelblüten im Haar, und das Orchester dirigiert, und den Takt mit einer kaum
glaublichen Präzision schlägt.»
in
den Hospitälern veranstaltet. Es gibt davon vier, alle ausschließlich für Waisen
und illegitime Kinder, deren Eltern keine Möglichkeit
haben, sie zu ernähren. Die jungen Mädchen werden auf Kosten des Staates erzogen und ausschließlich der
Musik zugeführt. Sie singen wirklich wie die Engel, spielen Geige, Flöte, Oboe,
Violoncello und Fagott. – Kurz, kein Instrument ist so schwer, oder so groß,
dass sie davor zurückschrecken würden. Sie leben in Klausur, wie die Nonnen, die Aufführungen werden nur von
ihnen bestritten, so dass in jedem Konzert ungefähr 40 junge Mädchen mitwirken. Ich kann mich verbürgen, dass nichts auf der Welt graziöser ist, als so ein junges Mädchen zu
sehen, das im weißen Kleid einer Novizin erscheint, mit einem Zweig von
Apfelblüten im Haar, und das Orchester dirigiert, und den Takt mit einer kaum
glaublichen Präzision schlägt.»
[Musik]
Heute liegt die
Stätte dieser galanten musikalischen Aufführungen in tiefem Schweigen. Aber
immer noch erfüllen die Klänge der ![]() concerti grossi die Musiksäle
der Welt. Wenngleich niemand
mehr daran denkt, welch eines Reichtums es bedurfte, um eine Staatsregierung zu veranlassen, die Insassen
ganzer Waisenhäuser kostenlos zu Künstlerinnen
auszubilden.
concerti grossi die Musiksäle
der Welt. Wenngleich niemand
mehr daran denkt, welch eines Reichtums es bedurfte, um eine Staatsregierung zu veranlassen, die Insassen
ganzer Waisenhäuser kostenlos zu Künstlerinnen
auszubilden.
Überhaupt ist die Regierung
Venedigs, wenn man sie mit den Anstrengungen der Gegenwart vergleicht, ein Wunder
in der Weltgeschichte.
Es gab seit sehr alter Zeit in
der unabhängigen Seestadt einen Rat der
500, den die aristokratischen Familien mit ihren [männlichen]
Mitgliedern beschickten. Wer nicht zu diesen
Familien zählte, war von vornherein von der Regierung ausgeschlossen. Er
konnte in Venedig Handel treiben, ein reicher Mann werden, sich amüsieren, Geld
im Spiel gewinnen, ein großes Haus führen, alle
Welt mit seinem Ruhm erfüllen – nur auf die Geschicke des Staates hatte er keinerlei Einfluss. Die 500
Ratsmitglieder aber, die dem – seit
vielen Jahrhunderten verschwägerten –
Clan der inneren Staatsfamilie angehörten,
wählten, wenn ein Doge gestorben war, durch Würfel 30 Männer aus ihrer
Mitte. Um zu verhindern, dass bei dieser Würfelwahl mit falschen, im Ärmel
verborgenen, Würfeln gespielt wurde, war es Vorschrift, dass die auf einem
Silberteller geworfenen Würfel nur mit dem ausgestreckten Zeigefinger einer
kleinen goldenen Behelfshand verschoben werden durften. Waren die 30 gewählt,
so vollzog sich folgender weitere Wahlvorgang:
Die 30 wählten, stets aus dem Rat der 500, neun. Am nächsten Tag trat man
wieder zusammen und die neun wählten 40. Am darauf folgenden Tag wählten die 40
zwölf. Die zwölf wählten 25, die 25 wieder neun, die neun 45, die 45 elf, die
elf 41. Und am neunten Tage der Wahl
wählten die 41 den Dogen mit wenigstens 25
zustimmenden Würfeln. Auf diese Weise war
mit absoluter [sic! spätestens solange kein
Dogenkandidat die 25 zustimmenden Wahklmänner erreichte,
waren weitere Wahlgänge erforderlich: Verhandlungen und Manipulationen durchaus
möglich und gängig; O.G.J. mit der
historischen Fprschung] Sicherheit
vermieden, dass irgendeine Familie,
die dem großen Rate angehörte, Privatpolitik
auf Kosten des Staates machen [sic! sogar ‚gemeinwesentliches‘-beabsichtigende Leute irren gerade dabei: Institutionen
und Verfahrenweisen sind/werden nie besser als
jene Menschen, die
sich ihrer zu bedienen haben; O.G.J. bei/wegen
aller Lernfähigkeiten der Menschenheit juristisch und politologisch ernüchtert] konnte.
Den Fremden wird heute im Dogenpalast, anstelle dieses Stiches [sic? vom Wahlverfahren], lieber die berühmte Öffnung gezeigt, durch die anonyme Denunziationen zur Kenntnis der gefürchteten venezianischen Staatsinquisition gelangen konnten, ohne dass der Kläger die Pflicht hatte, mit Namen und Person aufzutreten. Auch dies hatte damals seinen Grund: Venedig war, in den letzten Jahrhunderten seiner selbständigen Geschichte, ein Sammelpunkt für die halb aristokratische, halb abenteuerliche gesellschaftliche Oberschicht Europas geworden. Die in den Palästen, Kaufhäusern und Gassen der farbenreichen Stadt, durch sechs Monate im Jahr, Narrenfreiheit im Karneval genoss. Und da war es manchmal von Staatswegen kaum möglich, gegen Personen, die unter dem Schutz einer ausländischen Macht standen, aber falsche Spielkarten in der Tasche hatten, offiziell einzuschreiten. Der Staatsgerichtshof pflegte sich, in solchen Fällen, meistens selbst der anonymen Anklage zu bedienen, die ihn berechtigte, die erwünschte Ausweisung – ohne diplomatische Schwierigkeiten – vorzunehmen.
 Und damit wären wir bei einem Gebiet angelangt, das die
bewundernswerteste Leistung dieser bewundernswerten Stadt
darstellt: Die Diplomatie. Wenn man sich heute
die Venezianer ansieht, mit der halb singenden – an geschlossenen Vokalen reichen Sprache ihrer
Vaterstadt –, mit der stets kontrollierten Gebärde ihrer Rede, mit der polierten Höflichkeit ihrer
Umgangsformen, der geduldigen und schwer durchschaubaren Verschleierungstaktik
ihres Gesellschaftsgebarens – dann kommt es einem, selbst in den kleinen
Dingen, in denen der Venezianer gegenüber dem Fremden, seinen Vorteil sucht,
manchmal vor, als habe diese merkwürdige Insel-Rasse [sic!] von [sic!]
Diplomatie mehr begriffen, als man auf irgendeiner der dazu errichteten
offiziellen Schulen lernen
könnte. Diplomatie im venezianischen Sinn,
das heisst [sic!]: einem Gegner – selbst wenn er ein, durch Hass und Leidenschaft intolerant
gewordener echter, Feind ist – an einem einzigen schwachen Punkt, mit vollendeter Höflichkeit, zu schmeicheln. Um ihn
dadurch, vielleicht in sehr viel späterer Zeit, einmal zum Freund zu haben. Venezianische Diplomatie hat sich niemals darauf
eingelassen, Macht zu zeigen; sie hat immer nur [sic!] versucht, die Machtmittel der anderen im eigenen
Interesse zu lenken. Der klassische venezianische Diplomat war niemals ein
Mann, der durch persönlichen Einfluss die Weltgeschichte in eine andere Richtung zu lenken versuchte –
sondern stets ein realistischer Kontorist, der das 'Für und Wider', das ‚Soll
und Haben‘ der gegenwärtigen politischen Konstellation dazu benutzte, um einen
kleinen aber augenblicklichen Vorteil zu erringen, während er es den anderen
überlies über wahrscheinliche aber zukünftige große Vorteile Kriege zu führen. Dieser Diplomatie ist es zu
verdanken, dass die Serenissima – die [Adels-]Republik
Venedig, die auf den schwankenden Grund des Meeresbodens
aufgebaut war – länger gehalten hat als
irgendeine andere staatliche Institution in Europa. Denn wenngleich sich die
Methoden der Politik sehr geändert haben, so sind doch einige Erkenntnisse in der Weltgeschichte gleich geblieben.
Und die Venezianer können den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, schon sehr früh
in den Besitz
dieser Erkenntnisse gekommen zu sein, ohne sie ihren Handelspartnern oder ihren politischen
Gegnern – am
wenigsten aber ihren Freunden – jemals verraten zu
haben.
Und damit wären wir bei einem Gebiet angelangt, das die
bewundernswerteste Leistung dieser bewundernswerten Stadt
darstellt: Die Diplomatie. Wenn man sich heute
die Venezianer ansieht, mit der halb singenden – an geschlossenen Vokalen reichen Sprache ihrer
Vaterstadt –, mit der stets kontrollierten Gebärde ihrer Rede, mit der polierten Höflichkeit ihrer
Umgangsformen, der geduldigen und schwer durchschaubaren Verschleierungstaktik
ihres Gesellschaftsgebarens – dann kommt es einem, selbst in den kleinen
Dingen, in denen der Venezianer gegenüber dem Fremden, seinen Vorteil sucht,
manchmal vor, als habe diese merkwürdige Insel-Rasse [sic!] von [sic!]
Diplomatie mehr begriffen, als man auf irgendeiner der dazu errichteten
offiziellen Schulen lernen
könnte. Diplomatie im venezianischen Sinn,
das heisst [sic!]: einem Gegner – selbst wenn er ein, durch Hass und Leidenschaft intolerant
gewordener echter, Feind ist – an einem einzigen schwachen Punkt, mit vollendeter Höflichkeit, zu schmeicheln. Um ihn
dadurch, vielleicht in sehr viel späterer Zeit, einmal zum Freund zu haben. Venezianische Diplomatie hat sich niemals darauf
eingelassen, Macht zu zeigen; sie hat immer nur [sic!] versucht, die Machtmittel der anderen im eigenen
Interesse zu lenken. Der klassische venezianische Diplomat war niemals ein
Mann, der durch persönlichen Einfluss die Weltgeschichte in eine andere Richtung zu lenken versuchte –
sondern stets ein realistischer Kontorist, der das 'Für und Wider', das ‚Soll
und Haben‘ der gegenwärtigen politischen Konstellation dazu benutzte, um einen
kleinen aber augenblicklichen Vorteil zu erringen, während er es den anderen
überlies über wahrscheinliche aber zukünftige große Vorteile Kriege zu führen. Dieser Diplomatie ist es zu
verdanken, dass die Serenissima – die [Adels-]Republik
Venedig, die auf den schwankenden Grund des Meeresbodens
aufgebaut war – länger gehalten hat als
irgendeine andere staatliche Institution in Europa. Denn wenngleich sich die
Methoden der Politik sehr geändert haben, so sind doch einige Erkenntnisse in der Weltgeschichte gleich geblieben.
Und die Venezianer können den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, schon sehr früh
in den Besitz
dieser Erkenntnisse gekommen zu sein, ohne sie ihren Handelspartnern oder ihren politischen
Gegnern – am
wenigsten aber ihren Freunden – jemals verraten zu
haben.
[Wasser und Stadtgeräusche]
Mein Gondoliere auf dem Heck, lamentiert über die Gegenwart. Die mit ihren Motorboten das alte Handwerk der Gondelfahrer ruiniert. Und wie eine ungerufene Antwort braust eine schwer beladene Barke mit röhrendem Motor um die Ecke, und das laut gerufene «Hoij», der Warnruf der Gondolieri, hat keine Wirkung mehr. Er hat recht, der Gondoliere, wenn er sagt, dass die Motorboote die alte Stadt zerstören. Der Wellenschlag, den sie werfen frisst an den zernagten Fundamenten der Paläste. Und die alte aristokratische Kaste der Gondolieri kämpft verzweifelt um ihren Fortbestand. Den Männern in den kurzen schwarzen Jacken und den breitkrempigen spanischen Hüten erscheint es fast als hoffnungslos, noch immer mit der traditionellen Eifersucht und dem ererbten Stolz über die sachgemäße Ausübung ihres tänzerischen Handwerks zu wachen. Im 18. Jahrhundert gab es in Venedig über 12.000 Gondeln - heute sind es nur noch etwa 450. Keine einzige der alteingesessenen Familien Venedigs hält es noch für notwendig sich Hausgondeln zu halten. Wohl gibt es immer noch Ruderer in dieser Stadt, die ihr ganzes Leben darauf warten, in die hochmütige und geschlossene Zunft der Gondelfahrer aufgenommen zu werden. Aber die Söhne dieser Gondelfahrer lernen schon, ihr Brot auf andere Weise zu verdienen. Noch ist jedes Jahr die große Regatta auf dem Canal Grande, deren Sieger das Recht erhält ein Gondoliere zu werden. - Aber immer mehr wird sie ein Spektakel für den Fremdenverkehr – immer weniger bleibt sie ein echter [sic!] Wettkampf.
[Musik]

Indessen vergisst der
Gondoliere, dass die Gondel unzerstörbar ist. Ich habe immer gefunden, dass
zwischen den venezianischen Gondeln und den venezianischen Frauen einige bemerkenswerte,
zeitlose Ähnlichkeiten bestehen: Beide sind zum Beispiel nur mit
abgefeimter [sic!] Geschicklichkeit und List dazu zu bewegen, einen geraden Kurs
einzuschlagen. Beide haben die Leichtigkeit des Gleitenden und Flüchtigen [sic!], des
Spielerischen und Unberechenbaren. Zärtliche Durchtriebenheit und schläfrige
Grazie. Eine Gondel hat keinen Kiel und kein Steuer und keinen Scherpunkt in
der Mitte. Sie erlaubt ihrem Lenker nur, sie mittels Ruderschlägen
fortzutreiben, die dem Element des Wassers zugefügt werden - nicht ihr selbst.
Widerstand ist ihr unbekannt, Gewalt schädlich und die rohe der Intelligenz
entbehrende Kraft kommt nicht mit ihr
aus. Alles ist auf Feinheit, auf Sensibilität, auf eine tänzerische Kunst des
Nachgebens abgestimmt.  Und im Bau der Gondel spiegelt sich das komplizierte der
venezianischen Seele. Eine Gondel besteht nicht einfach aus Holz. Sie besteht
aus neun verschiedenen Hölzern, die nach Gewicht, Alter und Trockenheit
ausgelesen sind und bestimmten Aufgaben dienen. Als Sinnbild dafür, dass jede
Gondel das Wesen der Seestadt Venedig vertritt, trägt der Bug des leichten Fahrzeugs
einen Beschlag aus Metall. Der oben in einer Art Horn endigt. In der Form der
Fischermütze, die die Dogen in ihrer Staatstracht
als Kopfbedeckung trugen. Darunter springen sechs Zacken vor, die die sechs
Quartiere von Venedig bedeuten: San Marco, die
Insel Giudecca [sic! Dorsoduro an/mit deren Canal; O.G.J.], San Paolo, Cannaregio. Castello und Santa
Croce. Die Gondel bewegt sich nur, wenn der
Gondoliere einen Ballettschritt, auf dem nicht ganz gerade Heck, vollführt.
Einen Tanzschritt, den niemand [sic!] erlernen kann, der
nicht von Kind auf das Ruder gehandhabt hat. Seit dem Jahre 1562 sind diese wunderbaren
und geschmeidigen Boote nicht mehr bunt und von Gold strahlend, wie vorher,
sondern schwarz. Dies hat eine bemerkenswerte Geschichte: Die Bürger Venedigs
haben sich seit den ältesten Zeiten stets aufs Neue in die Dinge verliebt, die
sie besessen haben, die ihnen das karge, gefährliche und unbarmherzige Leben auf der Höhe des Meeres
gelassen hat. Und die sie mit einer Leidenschaft ohnegleichen zu vervollkommenen
trachteten. Kurz vor dem besagten Jahre 1562 waren die Gondeln zum Objekt einer solchen Verschwendung an
Zierrat und echtem Schmuck geworden, dass der Senat sich gezwungen sah, ein
Dekret zu erlassen, demzufolge - von nun an – nur noch schwarze Gondeln benutzt
werden durften. Dies geschah nicht etwa aus dem Bestreben Hofffahrt
und Prunkseligkeit der Venezianer einzuschränken. Sondern aus der ganz
nüchternen Erkenntnis, dass der Mittelstand im Begriffe war, sich an seinen
Gondeln zu ruinieren. – Es ist aber einer der geheimnisvollen Vorteile
Venedigs, dass
Einschränkungen Eleganz hervorrufen; dass eine Verminderung des Aufwandes,
eine Erhöhung der Grazie bewirkt. Und so haben auch die Gondeln ihre Vollkommenheit erst erreicht, als sie
die Farbe der Nacht annahmen.
Und im Bau der Gondel spiegelt sich das komplizierte der
venezianischen Seele. Eine Gondel besteht nicht einfach aus Holz. Sie besteht
aus neun verschiedenen Hölzern, die nach Gewicht, Alter und Trockenheit
ausgelesen sind und bestimmten Aufgaben dienen. Als Sinnbild dafür, dass jede
Gondel das Wesen der Seestadt Venedig vertritt, trägt der Bug des leichten Fahrzeugs
einen Beschlag aus Metall. Der oben in einer Art Horn endigt. In der Form der
Fischermütze, die die Dogen in ihrer Staatstracht
als Kopfbedeckung trugen. Darunter springen sechs Zacken vor, die die sechs
Quartiere von Venedig bedeuten: San Marco, die
Insel Giudecca [sic! Dorsoduro an/mit deren Canal; O.G.J.], San Paolo, Cannaregio. Castello und Santa
Croce. Die Gondel bewegt sich nur, wenn der
Gondoliere einen Ballettschritt, auf dem nicht ganz gerade Heck, vollführt.
Einen Tanzschritt, den niemand [sic!] erlernen kann, der
nicht von Kind auf das Ruder gehandhabt hat. Seit dem Jahre 1562 sind diese wunderbaren
und geschmeidigen Boote nicht mehr bunt und von Gold strahlend, wie vorher,
sondern schwarz. Dies hat eine bemerkenswerte Geschichte: Die Bürger Venedigs
haben sich seit den ältesten Zeiten stets aufs Neue in die Dinge verliebt, die
sie besessen haben, die ihnen das karge, gefährliche und unbarmherzige Leben auf der Höhe des Meeres
gelassen hat. Und die sie mit einer Leidenschaft ohnegleichen zu vervollkommenen
trachteten. Kurz vor dem besagten Jahre 1562 waren die Gondeln zum Objekt einer solchen Verschwendung an
Zierrat und echtem Schmuck geworden, dass der Senat sich gezwungen sah, ein
Dekret zu erlassen, demzufolge - von nun an – nur noch schwarze Gondeln benutzt
werden durften. Dies geschah nicht etwa aus dem Bestreben Hofffahrt
und Prunkseligkeit der Venezianer einzuschränken. Sondern aus der ganz
nüchternen Erkenntnis, dass der Mittelstand im Begriffe war, sich an seinen
Gondeln zu ruinieren. – Es ist aber einer der geheimnisvollen Vorteile
Venedigs, dass
Einschränkungen Eleganz hervorrufen; dass eine Verminderung des Aufwandes,
eine Erhöhung der Grazie bewirkt. Und so haben auch die Gondeln ihre Vollkommenheit erst erreicht, als sie
die Farbe der Nacht annahmen.
[Musik]
Heute fahren nur noch die Fremden in Gondeln durch die
Stadt. Hochzeitsreisende und Liebespaare, die auf der Suche nach der beruhigten
Romantik eines verträumten Zeitalters hierher kommen, um sich bei Serenadengetön und bengalischer Beleuchtung über den Canal Grande schaukeln zu lassen. Die Venezianer geben sich
die grösste Mühe, die Wünsche dieser Fremden
zufrieden zu stellen und sie spielen ihnen auf Mandolinenchören die schönsten
Melodien vor, die sie können. ‚Santa Lucia‘ zu Beispiel, komponiert von einem
Mann, aus Sachsen, worin der Glanz Neapels besungen wird. Oder das Vorspiel der
Oper #hier ![]() ‘La Traviata‘.
‘La Traviata‘.
[Musik]
Man muss aber schon viel Glück haben, wenn man, unter den vielen abendlich erklingenden Liedern, einmal eine echte venezianische Kantone hört. Wie das Lied von Marietta, der braunäugigen, blonden Marietta, die in die Gondel kommen soll, per fare l‘amore, und nicht will; weil – nun eben aus demselben Grund, der den Frauen Venedigs die Liebe stets ebenso gefährlich wie teuer erscheinen ließ: aus Capriccio.
[Musik]
[Wassergeräusche]
Wer in Venedig keine Gondel oder kein Motorboot besitzt, und nicht gerade einem Ziel zustrebt, das am Canal Grande liegt, geht zu Fuss. Und es ist sehr eigenartig in dieser Stadt zu Fuss zu gehen.
[Fussgängergeräusche]
Die Gassen sind kaum zwei Meter breit, die Häuser vier und mehr Stockwerke hoch. Man hört die Gespräche der entgegenkommenden Leute, wie wenn man sich in einem Salon oder im Foyer eines Theaters befände.
[Gassengeräusche]
Sich in diesen Gassen mit größerem Tempo fortzubewegen erfordert eine doppelte Kunst. Man muss ausweichen können und man muss die Durchschlupfe wissen, die immer wieder unter den Häusern durchführen und in andere Gassen münden. Die man hier übrigens nicht via sondern wie im Spanischen caije [callejón / calle??????] nennt. Fasst immer hört man von fern her Glocken, deren Schall über die Dächer hinwegschwingt, ohne ganz auf den Grund der Gassen zu dringen.
[Geräusche der Gassen]
Ausweichen
können und verborgene Umwege finden,
das hat man in Venedig stets geschätzt. – Man muss sich
einmal überlegen, wie dieses rätselhafte Stadtgebilde zustande
kam. Als der Hunnenkönig Attila sich anschickte, über Italien
hereinzubrechen, gab es noch kein Venedig. Die nachmaligen Venezianer lebten
noch in kleinen Städten und Kolonien am Ufer der Adria, die grosse
Lagune hatte noch keinen anderen Reiz, als den des Fischfangs. Erst die Gefahr
der Barbareneinfälle lies jenen Plan aufkommen, auf der Lagune draussen eine Stadt zu gründen. Der das Meer, von dem man
lebte, auch die Sicherheit geben sollte. Besser die ständige Gefahr des
vertrauten Elements, als die Eingriffe
räuberischer Heiden. So entschied man damals. Und aus den Fischern der
Uferstädte wurden so schnell amphibische Meerwesen, dass der Minster ![]() Casiodorus, in seinem Brief an die Tribuni
Maritime von Venezien, schon den
Charakter der künftigen Seestadt definieren konnte, kaum ein Jahrhundert nachdem Attila
erschienen war: «Euch ist es
gegeben», schreibt
Casiodorus, in seinem Brief an die Tribuni
Maritime von Venezien, schon den
Charakter der künftigen Seestadt definieren konnte, kaum ein Jahrhundert nachdem Attila
erschienen war: «Euch ist es
gegeben», schreibt ![]() Casiodor, «im leichten Flügelschlag der Vögel über die
Meere hinweg zu ziehen, die Eure Heimstatt sind. Armut und Reichtum leben bei
Euch zusammen unter demselben Gesetz. Und
Eurer Kunst ist alles anheimgefallen, was fliesst und strömt.» Aus
diesem Element des Fließens und Strömens zogen die Veneziahner
durch vierzehnhundert Jahre ihre Einsichten. Auf die Bewegung, die
Verwandlung, das Unsichere war
stets ihr Sinn gerichtet. Und deshalb war in Venedig eine Perle stets mehr
wert als ein Landgut, ein Schiff voll Pfeffer wichtiger
als ein Regiment von Landsknechten, eine Handelsniederlassung beim Grosstürken interessanter
als ein Vertrag mit dem Kaiser, Cassanova faszinierender als Napoleon.
Casiodor, «im leichten Flügelschlag der Vögel über die
Meere hinweg zu ziehen, die Eure Heimstatt sind. Armut und Reichtum leben bei
Euch zusammen unter demselben Gesetz. Und
Eurer Kunst ist alles anheimgefallen, was fliesst und strömt.» Aus
diesem Element des Fließens und Strömens zogen die Veneziahner
durch vierzehnhundert Jahre ihre Einsichten. Auf die Bewegung, die
Verwandlung, das Unsichere war
stets ihr Sinn gerichtet. Und deshalb war in Venedig eine Perle stets mehr
wert als ein Landgut, ein Schiff voll Pfeffer wichtiger
als ein Regiment von Landsknechten, eine Handelsniederlassung beim Grosstürken interessanter
als ein Vertrag mit dem Kaiser, Cassanova faszinierender als Napoleon.
Das Verbotene
hatte stets eine besondere Anziehungskraft. Die Venezianer scheuten sich nicht:
aus den Kreuzzügen ein Geschäft zu machen; mit dem Sultan von Konstantinopel
einen Vertrag zu schliessen, während der Papst mit
ihm im Kriege lag; sich zur Erweiterung und Sicherung ihrer Macht grosser Feldherren zu bedienen, die man nach Erfüllung
ihrer Aufgabe sogleich wieder stürzte. Selbst ihren eigenen Leuten haben sie in
kühler Kalkulation den Prozess gemacht, wenn es der Gloria di Venezia nützlich
schien. Im 15. Jahrhundert hatten die Venezianer einen Dogen
namens Francesco Foscari, einen kühnen, energischen,
hochbegabten Staatsmann. Eine der großen Familien der Stadt war seit langem mit
den Foscaris tief verfeindet: die Loredan.
Es ist ein fürchterliches Drama, das sich in den 34 Jahren unter der Herrschaft
Francescos abspielte. Niemand von den Loredan konnte
und wollte leugnen, dass Foscari ein überragender
Geist war. Man verlegte sich also darauf, seine Staatsklugheit der [Asels-]Republik
zu erhalten, während man daran ging, ihn menschlich zu ruinieren. Der Höhepunkt
dieser jahrelang gesponnenen Großintrige war das Urteil, das die Loredan gegen den Sohn des Dogen bei der Signoria durchsetzten.
Dieser Sohn wurde, unter ziemlich
fadenscheinigen [sic! die meisten
Historiker (bis Originaldolumente)
erzählen diese heftige, längere Krise
der Institutionen um den Zehnerrat inzwischen etwas
weniger einseitig und nicht nur so individuell personalisiert/familial, wie das hier referierte Capricco
berühmter Dichter; O,G,J. zumindest weder dem Dogensohn ‚Unschuld‘ zusprechend
(wo nicht Amtsversäumnisse und Verdienste sowohl des ‚alten‘ Dogen als auch verschiedener
Ratsgremien bemerkend), noch des Dogennachfolgers Haltung allein, etwa Loredan, zurechnend – oder Ereignisse derart passend synchronisierend] Gründen,
aus der Stadt verbannt, und zwar auf die Lebenszeit des Vaters. Der junge Foscari ging zu seinem Vater in den Dogenpalast,
umarmte ihn, bestieg ein Schiff, dessen oberster Herr
sein Vater war, segelte davon, und beide haben sich nie wieder gesehen. Der
alte Doge trug daran so schwer, dass er sein Amt zur Verfügung stellte.
Diejenigen, die am meisten gegen die Abdankung protestierten, waren seine Feinde,
Loredan. Foscari musste
Doge bleiben, solange, bis die Loredan es selbst für richtig
fanden, ihn abzusetzen. - Als dann eines Tages der Rat der Zehn bei dem 80-jährigen
erschien, um ihm zu verkünden, dass er nun gegen könne, bäumte sich der ganze verletzte Stolz des
Dogen auf. Doch es genügte eine einzige Nacht um in ihm das uralte, düstere
Gehorsamsgefühl übermächtig werden zu lassen, das jeden Venezianer gegenüber der Signoria beseelte. Foscari
ging, lebte noch ein paar Tage, und starb dann, zur gleichen Stunde in der sein
Nachfolger in San Marco den Thron bestieg. Als Giacomo ![]() Loredan hörte, dass
Loredan hörte, dass ![]() Francesco
Foscari gestorben war, ging er in die Signoria und erwirkte, dass man den alten Foscari begrub, als ob er bis an sein Lebensende Doge
gewesen wäre.
Francesco
Foscari gestorben war, ging er in die Signoria und erwirkte, dass man den alten Foscari begrub, als ob er bis an sein Lebensende Doge
gewesen wäre.
Das Leben auf dem Gipfel des venezianischen Staates war
stets so gefährlich, dass der Feldherr ![]() Francesco
Morrosini sich ein, noch erhaltenes, Gebetbuch
anfertigen liess, worin die Buchseiten erheblich
schmäler waren, als das Format des Buchdeckels. Und in dem so geschaffenen Raum
lag stets eine kleine, geladene Pistole. In der wunderbaren Bibliothek von San Marco viel mir ein galantes, in
feines Gold gebundenes, Büchlein in die Hände, das ein venezianischer Senator seinem Sohn mit der Widmung
geschenkt hatte: «Suche den Schlaf, wenn Du liebst; scheue
ihn, wenn Du spielst; fürchte ihn, wenn Du regiert.»
Francesco
Morrosini sich ein, noch erhaltenes, Gebetbuch
anfertigen liess, worin die Buchseiten erheblich
schmäler waren, als das Format des Buchdeckels. Und in dem so geschaffenen Raum
lag stets eine kleine, geladene Pistole. In der wunderbaren Bibliothek von San Marco viel mir ein galantes, in
feines Gold gebundenes, Büchlein in die Hände, das ein venezianischer Senator seinem Sohn mit der Widmung
geschenkt hatte: «Suche den Schlaf, wenn Du liebst; scheue
ihn, wenn Du spielst; fürchte ihn, wenn Du regiert.»
[Musik dann Glocken]
Man kann in
Venedig kaum 200 Schritt gehen ohne eine Kirche zu finden.
Am Abend sind die Portale offen, und die
Prediger aus den Mönchskonventen
halten Abendbetrachtungen für das Volk.
In der ganz mit Purpur-Brokat ausgeschlagenen Kirche von #hier![]() San Moisè Propheta steht der kleine Franziskanerpater, den Sie hier
hören. [Hintergrundtext-Gemurmel] Aceservon risanti Frater [?????]. Wozu dienen die Heiligen? Wozu sind
sie gut, die Heiligen? – Eine ganz und gar venezianische
Frage. Dieses Venedig hat mit seinen Heiligen einen Kult getrieben, wie
kaum eine andere Stadt dieser Welt. Im Namen
des heiligen Markus hat es seine Kriege geführt. Es hat aus dem Orient die
San Moisè Propheta steht der kleine Franziskanerpater, den Sie hier
hören. [Hintergrundtext-Gemurmel] Aceservon risanti Frater [?????]. Wozu dienen die Heiligen? Wozu sind
sie gut, die Heiligen? – Eine ganz und gar venezianische
Frage. Dieses Venedig hat mit seinen Heiligen einen Kult getrieben, wie
kaum eine andere Stadt dieser Welt. Im Namen
des heiligen Markus hat es seine Kriege geführt. Es hat aus dem Orient die ![]() Madonna Nikopoia - Maria die Siegreiche – geraubt und nach San Marco gebracht. Es hat die Gedenktage der Heiligen zu Staatsfesten
gemacht, deren Prunk uns noch heute auf den glühenden Bildern
Madonna Nikopoia - Maria die Siegreiche – geraubt und nach San Marco gebracht. Es hat die Gedenktage der Heiligen zu Staatsfesten
gemacht, deren Prunk uns noch heute auf den glühenden Bildern ![]() Canalettos
und
Canalettos
und ![]() Guardis entgegenleuchtet. Aber
war es jemals eine christliche Stadt? Hat es nicht vielmehr stehts
die Heiligen dazu benützt, etwas zu erwirken, was nichts mit der ewigen Seeligkeit, sondern mit zeitlichem Vorteil, zu tun hatte? Vielleicht haben die
Venezianer gerade deshalb so herrliche, mystisch vergoldete Kirchen, weil es
ihnen auch in der Kirche unmöglich war, nicht zu rechnen, zu kalkulieren, zu
intrigieren, politisch zu sein. - Man hat fast das Gefühl, dass die schwache
Flamme des Glaubens [sic!] erst dann
in Venedig stärker zu leuchten begann, als es mit der Macht, der Souveränität
und dem Staate endgültig vorbei war – seit
dem Anfang des vorigen [19.] Jahrhunderts. Das Rätsel daran
ist nur, dass die Kirchen Venedigs fromme [sic!] Kirchen sind, vom Kerzenschein überhauchte feierliche
Hallen, und dass in ihnen seit vielen Jahrhunderten Chöre erklingen, die man
niemals vergisst.
Guardis entgegenleuchtet. Aber
war es jemals eine christliche Stadt? Hat es nicht vielmehr stehts
die Heiligen dazu benützt, etwas zu erwirken, was nichts mit der ewigen Seeligkeit, sondern mit zeitlichem Vorteil, zu tun hatte? Vielleicht haben die
Venezianer gerade deshalb so herrliche, mystisch vergoldete Kirchen, weil es
ihnen auch in der Kirche unmöglich war, nicht zu rechnen, zu kalkulieren, zu
intrigieren, politisch zu sein. - Man hat fast das Gefühl, dass die schwache
Flamme des Glaubens [sic!] erst dann
in Venedig stärker zu leuchten begann, als es mit der Macht, der Souveränität
und dem Staate endgültig vorbei war – seit
dem Anfang des vorigen [19.] Jahrhunderts. Das Rätsel daran
ist nur, dass die Kirchen Venedigs fromme [sic!] Kirchen sind, vom Kerzenschein überhauchte feierliche
Hallen, und dass in ihnen seit vielen Jahrhunderten Chöre erklingen, die man
niemals vergisst.
[Chorgesang]
San Marco – die Gewölbe sind eine Kruste von Gold – Kuppeln, die wie riessengrosse dunkel-glühende Sonnen über den Räumen schweben. Säulen aus Porphyr – der Weihrauchduft von tausend Jahren. Der Markus-Schrein, von Juwelen übersäht. Der Fussboden hebt und senkt sich, wie das Meer. Am Triumphbogen steht: «Schütze mit der Kraft des Löwen – Oh Markus - den Orient, Italien und Dein Venedig.»
[Glockengeläut]
Seit vielen Jahrhunderten betrachten die Menschen die Seestadt Venedig als eine Stadt des Märchens. Märchenhaft erschien der Reichtum, der in ihren
Schatzhäusern aufgehäuft war, unvorstellbar ihre Macht, unkontrollierbar ihre
Politik. Man warf der [Adels-]Republik Wortbruch und
Treulosigkeit vor, und bewunderte ihre Geschmeidigkeit. Man wusste, von der Grausamkeit ihrer Justiz, Schandtaten zu berichten,
und lieferte sich ihr aus, um den Karneval
zu feiern. Man fürchtete ihre Rache,
und baute auf ihre Toleranz. Man war sich niemals darüber klar, was Venedig
übel nahm, was es verzieh, was es vergass, was es
behielt. Es war ein Fehen-Wesen, dem gegenüber sich
die reale [sic!] Welt sich hilflos,
und noch nicht ganz erzogen, fühlte. Die Venezianer waren im ganzen Abendland
verhasst, wegen ihrer Lügenhaftigkeit,
und alle Welt vertraute ihnen Geld an. Überall
wurden sie für besitzgierige Räuber gehalten, aber jedermann war sich des
Vorteils bewusst, den es bedeutete, mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Der #hier![]() Fondaco dei Tedeschi,
das grosse Kaufhaus der Deutschen, auf dem #hier
Fondaco dei Tedeschi,
das grosse Kaufhaus der Deutschen, auf dem #hier ![]() Rialto brannte einmal aus. Zu einer Zeit, als die
Handelsfamilien der #hier
Rialto brannte einmal aus. Zu einer Zeit, als die
Handelsfamilien der #hier![]() Fugger
und der #hier
Fugger
und der #hier![]() Welser schon längst eine scharfe Konkurrenz für
Venedig geworden waren. Und die Venezianer bauten den grossen
Handelspalast, auf Staatskosten, wieder auf, und übergaben ihn, fertig
eingerichtet, ihren Konkurrenten [sic!]. Überall
und in jeder Epoche, schien Venedig ein
Rätsel zu sein: Eine nicht einzuordnende Größe im Spiel der Welt.
Etwas womit man nicht rechnen konnte - von dem man aber wusste, dass es selber
rechnete. Auf den Stichen, die im 18.
Jahrhundert von der Stadt angefertigt wurden, thront über ihr der #hier
Welser schon längst eine scharfe Konkurrenz für
Venedig geworden waren. Und die Venezianer bauten den grossen
Handelspalast, auf Staatskosten, wieder auf, und übergaben ihn, fertig
eingerichtet, ihren Konkurrenten [sic!]. Überall
und in jeder Epoche, schien Venedig ein
Rätsel zu sein: Eine nicht einzuordnende Größe im Spiel der Welt.
Etwas womit man nicht rechnen konnte - von dem man aber wusste, dass es selber
rechnete. Auf den Stichen, die im 18.
Jahrhundert von der Stadt angefertigt wurden, thront über ihr der #hier![]() Gott Merkur, der Gott des Handels, und der Gott der
Diebe. Und Venedig machte nie ein Hehl daraus,
dass es das Eine von dem Anderen nur schwer trennen konnte. Die Venezianer richteten ihre
Segel stets nach den Winden; und sie wunderten sich nicht
wenn die Winde von Afrika, vom Orient, von Spanien und von Deutschland,
manchmal zu gleicher Zeit, auf die Seestadt zustürmten. Sie hatten sich von der
Gott Merkur, der Gott des Handels, und der Gott der
Diebe. Und Venedig machte nie ein Hehl daraus,
dass es das Eine von dem Anderen nur schwer trennen konnte. Die Venezianer richteten ihre
Segel stets nach den Winden; und sie wunderten sich nicht
wenn die Winde von Afrika, vom Orient, von Spanien und von Deutschland,
manchmal zu gleicher Zeit, auf die Seestadt zustürmten. Sie hatten sich von der ![]() Terraferma – vom festen Land, vom wohlgegründeten Boden –
unabhängig gemacht. Und sie hielten sich,
von Anfang an, nicht mehr für verpflichtet, den Gesetzen der materiellen, der moralischen und
der religiösen Schwerkraft zu folgen. Wenn der Boden unter den Füssen wankt,
weil der schwimmt, dann ist es eben kein Boden mehr, sondern nur noch eine
Planke. Und was diese Planke an Sicherheit nicht bieten kann, wiegt sie durch Beweglichkeit auf. Niemals mehr
hat es ein Stadtvolk gegeben, das in der Welt an so vielen verschiedenen Orten, zur
gleichen Zeit, und im gleichen Sinne, am Schicksal [sic!] mitgewirkt
hat.
Terraferma – vom festen Land, vom wohlgegründeten Boden –
unabhängig gemacht. Und sie hielten sich,
von Anfang an, nicht mehr für verpflichtet, den Gesetzen der materiellen, der moralischen und
der religiösen Schwerkraft zu folgen. Wenn der Boden unter den Füssen wankt,
weil der schwimmt, dann ist es eben kein Boden mehr, sondern nur noch eine
Planke. Und was diese Planke an Sicherheit nicht bieten kann, wiegt sie durch Beweglichkeit auf. Niemals mehr
hat es ein Stadtvolk gegeben, das in der Welt an so vielen verschiedenen Orten, zur
gleichen Zeit, und im gleichen Sinne, am Schicksal [sic!] mitgewirkt
hat.
Wenn eine Insel, ein Stück Land im Meer ist, so ist Venedig ein Stück Gold im Meer. Deshalb war für die Venezianer die Natur niemals wichtig – die Kunst aber ein Lebenselement. Wenn die Menschen anderswo [sic!] Gärten anlegten, malten die Venezianer Bilder. Das Licht war wichtiger als der Gegenstand, der [sic!] Himmel wichtiger [sic!] als die Erde, und der Wellenschlag des Meeres – der sie mit allen Küsten der Welt verband – lebt fort in ihrer Musik. Venedig wurde nicht geboren, um die Welt zu erobern, es trachtete niemals danach, sie zu besitzen – aber heute, da es vollendet ist, erkennen wir, dass es geschaffen wurde, um die Welt zu bedeuten.“
[Wassergeräusche mit Musik zum Abspann]
Hörbild
Text und Sprecher: Reinhard Raffalt
Produktion: Bayrischer Rundfunk
Film
Tonbearbeitung: ilonmusic München
Aufnahmeleitung: Helge Keiper
Kammera und Regie: Peter Prusik
Die Dreharbeiten wurden unterstützt von:
Civice Musici Veneziani
Curia Palriarcale
di Venezia
Museo Storico Navale
|
|
Kommentare und Anregungen sind willkommen unter: webmaster@jahreiss-og.de |
||
|
by |