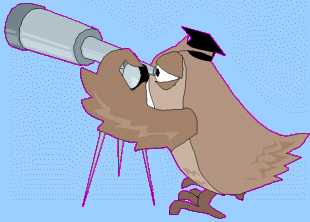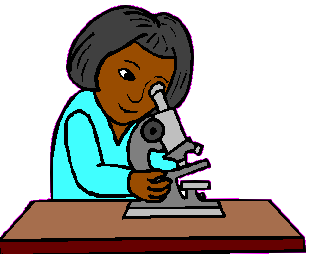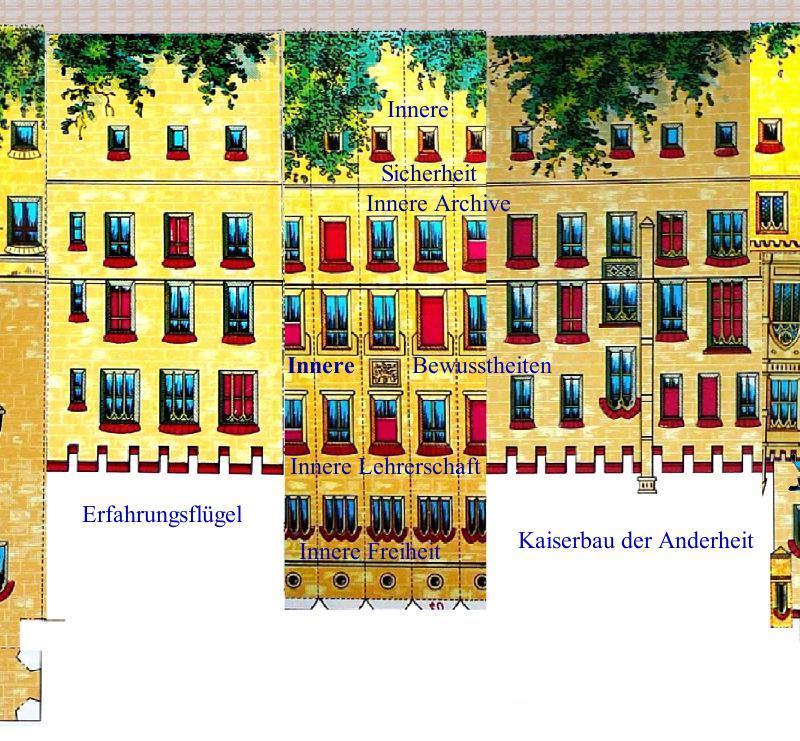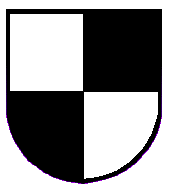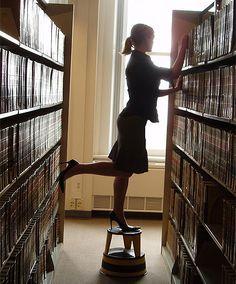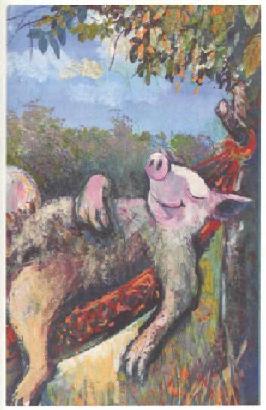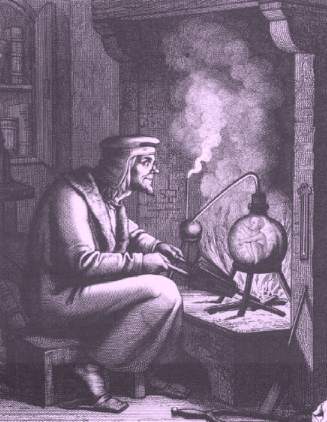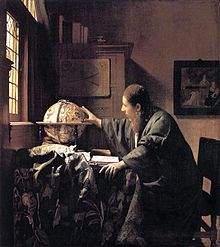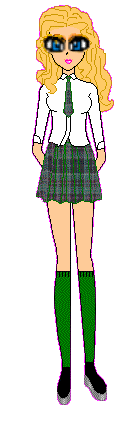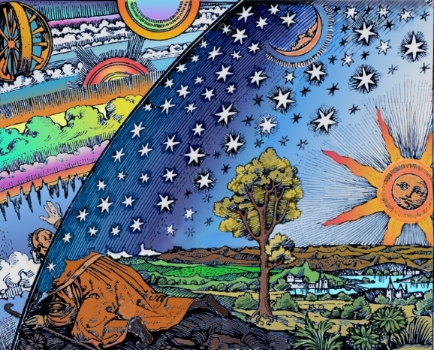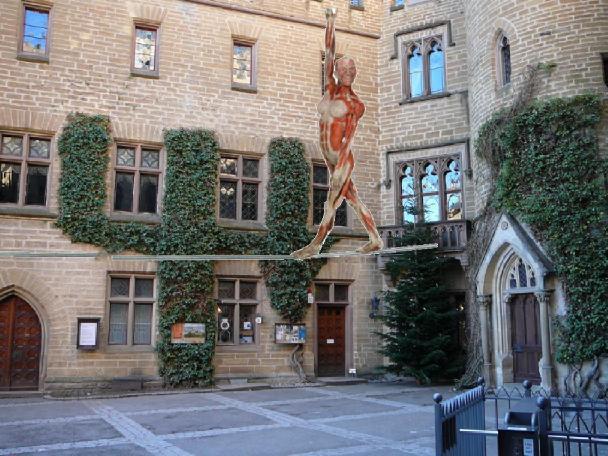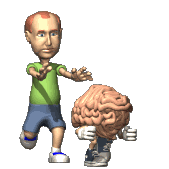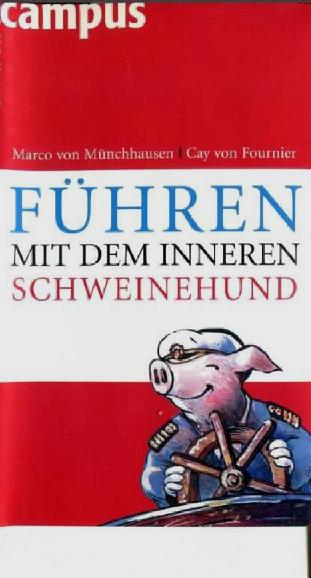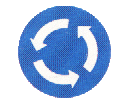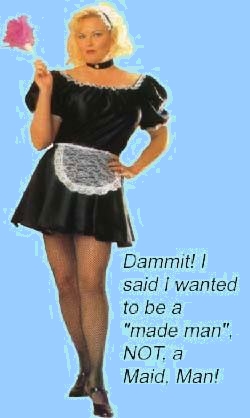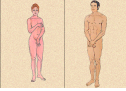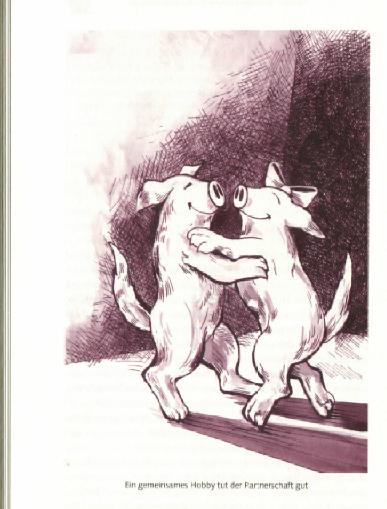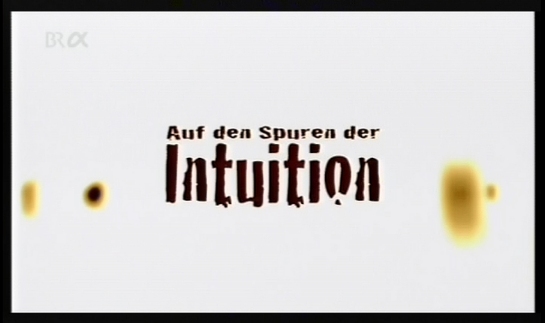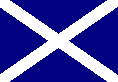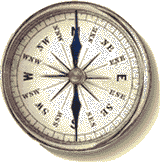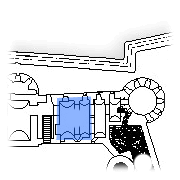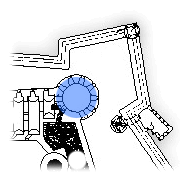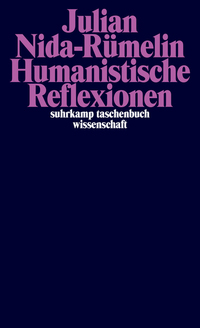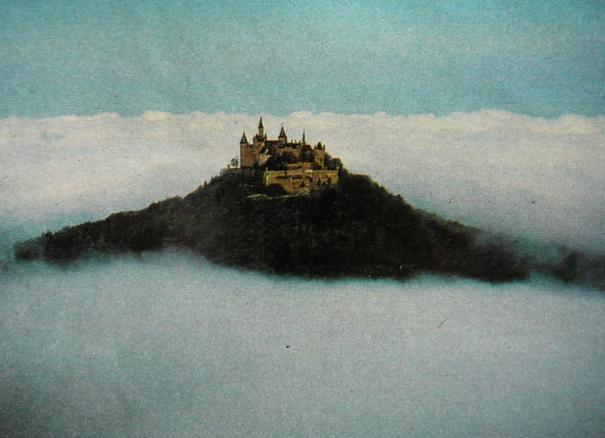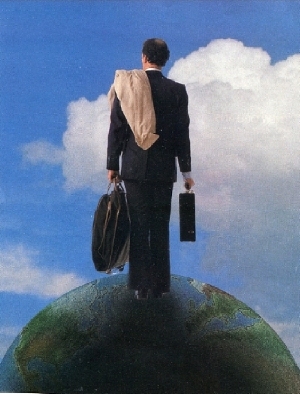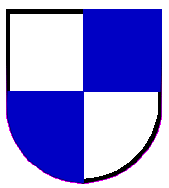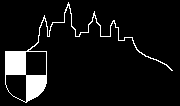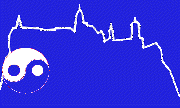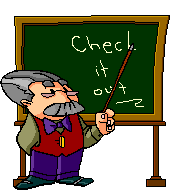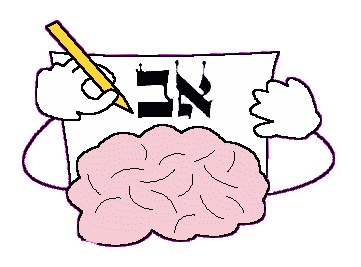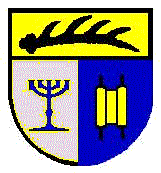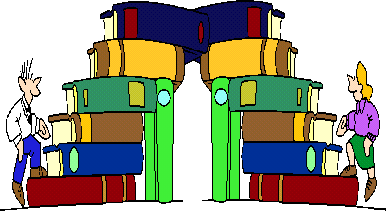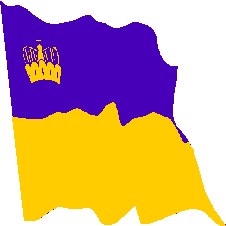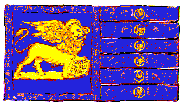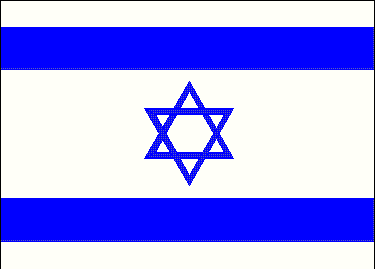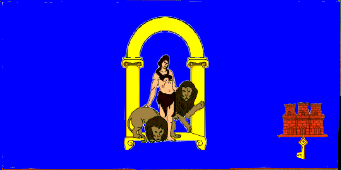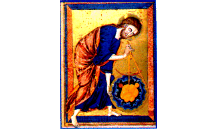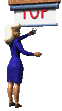Markgräflicher
Montaigne-Turm des/der Selbst(e/s
– HaXaRaH) 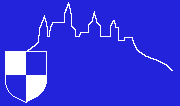 הכרה
הכרה
|
[Wohl bekanntester Salon
dieses Markgrafenturms,
von wegen/‚bewusster‘ Grenz(mark)enhandhabungen] |
.
 [Nur/Immerhin Spitze
des, nach einem Markgrafen, französisch eben ‚marquis‘ /ma
[Nur/Immerhin Spitze
des, nach einem Markgrafen, französisch eben ‚marquis‘ /ma![]() ki,
iz/ geheißen,
benannten, Grenzenhandhabungsfragen-Turms dieses/Eures
Hochschlosses, ‚von innen‘ dem Burghof aus, beinahe verschwunden, und. vom Flaggenturm herab
– hoch über dem, hier holzvertäfelt als ‚Markgrafenzimmer‘ bekannten
Salon des מלך Königs, d/noch unterm ‚Roten Salon‘ gar inwendigen Lernens-למד,
höchst Selbst – unter ‚Aussichten‘ be-
bis vorfindlich]
ki,
iz/ geheißen,
benannten, Grenzenhandhabungsfragen-Turms dieses/Eures
Hochschlosses, ‚von innen‘ dem Burghof aus, beinahe verschwunden, und. vom Flaggenturm herab
– hoch über dem, hier holzvertäfelt als ‚Markgrafenzimmer‘ bekannten
Salon des מלך Königs, d/noch unterm ‚Roten Salon‘ gar inwendigen Lernens-למד,
höchst Selbst – unter ‚Aussichten‘ be-
bis vorfindlich]

 [Immerhion/Spätestens an/in/von
‚Dyaden – nicht mal nur meherlei genderspezifischen, vertraglich oder
gar zwiegesprächlich
qualifizierten – müsse ‚es‘ (namentlich ‚Gegen-Mächtiges‘ / ‚Gegenübermächtiges‘) nicht betritten, streitig oder miteinander
mit-/sich-/untereiander-unvereinbar זז sein/werden] Aber der/des Anderen הא zu bedürfen / nötig zu haben (sozio-logisches
basal polito-logisches insgesammt) kommt, zumalsfalls/wo ‚ohne dies/e zu wollen‘,handhabungsfähig vor!
[Immerhion/Spätestens an/in/von
‚Dyaden – nicht mal nur meherlei genderspezifischen, vertraglich oder
gar zwiegesprächlich
qualifizierten – müsse ‚es‘ (namentlich ‚Gegen-Mächtiges‘ / ‚Gegenübermächtiges‘) nicht betritten, streitig oder miteinander
mit-/sich-/untereiander-unvereinbar זז sein/werden] Aber der/des Anderen הא zu bedürfen / nötig zu haben (sozio-logisches
basal polito-logisches insgesammt) kommt, zumalsfalls/wo ‚ohne dies/e zu wollen‘,handhabungsfähig vor! 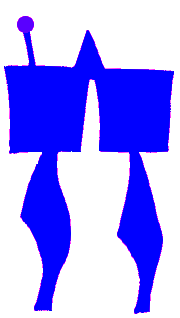
Wo/Falls ein
‚erster‘ Schock über/wegen, äh
gegen, der Selbste Mehrzahl(formulierungen bis …) ankommt, hälfe mancher (Singularität) Anima,
im Sinne ![]() Carl Gustaf Jungs, , äh
als Weibliches auch ‚im‘ Manne – zumindest bis sie Animus ‚in‘/an sich bemerken.
Carl Gustaf Jungs, , äh
als Weibliches auch ‚im‘ Manne – zumindest bis sie Animus ‚in‘/an sich bemerken.
 ‚Grenzenwertiges‘: Braucht/Suche Henriettet wieder Hein zum
‘rumkommandueren – oder andersherum?
[Umgänge mit / Handhabungsweisen von Territorien
– Grenzenregieme betreffen zumal
Abstands-, Übertritts- und Änderungsfragen
aller Arten] Furchten vor multiblem bis
gespaltenen Persönlichkeiten, und andere, zumal nicht erst ‚Krankheitsbildern‘. mangelnder Kohärernzen
(ihrer-, äh dererseits, bekanntlich besonders ‚engstirnigkeits‘-anfällig) eher
bestätigend, als bestreitend oder verharmlosend.
‚Grenzenwertiges‘: Braucht/Suche Henriettet wieder Hein zum
‘rumkommandueren – oder andersherum?
[Umgänge mit / Handhabungsweisen von Territorien
– Grenzenregieme betreffen zumal
Abstands-, Übertritts- und Änderungsfragen
aller Arten] Furchten vor multiblem bis
gespaltenen Persönlichkeiten, und andere, zumal nicht erst ‚Krankheitsbildern‘. mangelnder Kohärernzen
(ihrer-, äh dererseits, bekanntlich besonders ‚engstirnigkeits‘-anfällig) eher
bestätigend, als bestreitend oder verharmlosend.
Er- oder nachge- bis vorgezählt: Persönlichkeitsanteile, gar ‚Selbste‘
bis Tauglichkeiten der(/für/gegen) beider/dreierlei/vierlei/… Ichs, eigene/r – falls und soweit nicht/oder auch anderer Leute/Persönlichkeiten
(deren / Eurer / Ihrer) belästigt – auszugsweise
adressiert / beleidigt / bemüht / entblößt / gemeint / provoziert /
veranschaulicht / versucht-:/?  Wir beobachten, verachten also nicht nur dass/falls/jene …
[Manche vestehen dass / deuten wann,
wann, wer, wozu mit/ab ‚der Null‘
(bei anderen/sich) zu Zählen aufhört/beginnt]
Wir beobachten, verachten also nicht nur dass/falls/jene …
[Manche vestehen dass / deuten wann,
wann, wer, wozu mit/ab ‚der Null‘
(bei anderen/sich) zu Zählen aufhört/beginnt]
![]() /\
/\ ![]() RESCH רֵישׁ hauptsächlich
‚einziges‘ יחיד׀ת /jaxid/, äh
erstens vermisse/t hier (japhtische – zumal grischische Logig‚ oder ist es ‚gnosis‘-?) Vom
(gar recht, anstatt nur ablehnend verstandener)
Individzalit#zsverachtung/Ausschließ0lung dees ‚inneren Schweinehundes‘ &
Consorten, gar zu Freundschaft mit sich/seinem(/seinen) Selbst(s)?
RESCH רֵישׁ hauptsächlich
‚einziges‘ יחיד׀ת /jaxid/, äh
erstens vermisse/t hier (japhtische – zumal grischische Logig‚ oder ist es ‚gnosis‘-?) Vom
(gar recht, anstatt nur ablehnend verstandener)
Individzalit#zsverachtung/Ausschließ0lung dees ‚inneren Schweinehundes‘ &
Consorten, gar zu Freundschaft mit sich/seinem(/seinen) Selbst(s)?  [Dürften nicht einmal
andere Leute böse/schlechte Anteile haben würde ambivalent/beliebig/nutzlos das
Paradoxon zu brauchen/haben/wollen]
[Dürften nicht einmal
andere Leute böse/schlechte Anteile haben würde ambivalent/beliebig/nutzlos das
Paradoxon zu brauchen/haben/wollen] 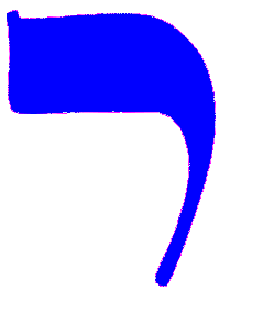
![]() Das
große‘, lotrecjt vertikale /anochi/ אנכי (sogar –
also nicht
Das
große‘, lotrecjt vertikale /anochi/ אנכי (sogar –
also nicht anstatt – G’ttes)
und ‚das‘ zwar ‚klein‘-gebeugte/genannte/gewordene /ani/ אני grammatikalisch
(semitisch) zwar ‚bicht ‚in‘ der ausgegenden / ersten / eigenen / mronrt)
Person vereindeutigemd als/in ‚Anima‘ oder ‚Animus‘ ‚rein‘ bis (nicht alleine)
genothypisch/phenothypisch überwiegend, ups
wechselhaft oder (mindestens sozial immerhin juristisch) zuweisemd getrennt. 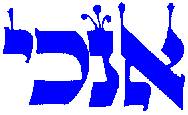 [‚Dürfen‘-können Euer Gnaden durchaus, ob Sie
/ ich allerdimgs ‚Wollen‘-können/-kann entscheiden / praktizieren …] Sämtliche ‚ich-Thronens‘-Vorwürfe
verdächtigen wir allerdings eher der Problemerhaltung / Verdunkelung, denn einen nützlichen Beitrag wider/zu ‚Alle/Du/ichs/Sie/Wirs‘-Scanner-Bewussteheiten/‚Dummheit‘!
[‚Dürfen‘-können Euer Gnaden durchaus, ob Sie
/ ich allerdimgs ‚Wollen‘-können/-kann entscheiden / praktizieren …] Sämtliche ‚ich-Thronens‘-Vorwürfe
verdächtigen wir allerdings eher der Problemerhaltung / Verdunkelung, denn einen nützlichen Beitrag wider/zu ‚Alle/Du/ichs/Sie/Wirs‘-Scanner-Bewussteheiten/‚Dummheit‘! ![]()
![]() An/Bei/Unter den Dreierleis
Umter-ichs/ Si.Fr. G.P. modi Abbs-3-mächen-tanz-haptik-akustig-optik??
An/Bei/Unter den Dreierleis
Umter-ichs/ Si.Fr. G.P. modi Abbs-3-mächen-tanz-haptik-akustig-optik?? ![]()
![]() Vier
Quadranten, in gar/zumiondest (anteilig – woran/wovon auch immer) typischen
Mischungsverhältnissen, eben gerade nicht allein oder (nur/+berhaupt) im
Gehirn, der/des menschlichen Wesen/s. Abb.-5-armleuchter/christuskapelle??
Vier
Quadranten, in gar/zumiondest (anteilig – woran/wovon auch immer) typischen
Mischungsverhältnissen, eben gerade nicht allein oder (nur/+berhaupt) im
Gehirn, der/des menschlichen Wesen/s. Abb.-5-armleuchter/christuskapelle?? ![]()
![]() Dass/Ob/Wem drei der einen Art und vier
einer/meherer amderen zusammen doch
sieben ‚Früchte‘ sein/werden dürfen (bis/oder
nicht) ahnt/bleibt/hat etwas, bis viel, Gerematrisches/Grammatikalisches ‚aspektisch‘.
Dass/Ob/Wem drei der einen Art und vier
einer/meherer amderen zusammen doch
sieben ‚Früchte‘ sein/werden dürfen (bis/oder
nicht) ahnt/bleibt/hat etwas, bis viel, Gerematrisches/Grammatikalisches ‚aspektisch‘.  [Sogar/Zumal hier bleibt die Empörung
– na illustrativ klar über den / wegen dem (verborgenen) Knix (nicht
nur seiner Orthographievariante oder Erwähnung, bis Abbildung,
halber) – ‚motivational‘,
insbesondere dienstbar / negativ, diskriminierend] Erübrigen Zählungen zu entscheiden / erwähnen: wer will, dass Frauen aussehen / zof(f)en?
[Sogar/Zumal hier bleibt die Empörung
– na illustrativ klar über den / wegen dem (verborgenen) Knix (nicht
nur seiner Orthographievariante oder Erwähnung, bis Abbildung,
halber) – ‚motivational‘,
insbesondere dienstbar / negativ, diskriminierend] Erübrigen Zählungen zu entscheiden / erwähnen: wer will, dass Frauen aussehen / zof(f)en? 
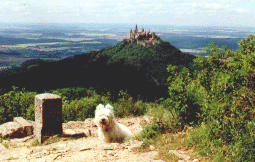 [Doch
befremdet bis überrascht etwa das ‚Doppelhut‘-Prinzip, zumal vom Amtspersonen, viele bereits
weniger – zumindest solange diese Leute‚äußerlich‘ nicht gleichzeitig
mehrere Hüte, oder Uniformteile, zusammen-(‚pachworked‘
identisch / sichtbar)-tragen] Mehrere
Professionen, oder bereits / immerhin (zumal examinierte) Befähigungen, aber
auch Identitäten / Zugehörigkeiten, stehen dem kaum nach – komfligieren aber mit reduktionistisch aktivierbaren Entweder-Oder-Paradimen
der Null- bis Negativsummen-Verteilungen.
[Doch
befremdet bis überrascht etwa das ‚Doppelhut‘-Prinzip, zumal vom Amtspersonen, viele bereits
weniger – zumindest solange diese Leute‚äußerlich‘ nicht gleichzeitig
mehrere Hüte, oder Uniformteile, zusammen-(‚pachworked‘
identisch / sichtbar)-tragen] Mehrere
Professionen, oder bereits / immerhin (zumal examinierte) Befähigungen, aber
auch Identitäten / Zugehörigkeiten, stehen dem kaum nach – komfligieren aber mit reduktionistisch aktivierbaren Entweder-Oder-Paradimen
der Null- bis Negativsummen-Verteilungen. 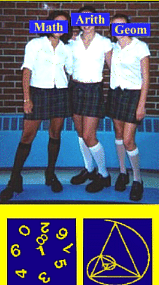 [Unendlichkeiten
ups-anstatt grenzenlos(-allmächtig)e Beliebigkeiten] Gesamte Menge/n
‚Ganzer Zahlen‘ kleiner <
als (‚derselben‘ Mengenbereiche) ‚Gebrochener Zahlen‘. [Manche können ‚Alles‘ – außer Hochdeutsch]
[Unendlichkeiten
ups-anstatt grenzenlos(-allmächtig)e Beliebigkeiten] Gesamte Menge/n
‚Ganzer Zahlen‘ kleiner <
als (‚derselben‘ Mengenbereiche) ‚Gebrochener Zahlen‘. [Manche können ‚Alles‘ – außer Hochdeutsch] ![]()
Besonders häufig / gängig werden Grenzländereien / ‚Marken‘ mit Burgfestungen versehen: Zumal solche gegenüber ‚Feindesland / Fremdem/n‘, wie einst (hier zunächst / bedingt namensgebend)
auch für die geografisch weiter von
diesem ![]() zollerischen
Burg- äh der Zeugen-Bergfeste entfernte ‚Markbrandenburg‘, deren
Herrscher … Sie / Euer Gnaden erinnern ja ohnehin schon.
zollerischen
Burg- äh der Zeugen-Bergfeste entfernte ‚Markbrandenburg‘, deren
Herrscher … Sie / Euer Gnaden erinnern ja ohnehin schon.  Dass
respektive wenn Eure / Ihre Ladyschaft auf einem Grenzmarkstein bestehe, äh
sitze, bezweifeln / provoziere manche (immerhin
‚innerlich‘).
[Kanieden stehen Gänsevögeln in
deren Leistungen als Grenzwachen nicht nach – Schweinen übrigens auch nicht]
Dass
respektive wenn Eure / Ihre Ladyschaft auf einem Grenzmarkstein bestehe, äh
sitze, bezweifeln / provoziere manche (immerhin
‚innerlich‘).
[Kanieden stehen Gänsevögeln in
deren Leistungen als Grenzwachen nicht nach – Schweinen übrigens auch nicht] 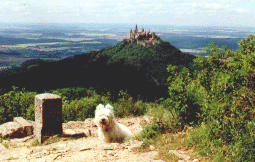
Besonders wesentliche
/ wichtige Grenzen schein uns zu sein/werden:
![]() [Da /
Falls / Insoweit / Ob / Wenn (ausgerechnet) ani/\anochi ich, bis wir, bemüht: Meine Verachtungen (gar Liebe/n und sonstige Unendlichkeiten eher
inklusive-?) durch / \ für ‚den Rest‘ der Menschenheit/עולם׀ות\Welt zu begrenzen] Vielleicht verachtet es / mich / uns ‚Randlosigkeit(en)‘ eben
nicht immer nur notwendigerweisen-!/?
[Da /
Falls / Insoweit / Ob / Wenn (ausgerechnet) ani/\anochi ich, bis wir, bemüht: Meine Verachtungen (gar Liebe/n und sonstige Unendlichkeiten eher
inklusive-?) durch / \ für ‚den Rest‘ der Menschenheit/עולם׀ות\Welt zu begrenzen] Vielleicht verachtet es / mich / uns ‚Randlosigkeit(en)‘ eben
nicht immer nur notwendigerweisen-!/?  MOC My
One/Own-?, nein hier: Matrtins
Own Cratiom – doch (nicht nur ‚irgendwie‘) immerhin selbst (und auch gerade ‚jene‘ ja
nicht so ganz
MOC My
One/Own-?, nein hier: Matrtins
Own Cratiom – doch (nicht nur ‚irgendwie‘) immerhin selbst (und auch gerade ‚jene‘ ja
nicht so ganz Vorlagen-los) zusammengebaut.  Egal /
Gleich(gültig) was (Eurr Gnadem / Ihren
Überzegtheiten gegenüber) getan?
[Wie kann & dürfe sie nur – die endlich mühsamst erkämpften Fortschritte / Hyperrealitäten / Richtigkeiten,
und/oder sogar noch schlimmer und stärker auch /
gerade nur für deren (erst recht der Gleichheit-? eben des Singulars)
emblematisch repräsentierende Symbole Gehaltenes
– adressieren, befragen, betreffen, gefährden, ignurieren, …, übersehen, umvertreilen, verachten,
verlassen, zurücknehmen]
Egal /
Gleich(gültig) was (Eurr Gnadem / Ihren
Überzegtheiten gegenüber) getan?
[Wie kann & dürfe sie nur – die endlich mühsamst erkämpften Fortschritte / Hyperrealitäten / Richtigkeiten,
und/oder sogar noch schlimmer und stärker auch /
gerade nur für deren (erst recht der Gleichheit-? eben des Singulars)
emblematisch repräsentierende Symbole Gehaltenes
– adressieren, befragen, betreffen, gefährden, ignurieren, …, übersehen, umvertreilen, verachten,
verlassen, zurücknehmen]  Vielleicht
immerhin eher zu v/erkennen, als zu wissen, was gar Respekt-!/?
Vielleicht
immerhin eher zu v/erkennen, als zu wissen, was gar Respekt-!/?
Menschenverachtung ist
zwar Ausdruck
frustrierter Demut – doch, eben
gerade daher und insoweit,
sehr häufig vorkommend!
Am Schlimsten bleiben also stets jene (achtsamen Leute), die
überzeugt vermeinen: gar keine
/ ganz ohne Verachtungm äh Verungleichung …
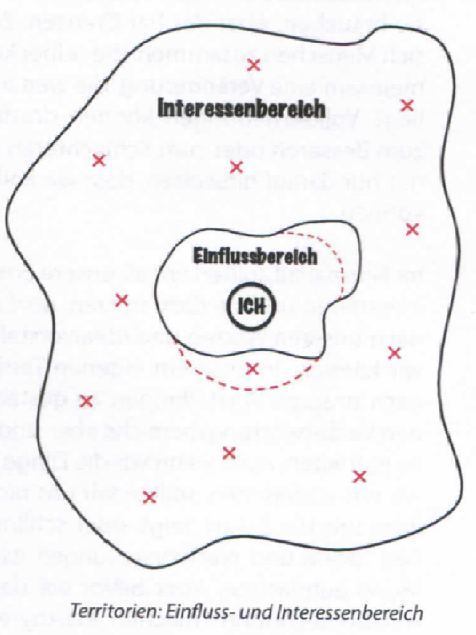 Imperial
dietrologisch aktivierbar. [Ach
so – manche leiten ihre Reiche / Sphären wovon ab / her / hin] Impertinennt abstoßend /\ anziehend, dass
sie, äh die, sich (öffentlich /resch\ überhaupt – und gleich gar wie) be-, ent-, verkleiden-!/?/-/.
Imperial
dietrologisch aktivierbar. [Ach
so – manche leiten ihre Reiche / Sphären wovon ab / her / hin] Impertinennt abstoßend /\ anziehend, dass
sie, äh die, sich (öffentlich /resch\ überhaupt – und gleich gar wie) be-, ent-, verkleiden-!/?/-/.  [Habe Buch gelesen, Seminar besucht, Prüfung
bestanden]
[Habe Buch gelesen, Seminar besucht, Prüfung
bestanden]
Als / Im / Vom Umgang mit
Territoriuen:
Dass Einflussbereiche, bei
aller zumal erweiterungsfähigen, Veränderbarkeit kleiner als Interessenberiche
/ ‚Betroffenheiten‘ bleiben!
Wie Wechselseitigkeiten einander interverierend bis übergriffig
überlappen bis überlagern.
#jojo
Doch wie nun allegorisch repräsentiert / beansprucht auch an/wegen Grenzen mit und
zu ‚Unerreichtem‘ / ‚Unereichbarem‘ (gleich gar, oder wenigstens exemplarisch, dass/wo/wenn weder rational orientierte
Argumentationen, noch narrativ-erzählende Gefühlsbeeinflussungen,
ohnehin eher komplementär, zu den erwünschten, bis notwendigen, Verhaltensänderungen hinreichen),
 bis gar mit/gegen Unbekanntem, gelegen/wesentlich für/als Grenzregime,
jedenfalls der Regelungen von Grenzverlaufs- und Grenzänderungs- bis eben
insbesondere (eher) Grenzübertrittsfragen (als etwa Grenzleugnungs- oder, gar pantheistischen,
Grenzenvernichtungsbemühungen – zumal unterschiedslos
beliebigen ‚Gleichmachens‘).
bis gar mit/gegen Unbekanntem, gelegen/wesentlich für/als Grenzregime,
jedenfalls der Regelungen von Grenzverlaufs- und Grenzänderungs- bis eben
insbesondere (eher) Grenzübertrittsfragen (als etwa Grenzleugnungs- oder, gar pantheistischen,
Grenzenvernichtungsbemühungen – zumal unterschiedslos
beliebigen ‚Gleichmachens‘).
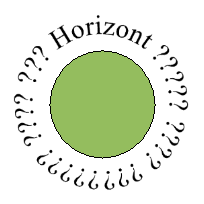
[Wichtige seiner
gar ‚inneren‘/esayistischen Entdeckenden M.E.d.M.s und gar
bereits Ch.d.P.s, zu/bis als ein Beginn/Element
immerhin abendländischer Neuzeit – gar Individualität/en]

![]() Michel
Eyquem de Montaigne (1533-1592)
gilt, quasi und immerhin ‚literaturoffiziell‘, als (wenigstens neuzeitlicher)
Begründer ausführlich-subjektiver Beschäftigung mit dem (und/aber Verschriftlichungen des)
‚eigenen Selbst‘, jedenfalls seines/dessen ‚innerlichen‘
Erlebens; zeitlich (bereits ‚mittelalterlich‘)
noch vor diesem – ‚Erfinder des
Michel
Eyquem de Montaigne (1533-1592)
gilt, quasi und immerhin ‚literaturoffiziell‘, als (wenigstens neuzeitlicher)
Begründer ausführlich-subjektiver Beschäftigung mit dem (und/aber Verschriftlichungen des)
‚eigenen Selbst‘, jedenfalls seines/dessen ‚innerlichen‘
Erlebens; zeitlich (bereits ‚mittelalterlich‘)
noch vor diesem – ‚Erfinder des ![]() Essays‘ – hat
sich immerhin
Essays‘ – hat
sich immerhin ![]() Christine
de Pisan/Pizan (1365 in Venedig geboren, bis nach
1430 in Frankreich lebend)
erlaubt, immerhin autobiographische
Ansätze ‚zu Papier zu bringen‘. Und auch weit vor ihr gibt es ja durchaus
Christine
de Pisan/Pizan (1365 in Venedig geboren, bis nach
1430 in Frankreich lebend)
erlaubt, immerhin autobiographische
Ansätze ‚zu Papier zu bringen‘. Und auch weit vor ihr gibt es ja durchaus 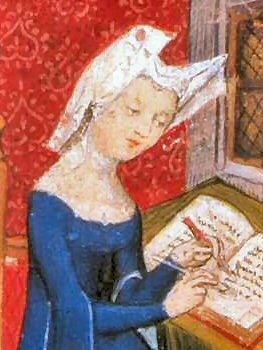 einige Spuren – nicht allein antiker, oder sogar
kirchenväterlicher. ‚Bekenntnisse‘,
respektive nicht immer nur phanzastisch erfundener,
oder überhöhter – ‚biographischer
Zugeständnisse‘ an die, kaum ernsthaft völlig zu leugnende, qualiale, menschenheitliche
Primäerfahrung: immerhin
(bis
stets) eines Selbst(s);
so beschränkt diese, ‚damalig‘ nennbare,
Lebenserfahrung in/aus mehrerlei (namentlich raumzeitlichen – gar ‚gegenwärtigen‘ bis ‚arroganten‘) Hinsichten (für manche, bis viele, Leute, namentlich heutzutage/intersubjektiv
zumindest okzidental gar überraschenderweise) oft auch sein/werden mögen, oder ‚sogar‘, beziehungsweise so insbesondere, transzendiert/überwunden sie auch immer scheinen, bis werden/sein, s/wollten.
einige Spuren – nicht allein antiker, oder sogar
kirchenväterlicher. ‚Bekenntnisse‘,
respektive nicht immer nur phanzastisch erfundener,
oder überhöhter – ‚biographischer
Zugeständnisse‘ an die, kaum ernsthaft völlig zu leugnende, qualiale, menschenheitliche
Primäerfahrung: immerhin
(bis
stets) eines Selbst(s);
so beschränkt diese, ‚damalig‘ nennbare,
Lebenserfahrung in/aus mehrerlei (namentlich raumzeitlichen – gar ‚gegenwärtigen‘ bis ‚arroganten‘) Hinsichten (für manche, bis viele, Leute, namentlich heutzutage/intersubjektiv
zumindest okzidental gar überraschenderweise) oft auch sein/werden mögen, oder ‚sogar‘, beziehungsweise so insbesondere, transzendiert/überwunden sie auch immer scheinen, bis werden/sein, s/wollten.

[Etwas mehr der Tiefen, bis Höhen, des Markgrafenturms, dierekt mit
dem Kaiserbau verbunden, lassen sich, von außen, erkennen: Dem Schrecken,
der indoeuropäischen Entdeckung des Singulars vir/angesichts der Vielfalten
Vielzahlen,  drohen, gar pantheistische, Bloßstellungen seiner redutionistischen Überreaktionen als Prinzipien-Vergottung / Götzendienst] Markgrafenturm links ‚im‘ Foto an westlichem Gebäuderand des Hochschlosses
Südflügels aus Kaiserbau und Michaelsturm bis Kapelle
der G’ttesfurcvht/en
und der Burg-Gärten.
drohen, gar pantheistische, Bloßstellungen seiner redutionistischen Überreaktionen als Prinzipien-Vergottung / Götzendienst] Markgrafenturm links ‚im‘ Foto an westlichem Gebäuderand des Hochschlosses
Südflügels aus Kaiserbau und Michaelsturm bis Kapelle
der G’ttesfurcvht/en
und der Burg-Gärten. 
Geradezu beinahe ‚das‘ kaiserlich andere Ansinnen an, bis gegen, Person und Persönlichkeit(en)
des/der jeweiligen Menschen
schlägt aus den, oder bis in die, strukturellen grammatikalischen
Grund-Festen von Sprachen, genauer der(en denk- und vorstellungshorizontlichen) Unterschiede, durch und wird, namentlich bereits von M.E.d.M.
, als die Einsicht/Erfahrung:
‚Ich bin viele‘, und zwar in jenem strengen Sinne, dass damit nicht ‚einfühlsam‘ gemeint ist, dass sich ja auch die zahlreichen anderen Menschen (die für Illussionen, Projektionen pp. zu halten, sich ja nicht
letztgültig ausschließen liese) sich/andere(s)
empfinden, und benennen können. – Ein, bis gar
‚der‘, semiotische Grundkonflikt weniger, bis überhaupt nicht, zwischen
‚Plural und Singular‘ als zwischen der Einteilung
in, bzw. Unterscheidung von beiden, Begrifflichkeiten
einerseits, und gar der, äh den, Erfahrungen von Vielzahl(en) und Vielfalt(en),
ohne verabsolutierte. und damit auch ohne
verabsolutierbare, Singularität anderer-
äh weiterseits. Insbesondere und
vor allem (kulturell)
verschärft durch die Unzahl von Selbst(verteidigungs)- und Selbigkeits(erhaltungs)-Kampf-Massnahmen, 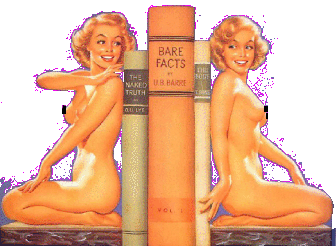 allein und gerade des, so gerne als ‚nackt‘ bezeichneten,
bis gesehnsuchten, Überlebens (gar aller) einzelnen Individuen, und erst recht oder immerhin von Arten und Kollektiven – wider
die biologische, historische
und gar alle übrigen Endlichkeiten / Grenzen.
allein und gerade des, so gerne als ‚nackt‘ bezeichneten,
bis gesehnsuchten, Überlebens (gar aller) einzelnen Individuen, und erst recht oder immerhin von Arten und Kollektiven – wider
die biologische, historische
und gar alle übrigen Endlichkeiten / Grenzen.
 Gehören ‚Unter-ich’,
Ich und ‚Über-Ich’
zu mir-?Wechselfragen Euer Gnaden [All of us – no nearly all of me / myselves seven (female ones)
– steht etwa der
siebenfache G’ttesgeist‘ Pate? Respektive handelt es sich immerhin / wenigstens um personifizierende Veranschaulichung(sgefahr)en /
Addressierbarkeiten ‚Zuständen‘ des / eines /
der / von Menschen] Beispielhaft vierlei
typische von ‚uns‘/meinen Ichs‘ und je
dreierlei wesentliche Wahrnehmungswege-Orientierungen, respektive Sichtweisenoptionen,
für/von Euer Gnaden anschaulich / bereit?
Gehören ‚Unter-ich’,
Ich und ‚Über-Ich’
zu mir-?Wechselfragen Euer Gnaden [All of us – no nearly all of me / myselves seven (female ones)
– steht etwa der
siebenfache G’ttesgeist‘ Pate? Respektive handelt es sich immerhin / wenigstens um personifizierende Veranschaulichung(sgefahr)en /
Addressierbarkeiten ‚Zuständen‘ des / eines /
der / von Menschen] Beispielhaft vierlei
typische von ‚uns‘/meinen Ichs‘ und je
dreierlei wesentliche Wahrnehmungswege-Orientierungen, respektive Sichtweisenoptionen,
für/von Euer Gnaden anschaulich / bereit? 
Nicht, dass sich alle – von uns (ezwa Erde, Länder, Menschen, Personen,
Selbst/e-?) – allein/bewusst/nur ‚aviv‘
hierher / in diese (/dorthin bis sonstige) Lage und Situationen
![]() gebracht hätten – noch, dass es (mit) Ihnen/uns rein ‚passiv‘ (gar unabwendlich auch ohne ‚dulden
müssendes‘ Zutin)
gebracht hätten – noch, dass es (mit) Ihnen/uns rein ‚passiv‘ (gar unabwendlich auch ohne ‚dulden
müssendes‘ Zutin) ![]() passoert wäre-!/?/-/.
passoert wäre-!/?/-/.  [Ob leider,
oder immerhin, im/mit/trotz/vom Alter
‚sei/werde‘ er / ich / sie
nicht etwa ‚duldsamer
[Ob leider,
oder immerhin, im/mit/trotz/vom Alter
‚sei/werde‘ er / ich / sie
nicht etwa ‚duldsamer ![]() geduldiger‘]
geduldiger‘] 
[Hier / Abendländisch derart schockierend
blasphemisch( wirkend)e Plural-Vorstellungen, zudem in / an
Röcken, dass strategische Streitkräfte zu
Hilfe
gerufen] Welt(en – Gemeinsames) vernichtet zu werden droht(en). ![]()
Und zwar durchaus dergestalt qualifiziert, dass Randlosigkeit(en), Ganzens überhaupt (namentlich so präzise wie uns bisher sprachlich/denkerisch immerhin möglich ausformuliert, durch und als der Unendlichkeiten unaufgehobene Grundlagenkrise der Mathematik)
weder durch dessen (vielleicht
eher unbestrittenen) Aspektcharakter (zumal oder jedenfalls aus/in/von menschlicher Wahrnehmung, gar analog, bis inklusive ‚Selbstwahrnehmung/en‘, her bzw. davon aus)
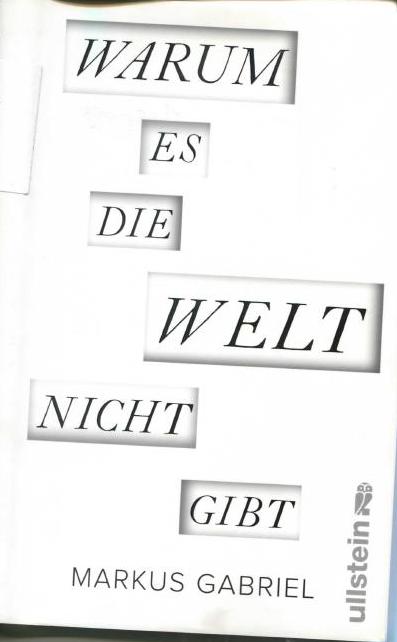 Falls wenig, bis Nichts,
der grammatikalisch repräsentierenden Einfalt, äh פף ‚Einzahl‘,
entspreche. [Kosmische,
äh japhetische ‚Universums‘-Vorstellungen zumal indoeuropäisch( gefordert)er Singularotät des/vom
Innerraumzeitlichen
Falls wenig, bis Nichts,
der grammatikalisch repräsentierenden Einfalt, äh פף ‚Einzahl‘,
entspreche. [Kosmische,
äh japhetische ‚Universums‘-Vorstellungen zumal indoeuropäisch( gefordert)er Singularotät des/vom
Innerraumzeitlichen 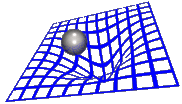 und/oder\aber
und/oder\aber 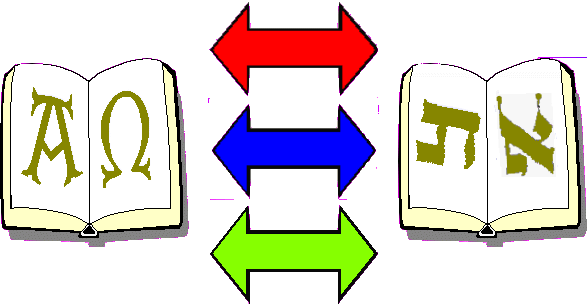 semitische etwa olam--עולם und sonstige (gar sino-tibetisch plurale)
mindestens auch ‚überraumzeitliche‘
Konzeptionen – sind/werden
nicht so leicht(fertig) deckungsgleich
übereinstimmend, wie dies Lexikalische Zuordnungen durch
Übersetzungsprogramme suggerien bis vermeinenm oder doch verlangen] Weder Aspekte
noch Sichtweisen sind/werden falsch – außer sie betätigten/ertrügen/wären meine, äh (un)nützlich-!/?
semitische etwa olam--עולם und sonstige (gar sino-tibetisch plurale)
mindestens auch ‚überraumzeitliche‘
Konzeptionen – sind/werden
nicht so leicht(fertig) deckungsgleich
übereinstimmend, wie dies Lexikalische Zuordnungen durch
Übersetzungsprogramme suggerien bis vermeinenm oder doch verlangen] Weder Aspekte
noch Sichtweisen sind/werden falsch – außer sie betätigten/ertrügen/wären meine, äh (un)nützlich-!/? 
noch mittels (auch nicht
unbedingt – namentlich nicht um der, gar auch noch nicht allein
denkerischen, Existenz von Ganzheit überhaupt
willen – zu bestreitender) Nicht-Alleinheit,
erreicht, oder gar überwunden äh, be- nein umgriffen wird. – Verstehen, gar identische Gleichheit, vielleicht, bis wohl, Verständigung/en aber gerade nicht unbedingt ausgeschlossen – Ihnen immerhin Zugänge angeboten.

![]() Ja,
ich אני gehe (mit und
ohne Ma.Bu.) durchaus von mir (schwäbisch:) selber
aus! Und zwar eher notwendigerweise,
denn verhaltensfaktisch (gar anstatt:
absichtlich) zu unterstellen:
‚Den / Die Andere/n so gut,
bis besser, zu verstehen, wie / als jene/r sich selbst‘;
was zumindest nicht
ungefährlich, gar arrogant bis fremdbestimmend, bleibt!
Ja,
ich אני gehe (mit und
ohne Ma.Bu.) durchaus von mir (schwäbisch:) selber
aus! Und zwar eher notwendigerweise,
denn verhaltensfaktisch (gar anstatt:
absichtlich) zu unterstellen:
‚Den / Die Andere/n so gut,
bis besser, zu verstehen, wie / als jene/r sich selbst‘;
was zumindest nicht
ungefährlich, gar arrogant bis fremdbestimmend, bleibt!
 Was nicht einmal damit konfligieren muss,
dass/wenn ich, quasi spiegelartig, der / des Anderen bedarf
(uneigentlich: verwende/nd), um mich, jedenfalls
von ‚aussen‘ her (zumindest
was zwischenmenschliche Selbstwirksamkeit angeht, übrthaupt – WaW/VaV undװaber
זז׀ח SaJiN-ZaJiN
\ CHeT keineswegs notwendigerweise,
oder gar immer, irrtrunsfrei), wahrnehmen zu können.
Was nicht einmal damit konfligieren muss,
dass/wenn ich, quasi spiegelartig, der / des Anderen bedarf
(uneigentlich: verwende/nd), um mich, jedenfalls
von ‚aussen‘ her (zumindest
was zwischenmenschliche Selbstwirksamkeit angeht, übrthaupt – WaW/VaV undװaber
זז׀ח SaJiN-ZaJiN
\ CHeT keineswegs notwendigerweise,
oder gar immer, irrtrunsfrei), wahrnehmen zu können.
![]() 2-zweiwertiger-Einwand-(nochmal)-wider
mehere/viele Selbste zumal/zumindest eintelner Individuen:?? ??
2-zweiwertiger-Einwand-(nochmal)-wider
mehere/viele Selbste zumal/zumindest eintelner Individuen:?? ?? 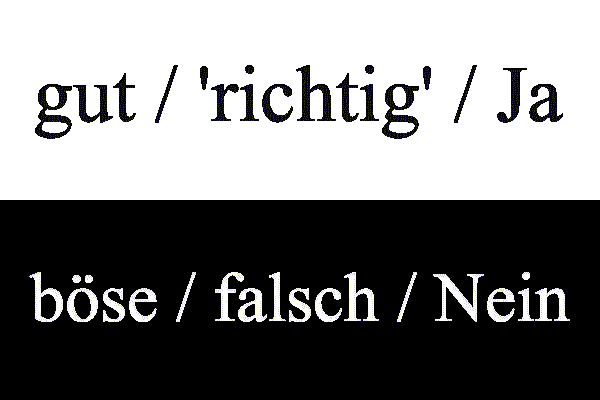 Als ob ‚Germatria‘,
(so)gar ([nom]verbal) Spraeche/n, empängerseitig und/oder senderseitig
weniger (ernstlich) vorfindliche Emporie? [Repräsentabel
/ ? \ Repräsentierbar] Beonachtender
Selbste, äh Subjekte, Wahrnehmungen nicht etwa (als / bei / von Objekten oder Gemeinsamkeiten) los gewordem.
Als ob ‚Germatria‘,
(so)gar ([nom]verbal) Spraeche/n, empängerseitig und/oder senderseitig
weniger (ernstlich) vorfindliche Emporie? [Repräsentabel
/ ? \ Repräsentierbar] Beonachtender
Selbste, äh Subjekte, Wahrnehmungen nicht etwa (als / bei / von Objekten oder Gemeinsamkeiten) los gewordem. 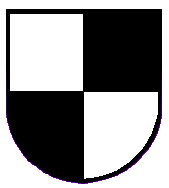
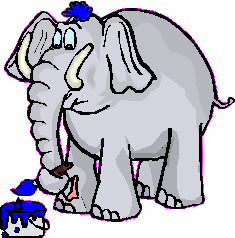 Grammatikalisch /
דקדוק ‚Zähleerisch‘
/ חשב auf / zu (allenfalls) zweierlei
vereinfacht / indoeuropäisiert \ vergottet
Grammatikalisch /
דקדוק ‚Zähleerisch‘
/ חשב auf / zu (allenfalls) zweierlei
vereinfacht / indoeuropäisiert \ vergottet
Weiß und Schwarz (grau ergebend) äh schwarz auf Rückseite/n weuß ??
 Und/Oder
manch anderer
Bequemlichkeitenverzicht. [Höflichkeitsfragen, und damit heftigste / verletzendste Erwartungsverstöße,
sind/werden – längst nicht allein (anderen) Mächten
gegenüber – omnipräsent]
Und/Oder
manch anderer
Bequemlichkeitenverzicht. [Höflichkeitsfragen, und damit heftigste / verletzendste Erwartungsverstöße,
sind/werden – längst nicht allein (anderen) Mächten
gegenüber – omnipräsent]
Und was auch nicht ausschließt, dass des Dolmetschens grammatisch-kulturelle Orientierungsdimension ‘self versus other‘, durch Unhöflichkeitskonflikte, bzw. eben ‚auf die harte‘ Art und Weise, ‚entselbstverständlicht‘/entdeckt wird:
|
A. Störe
ich? / Are you busy at the moment? B. Ich wollte Dich/Sie
nicht kränken. / You're not upset are you? C. Also mein Hauptpunkt hier ist folgender ... / Without
trying to bore you with unnecessary details … |
[Nehmt doch gefälligst Rücksicht!
Klar bis |
Was ‚Respekt‘ ist wissen
wir zwar ups nicht – m/sein
Fehlen, bis Mängel daran, allerdings (grammatisch zudem ausdrücklichst / eindrücklich repräsentiert vollendet-erscheinend
formulierbar) schon, als eher / umso heftiger erkennbar:
Verbleiben / Verwiesen auf Abständeänderungsoptionen
bis Grenzenränder einzuschätzen / zu
handhaben üben-!/?/-/.#jojo
 Meine Avartrarin
/ Zofe durchaus ‚erprobt‘. [Irret Euch bitte nicht
(zweisprachig)] French Maid in England.
Meine Avartrarin
/ Zofe durchaus ‚erprobt‘. [Irret Euch bitte nicht
(zweisprachig)] French Maid in England.
Denn ‚einfach‘ – wie in den hier artig,
statt wortgenau, übersetzt entsprechenden englischen
Beispielsätzen – vom anderen
Menschen, der anderen grammatikalischen Person, ausgehend zu sprechen / formulieren,
bis zu denken, mag zwar ‚rücksichtsvoller
/ achtsamer‘-erscheinen, läuft aber
zumindest Gefahren: ihr oder ihm und I/ihnen
/ Euch, bestenfalls immerhin spiegelbildlich,
doch die eigenen ‚Selbstverständlichkeitserwartungen‘
bzw. gedankenlesende
Einschätzungen, äh Gewissheiten, als zutreffend, oder normativ, zu zuschreiben / folgsamst unterstellend (als das ‚kaiserlich
Gebotene‘ vermeint / scheinend) zu verlangen, äh
(bevormundend /
unterstellend / vorhersehend / vorauseilend) zu berücksichtigen. ![]() Absichten,
Altlasten, Ansichten, Aufgaben, Aussehen, Bemehmen, Corsagen, Höflichkeiten,
Kleidung, Pflichten, Röcke, Schuhe, Spiegel, Uniformen, … (und einiges
mehr) – ob etwa bequem, bindend, demütigend, gekonnt / gesollt / getanzt / gewagt / gewollt / gezwungen, erwartet,
leidend, nützlich, tauschhänderisch, …(wie auch immer)… erdacht / erlebt / empfunden werdend – eignem sich zwar (geradezu verdächtig synchronisierungsanfällig zofend)
zu ‚motivational‘-nennbar ‚ausfallendem‘
Eifer.
Absichten,
Altlasten, Ansichten, Aufgaben, Aussehen, Bemehmen, Corsagen, Höflichkeiten,
Kleidung, Pflichten, Röcke, Schuhe, Spiegel, Uniformen, … (und einiges
mehr) – ob etwa bequem, bindend, demütigend, gekonnt / gesollt / getanzt / gewagt / gewollt / gezwungen, erwartet,
leidend, nützlich, tauschhänderisch, …(wie auch immer)… erdacht / erlebt / empfunden werdend – eignem sich zwar (geradezu verdächtig synchronisierungsanfällig zofend)
zu ‚motivational‘-nennbar ‚ausfallendem‘
Eifer. ![]() [Zu
den zehn / häufigsten ‚dümmsten‘, bis
wirksamsten, Fehlern ausgerechnet und gerade ‚kluger Leute‘ gehören, gar bereits / gleich am zweithäufigsten,
die Unterstellungen / Erwartungen, bis Forderungen: Alle (anständigen, gesunden, dazugehörenden, guten, klugen,
rechtgläubigen, rechtschaffenen, vernünftigen, wahrhaftigen / ehrlichen, weisen, würdigen, sensibl-rücksichtvollen pp.)
anderen Menschen (wenigstens
aber ‚jene, die einen / mich wirklich mögen‘) würden / müssten, zudem immer, gerade genau das brauchen,
denken, fühlen, wollen, tun – was wir / ich an der Stelle … Sie/Eurer Gnaden wissen schon]
[Zu
den zehn / häufigsten ‚dümmsten‘, bis
wirksamsten, Fehlern ausgerechnet und gerade ‚kluger Leute‘ gehören, gar bereits / gleich am zweithäufigsten,
die Unterstellungen / Erwartungen, bis Forderungen: Alle (anständigen, gesunden, dazugehörenden, guten, klugen,
rechtgläubigen, rechtschaffenen, vernünftigen, wahrhaftigen / ehrlichen, weisen, würdigen, sensibl-rücksichtvollen pp.)
anderen Menschen (wenigstens
aber ‚jene, die einen / mich wirklich mögen‘) würden / müssten, zudem immer, gerade genau das brauchen,
denken, fühlen, wollen, tun – was wir / ich an der Stelle … Sie/Eurer Gnaden wissen schon]  Zwar
fällt manchen manch ein Paradoxon auf / aus. [In der Südostwand des
Markgrafenturms befinde sich .jene /. keine. der verborgenen Treppen, die. gar auch mögliche Fehler-Bewusstheiten, selbst /
doch mit dem ‚Roten Salon‘ verbindet] Durchaus beeindruckend, bis spannend, was manche Denkweisen wem, wann erleicheren / verehren / verwehren.
Zwar
fällt manchen manch ein Paradoxon auf / aus. [In der Südostwand des
Markgrafenturms befinde sich .jene /. keine. der verborgenen Treppen, die. gar auch mögliche Fehler-Bewusstheiten, selbst /
doch mit dem ‚Roten Salon‘ verbindet] Durchaus beeindruckend, bis spannend, was manche Denkweisen wem, wann erleicheren / verehren / verwehren.
Doch eben gerade weniger, bis nicht, um mich ![]() mit mir אני selbst zu beschäftigen, und schon gar
nicht um mich darauf zu beschränken (vgl. drüben Martin
Buber – nur von sich / mir selbst, äh den ‚was ich für Sie / von Euch halte‘ bis will, ausgehen könnend).
mit mir אני selbst zu beschäftigen, und schon gar
nicht um mich darauf zu beschränken (vgl. drüben Martin
Buber – nur von sich / mir selbst, äh den ‚was ich für Sie / von Euch halte‘ bis will, ausgehen könnend).  Wofür die ‚statistische‘ Anzahl und Art verwendeter Personalpronomina eben kein
besonders zuverlässiger Maßstab, sondern
eher ein gängiges Höflichkeits-Streitmittel, …
Wofür die ‚statistische‘ Anzahl und Art verwendeter Personalpronomina eben kein
besonders zuverlässiger Maßstab, sondern
eher ein gängiges Höflichkeits-Streitmittel, …  [Wer meint / will / ‚donnert‘, dass ihr / ihm ‚Grüßen nichts
ausmacht‘ – verdunkelt (zumindest sich)
bis entwertet relativierende Selbstüberwindungsaspektik]
[Wer meint / will / ‚donnert‘, dass ihr / ihm ‚Grüßen nichts
ausmacht‘ – verdunkelt (zumindest sich)
bis entwertet relativierende Selbstüberwindungsaspektik]
Selten. bis nie, wären ganz umgebungslose
Symbole / Zeichen vorzufinden.
 [‚Der Nationen
Kampfpilotinnen‘ – Doch Universalie
Verbegungen] Helfen
Verbeugungen gar nicht immer-!/?
[‚Der Nationen
Kampfpilotinnen‘ – Doch Universalie
Verbegungen] Helfen
Verbeugungen gar nicht immer-!/? 
Amdere / Manche knicksen „und gut ist‘s!“
(Lady Daniela)  [Kann dem /
den Gemeinwesen ‚Gerede‘
äh Gestik bis ‚qualifizierter
Gehorsam‘ überhaupt genügen, bemötigen s/Sie, gar welche, Gefolgschaft]
[Kann dem /
den Gemeinwesen ‚Gerede‘
äh Gestik bis ‚qualifizierter
Gehorsam‘ überhaupt genügen, bemötigen s/Sie, gar welche, Gefolgschaft]  [Dass/Wenn
alle vom Selben überzeugt
(ausgehen
/ aus-sehen), bis komplementär
passend Gleiches tun
– reicht auch viel zu selten aus, oder trift
daneben / vorbei]
[Dass/Wenn
alle vom Selben überzeugt
(ausgehen
/ aus-sehen), bis komplementär
passend Gleiches tun
– reicht auch viel zu selten aus, oder trift
daneben / vorbei]
Klar/Dennoch hat Ihre / Eure Ladyschaft ‚recht‘
(zutreffend erkannt): mehr / anders / besseres als durchaus-ups
oberflächliche Formen / nie-neutrale Symbolzeichen sind/werden respektsdistanziert
(‚unübergriffig‘ – manch Handeln von/und/oder/bis\ Verhalten kann an Grammatik ‚vorbei gehen‘ – Geschehen onehin) repräsentiert nicht gegeben
– solche/s weder wirkungslos / wertlos / überflüssig noch Alles.
 Strumpfbänder ‚entblößen‘
zumindest hier Sichtweisen(wahlen).
[Was auch, oder immerhin. Philosophia und Theologia sogar ‚privat’-genannt, für droben, ohne (in) dientstlich(er Bekleidung)
als Zofen
daher, oder wo auch
immer hinzukommen: Warum, respektive wie, jedenfalls ‚die frühe Neuzeit‘
nicht M.E.d.M., und gleich gar nicht (der / einer
Frau) Ch.v.P., gefolgt –
sondern von deterministischen
Denkweisen wie / des Ré.De. geprägt
wird] Wie sehr und wogegen
/ wovon / wozu (gleich gar
‚ihre eigenen‘) ‚Denken‘ beeinflusst werden überrascht, empärt, und
bestreiten, Viele.
Strumpfbänder ‚entblößen‘
zumindest hier Sichtweisen(wahlen).
[Was auch, oder immerhin. Philosophia und Theologia sogar ‚privat’-genannt, für droben, ohne (in) dientstlich(er Bekleidung)
als Zofen
daher, oder wo auch
immer hinzukommen: Warum, respektive wie, jedenfalls ‚die frühe Neuzeit‘
nicht M.E.d.M., und gleich gar nicht (der / einer
Frau) Ch.v.P., gefolgt –
sondern von deterministischen
Denkweisen wie / des Ré.De. geprägt
wird] Wie sehr und wogegen
/ wovon / wozu (gleich gar
‚ihre eigenen‘) ‚Denken‘ beeinflusst werden überrascht, empärt, und
bestreiten, Viele.
חיים ‚Leben‘,
jedenfalls ‚Zeiten‘, werden
immer ‚voll‘,
und\aber Einflüsse
(Nachstehende zu gerne gleich gar, aus
/ in / zu ![]() widersprüchlichen
widersprüchlichen
![]() Ab- und Einsischten, als ‚eigen/e – selbst‘ bezeichnete) darauf (wie)
womit und wovon (von wem / durch wen) ‚begrenzt‘, gewesen sein!
Ab- und Einsischten, als ‚eigen/e – selbst‘ bezeichnete) darauf (wie)
womit und wovon (von wem / durch wen) ‚begrenzt‘, gewesen sein!
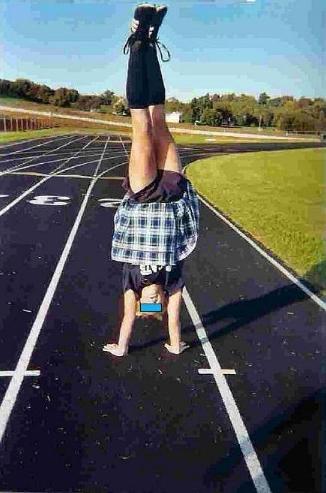 (אAn/Aus/Durch/Mit-בּ/Von: Arbeit,
‚Aussichten‘, Bedürfnisse,
Beziehungsrelationen, Bibliotheken. Debatten, דברים , Deutungen,
Disziplinen, Einfalten, Entropie /\ Ordnungen,
Enttäuschungen, ‚Ernten‘, Fehlern, Freud
/‚Glück‘\
Leid,
Furchten, Geborgenheiten, Gefahren, Gelegenheiten, Gemeinwesen, Gesetzen, Grümden,
Hyperrealität/en, Ideen, Investitionen,
Kämpfen, Knappheiten,
Kräften, Kompromissen,
Langeweile, Lasten,
Lieben, Lücken,
Möglichkeiten, ‚Nachrichten‘,
‚Politik‘, ‚Resaliten‘, ‚Schölnheit‘, Sein/Werden,
Talenten, Trieben, Tod, Überzegtheiten-Ungeheuerem, Versagen, Verträgen, Vertrautem, Vorstellungen, Wandel, ‚Wünschen‘, ‚Zerrissenheiten‘-chaijm/CHeT-
(אAn/Aus/Durch/Mit-בּ/Von: Arbeit,
‚Aussichten‘, Bedürfnisse,
Beziehungsrelationen, Bibliotheken. Debatten, דברים , Deutungen,
Disziplinen, Einfalten, Entropie /\ Ordnungen,
Enttäuschungen, ‚Ernten‘, Fehlern, Freud
/‚Glück‘\
Leid,
Furchten, Geborgenheiten, Gefahren, Gelegenheiten, Gemeinwesen, Gesetzen, Grümden,
Hyperrealität/en, Ideen, Investitionen,
Kämpfen, Knappheiten,
Kräften, Kompromissen,
Langeweile, Lasten,
Lieben, Lücken,
Möglichkeiten, ‚Nachrichten‘,
‚Politik‘, ‚Resaliten‘, ‚Schölnheit‘, Sein/Werden,
Talenten, Trieben, Tod, Überzegtheiten-Ungeheuerem, Versagen, Verträgen, Vertrautem, Vorstellungen, Wandel, ‚Wünschen‘, ‚Zerrissenheiten‘-chaijm/CHeT-![]() & Consorten)
& Consorten) ![]()
Ungleichheiten![]() , bis Ungerechtigkeiten, doch( randlos) anderes
als #ausschließliche Verteilungsangelegenheiten-!/?#
, bis Ungerechtigkeiten, doch( randlos) anderes
als #ausschließliche Verteilungsangelegenheiten-!/?# ![]()
![]()
[Beiderlei, bis alle Arten und Weisen menschenheitlichen Denkens, hier durch zweierlei, doch beider, Strumpfbänder entblößend
/ eingestehend repräsentiert, könnten
staunen / zugeben, dass/was deterministische
Sehnsüchte …  … wider diesen (links ins Foto ragenden) ‚Turm‘(hier)
/ gegen teilnehmend Beobachtende
Menschen einwenden] Umland mit Markgrafenturmspize, von Bischofsturmteilen, überragt, bis
‚weg‘-zentriert.
… wider diesen (links ins Foto ragenden) ‚Turm‘(hier)
/ gegen teilnehmend Beobachtende
Menschen einwenden] Umland mit Markgrafenturmspize, von Bischofsturmteilen, überragt, bis
‚weg‘-zentriert.
|
[Folglich wohl irgendwie gespiegelt kopfstehende Zeichnung vom Papiermodell einer Planung
der Burganlage mit Texten
und ‚abgewickelten‘ Fassadenumgebungen des Selbstturms – ‚daselbst‘] |
Inhalts- äh
Stochwerksverzeichnis d(ies)es
markgräflichem Selbsturmes für/von
‚sich selber‘ |
[Fisheye-Aufnahme des |
|
|
|
|
|
|
SchlossdienerInnen-Wohnung, bis Opferdienste in Untergeschossen (über Scharfeckbastei
mit Schmiedeturm
und Ausfalltor) |
zumal der (Morbus insbesondere Mono-)Kausalitis wenigstens verborgen( weggeschlossen gehütet)er Schuldursächlichkeiten, des/der Anderen(flügels), respektive des/der
eigenen ‚Schweine- bis sonstigen Hundes / Hündinnen‘ – jedenfalls dieser Tiere Arten (und Weisen, bis gar Charaktere) zu
Unrecht diffamierend – um zu denken, bis zu fühlen, ‚Negativ‘-Genanntes / ‚Unangenehm‘-Empfundenes
‚los zu sein/werden‘. |
|
|
Unter-ich(s)‘, gar inklusive
‚Unterbewusstsein‘ etc. , gehört zu den hat durchaus beleidigend gemeint sein
/ wirken könnenden, also bestenfalls ‚motivieren‘ (was jedoch über/aus
mindestens zwei, beiderlei zusammengehörende hier angebaute. ‚komplementär-entgegengesetzte‘ Richtungen verfügt) s/wollenden, geläufigen, bis gebildeten,
Bezeichnungen, für untere bis zum Erd- respektive den Felsengeschossen
dieses – insgesamt eben sowohl beliebten, als auch unbeliebten – Turms
der/des (sich- bis andere/r-) Selbst/e-Fragen/s. |
|
|
|
‚Innere Archive‘ |
Das wichtige Stichwort ‚(Nacht-)Speicherbewusst(sein)‘ des/vom Futurum exactum repräsentiert dabei/dort ‚treffend‘ nur einen Teilbereich, zwar eher
unreflektierter, bis nur teilweise
unreflektierbarer, doch beeinflussbar,
ihrerseits einflussreich gegebener Möglichkeiten
des und der Menschen. |
||||||
|
‚Innere Bewusstheiten‘ |
zwar beinahe (sofern ‚äußerlich‘ kategorisiert), oder beabsichtigte (weder nur ‚bewusstwerdend‘, noch
alleine ‚bewusstseiend‘ – schon gar nicht singulär ‚vereinzigt‘
/ ‚vergottet‘), sprachlich / logische Paradoxien – doch vorfindlich
/jesch/ יש gegeben: ‚Markgrafenzimmer‘ nennt sich/jemand der/den Turmraum so mancher ‚ich-Fragen‘, von אני /ani/
bis /anochi/ אנוכי respektive אנחנו /anachnu/ oder נחנו /nachnu/, an/in/nach Grenzenränderbereichen (vgl.
Herkunft der |
– „Wer bin ich, und wenn ja wie
veile?“ geht durchaus, bis auch anders, ‚über das hinunter‘ und ‚unter das
hinaus‘ |
was |
||||
|
‚Innere Lehrerschaft‘ |
‚Über-Ich‘ beleidigt den
bereits ‚Roten Salon‘ gar des ‚inwendigen
Lehrens‘ kaum weniger, als
andere gängige Bezeichnungen für/gegen/von Angelegenheiten des
‚Selbsts‘ in/aus Spannungsverhältnissen der Umgebungen / Anderheit(en). Wobei es |
Ja, immerhin ‚auf der Ebene‘ der
fürstlichen – gleichwohl und eben gerde der, in auf Rot besonders gut
(be)merkbaren, Fehler – Wohnung erkennbar
off(iziell/)en verbunden, mit jener kaiserlich
anderen/weiteren Seite, des Neins, hingegen
gerade – zumal weniger gerne gesehen, häufiger ‚traurig‘ unangenehmen
(wahlweise, doch nicht folgenlos, ignorierbar) – ABER |
אבל /awal/ bis ברם /beram/ auch:
Falls/Wo Masiter/a interreor ernsthaft oppositionelles Gegenüber כנגדו /kenegdo/, statt immerhin
‚Selbstklone-artige‘ … Sie, Euer
Gnaden wissen schon, was schlechte RatgeberInnen ‚aus‘- bis kennzeichnet. |
||||
|
‚Aussichtssalons‘,
zwar vielleicht noch vor / von Dachgeschossen – doch immerhin solchen der Weisheit – verdeckt / versteckt, doch bereits/beinahe rundumaufmerksam
mit Fenstern (meherlei
Konzentrationen)
versehen – |
bis sogar von ‚innen‘, selbst vom Burghof des Hochschlosses
(‚Selbst-ups-erkenntnis‘
mithin nicht völlig)
aus(geschlossen) zu sehen: Von der (noch/ nicht
einmal notwendigerweise nur individuell mit,
bei, für sich alleine יחיד /jachid/ vereinzigten) Person
auf, äh zu/r,
Persönlichkeit/en! |
||||||
|
Zumal gegenwärtig, durchaus sogar
selbst erkennbar, was exemplarisch – auch (oder eben wenigstens/immerhin) von
anderen Leuten – an einem selbst gesehen / bemerkt …‚ |
|
Aus‘ Abend undוaber ‚aus‘ Morgen … יוםחדש |
|
||||

 [Selbstbetrachtungsoption? –‚Westwärts‘ Selbstdachspitze des Markgrafenturms, vo(n burgho[e]flichem Innenrau)m
Hochschloss aus, eben hinter und über‘m Erfahrungenflügel,
zwischen Anderheit/en des Kaiserbaus und Flaggenturm ‚selber‘-bemerkbar / selbstreflexiv. ‚Südwärts‘, (dr)außen
vom Altan des bischöflichen Sinnfragenturms, des
markgräflichen Selbstfragenturms ‚Nordseite‘, vom Prachtstockwerk aufwärts,
ansehend – jedoch darunter?]
[Selbstbetrachtungsoption? –‚Westwärts‘ Selbstdachspitze des Markgrafenturms, vo(n burgho[e]flichem Innenrau)m
Hochschloss aus, eben hinter und über‘m Erfahrungenflügel,
zwischen Anderheit/en des Kaiserbaus und Flaggenturm ‚selber‘-bemerkbar / selbstreflexiv. ‚Südwärts‘, (dr)außen
vom Altan des bischöflichen Sinnfragenturms, des
markgräflichen Selbstfragenturms ‚Nordseite‘, vom Prachtstockwerk aufwärts,
ansehend – jedoch darunter?]
 [
[![]() Die recht häufig verwendeten – hier gemeinten, bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;
bereits Nachahmungen, oder 'schon' / gerade Vorstellungen, können gegen geltende Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie/Euch persönlich und/oder
andere Wesenheiten – erheblich verletzen]
Die recht häufig verwendeten – hier gemeinten, bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;
bereits Nachahmungen, oder 'schon' / gerade Vorstellungen, können gegen geltende Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie/Euch persönlich und/oder
andere Wesenheiten – erheblich verletzen]
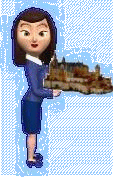 Ach
ja, Euer Gnaden (besinnt
sich hier drunten
diese Eure/unsere
Burgbegleitung): So manche Leute verbinden erlebnisweltliche Begriffsfelder
Ach
ja, Euer Gnaden (besinnt
sich hier drunten
diese Eure/unsere
Burgbegleitung): So manche Leute verbinden erlebnisweltliche Begriffsfelder  [Every single day, the girlfried of her
servant bobs her most gracefull curtsies of respect to the officer, who keeps
him under very strict conditions]
[Every single day, the girlfried of her
servant bobs her most gracefull curtsies of respect to the officer, who keeps
him under very strict conditions]
‚der (zudem zumal meist eher irgendwie mangelnd
erinnert/hyperreal-erlebten)
inneren Sicherheit‘ scheinbar, bis
anscheiend, mit etwas anderen Konontationen, 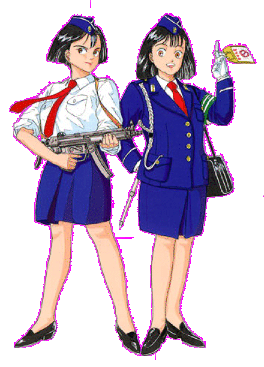 als jenen der Verwechslung/en, bis Ersetzung(sversuchungen), von
emotionaler Geborgenheit / Behaustheit, bis Gewolltheit, namentlich
in/für/von Beziehungsrelationen, mit/durch (intellektuell-)denkerische
Gewissheit/en/‚recht-(bekommen-)Haben‘?
als jenen der Verwechslung/en, bis Ersetzung(sversuchungen), von
emotionaler Geborgenheit / Behaustheit, bis Gewolltheit, namentlich
in/für/von Beziehungsrelationen, mit/durch (intellektuell-)denkerische
Gewissheit/en/‚recht-(bekommen-)Haben‘?
 [Von ‚unten‘, den (nicht allein semiotisch denkerischen) Feldern aus, kaum zu
sehen ohne bereits den Burgberg zu erklimmen, sind/werden na klar
auch ‚Fenster‘ des Festungsbereichs im hohenzollerischen
Markgrafenturm gut …]
[Von ‚unten‘, den (nicht allein semiotisch denkerischen) Feldern aus, kaum zu
sehen ohne bereits den Burgberg zu erklimmen, sind/werden na klar
auch ‚Fenster‘ des Festungsbereichs im hohenzollerischen
Markgrafenturm gut …] 
– Gefängnisse zum Ein- und
Wegsperren pp. eben Zwangsmassnahmen liegen hier unten
also/systemebedingt besonders nahe. 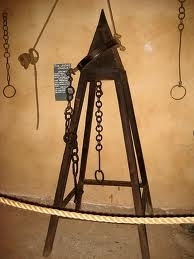
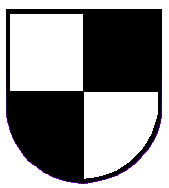 Dabei, dazu undװaber dagegen, geht es hier weniger um ‚die‘
singularisierende, ‚eine‘ indoeuropäisch verstandene
Vereinigung / verschmelzende ‚Einsmachung der bzw.
‚von Gegensätzen‘ – wie z.B. schwarz(em)
und weiß(em Rauschen), soweit diese gegenüber- bis aneinanderliegenden (ohnehin selten einzigen
dichotomen, gar kontrasmaximalen Paarungen
an/dern) Polaritäten, respektive komplementären Frequenzenanfänge, überhaupt ‚gegnerisch‘ sind / wären;
das heißt so (gleich gar ‚gut versus böse / schlecht‘ oder immerhin aus Nützlichkeitsperspektiven)
verstanden, betrachtet oder verwendet werden /
würden (können & dürfen – anstatt müssen,
wie etwa semitische oder
ostasiatische Denkformen / Sprachen optional / ‚entgottend‘
zeigen / ausdrücken
mögen).
Dabei, dazu undװaber dagegen, geht es hier weniger um ‚die‘
singularisierende, ‚eine‘ indoeuropäisch verstandene
Vereinigung / verschmelzende ‚Einsmachung der bzw.
‚von Gegensätzen‘ – wie z.B. schwarz(em)
und weiß(em Rauschen), soweit diese gegenüber- bis aneinanderliegenden (ohnehin selten einzigen
dichotomen, gar kontrasmaximalen Paarungen
an/dern) Polaritäten, respektive komplementären Frequenzenanfänge, überhaupt ‚gegnerisch‘ sind / wären;
das heißt so (gleich gar ‚gut versus böse / schlecht‘ oder immerhin aus Nützlichkeitsperspektiven)
verstanden, betrachtet oder verwendet werden /
würden (können & dürfen – anstatt müssen,
wie etwa semitische oder
ostasiatische Denkformen / Sprachen optional / ‚entgottend‘
zeigen / ausdrücken
mögen).
 [‚Jenseits‘ von .schwarz und. (zumal auf Rückseite/n) weiß. – immerhin / wengstens ‚blau‘ bekeidet / bekannt ‚darüber‘]
[‚Jenseits‘ von .schwarz und. (zumal auf Rückseite/n) weiß. – immerhin / wengstens ‚blau‘ bekeidet / bekannt ‚darüber‘]
Soweit, wo nicht sogar eher ‚schon
falls‘, Selbsterkenntnis überhaupt (‚allene‘
anstatt ‚selbsttätig‘) ohne die / den Andere/n
möglich – diskontinuierliche Differenz(-Wahrnehmung, gar unpantheistischer Nichtidentität von allem mit und in
Allem) bedürftige Voraussetzung: Grenzenrandbereiche zumal /
webigstens des Signal(rauschen)s (gar ‚Selbsts‘ –zum / wegen / vom / mit übrigen
Rauschen / großen ‚Rest‘ – irrtumsfähig)
von, bis gegenüber, für Umgebungen / ‚Kontinuität‘ wenigstens-Gehaltenem.  [Das gar
ausdejungslose, zumindest aber homogen unterschiedelos gleiche, Ideal (jedes
‚Pantheismus‘ in diesem strengen engsten Sinne) scheitert (useres / meines Erachtens bis Bekenntnisses) daran falls bis, da/ss Existenz
(zumindest von ‚deren‘ Auswirkungen /
Repräsentationen-Wahrnehmung)
verschieden]
[Das gar
ausdejungslose, zumindest aber homogen unterschiedelos gleiche, Ideal (jedes
‚Pantheismus‘ in diesem strengen engsten Sinne) scheitert (useres / meines Erachtens bis Bekenntnisses) daran falls bis, da/ss Existenz
(zumindest von ‚deren‘ Auswirkungen /
Repräsentationen-Wahrnehmung)
verschieden]
Bereits selbst wieder nicht getragene
Dienstbekleidung alternativenreich uniformierbar / brav bis artig
vereinheitlicht erscheinend.  [Auch
reduktionistisch/vereinfacht betrachtet war bis ist optional mehr möglich, als
gleichzeitig/zeitgleich sinnvoll bis ‚tragbar‘]
[Auch
reduktionistisch/vereinfacht betrachtet war bis ist optional mehr möglich, als
gleichzeitig/zeitgleich sinnvoll bis ‚tragbar‘] ![]()
 [Durchaus attraltiv im/nach Südwesten (des Untergeschosses unterm Burghof)
gelegene – inzwischen gleichwohl gut verammelte / interessiert abgedunkelte –
‚Schloßdienerwohnung‘, längst nicht nur in Angelegenheiten der
Versorgungssicherheit – unten links auf/in der (ein)genordeten
Zeichnung repräsentiert]
[Durchaus attraltiv im/nach Südwesten (des Untergeschosses unterm Burghof)
gelegene – inzwischen gleichwohl gut verammelte / interessiert abgedunkelte –
‚Schloßdienerwohnung‘, längst nicht nur in Angelegenheiten der
Versorgungssicherheit – unten links auf/in der (ein)genordeten
Zeichnung repräsentiert]
 [Edelame im Goldkleid zeigt der. ihr zof(f)enden
verlobten Freundin ihres Offiziersnurschens, höchst selbst ‚wie ein Knix geht‘
– oder ist etwas dialektisch entweder-oder-gestreift, so dass
‚Alice‘ hier, vielleicht sogar ihre
Freundin, als eine künftige Edelmagd bei Hofe, begleitet? Dsbei grüßen die beiden einander/bis/Euch doch achtsam in/aus/wegen erheblicher Dunkelheit]
[Edelame im Goldkleid zeigt der. ihr zof(f)enden
verlobten Freundin ihres Offiziersnurschens, höchst selbst ‚wie ein Knix geht‘
– oder ist etwas dialektisch entweder-oder-gestreift, so dass
‚Alice‘ hier, vielleicht sogar ihre
Freundin, als eine künftige Edelmagd bei Hofe, begleitet? Dsbei grüßen die beiden einander/bis/Euch doch achtsam in/aus/wegen erheblicher Dunkelheit]

Nein, mit Beschreibung,
bis Entdeckung(en und, wenigstens immerhin Gisela Aulfes‘s optischen,
Illustrationen, bei M.v.M.
– die gar ungewohnte Reihenfolge dieser drei Konzepte entspringt hier ja
nicht allein alphabetischer Willkür, äh Ordnung),
des ‚inneren Schweinehundes‘
 ist/wird weder
‚das Eichhörnchen‘ (vgl. des Weiteren
etwa bereits an ‚das innere
Team‘ bei Schulz von Thun und
ist/wird weder
‚das Eichhörnchen‘ (vgl. des Weiteren
etwa bereits an ‚das innere
Team‘ bei Schulz von Thun und ![]() Marco
v. Münchhausens ‚kleine
Saboteure‘), noch ‚die kleinen Füchse‘
(welche zwar auch den Weinberg verderben, vgl. KoHeLeT) und wohl gleich gar nicht
die oft ‚teuflisch‘-genannte plus empfundene
bösartige Illoyalität
umfasst, bis umarmt – oder aber es werden wesentliche Teilaspekte ‚des
Durcheinanderbringens, und (überhaupt möglichen) Verführens, bis
Verhindern(können)s‘ (vgl. die alte, gar personifizierend
auslagern s/wollende, Störendes abkapselnde Formulierung ‚Satanas /
Durcheinanderbringer‘, bis – oder eben gerade in wesentlichen Unterschieden – zu Imunisierungskonzepten wider, existenziell ja kaum bestreitbares.
schlechtes Verhalten
/ Böses) erhellend, als /\ eben
keineswegs nur
/ allein / hauptsächlich ‚außenliegend / von
der / dem / den anderen her kommend‘ – sondern in / bei / durch uns / mich selbst entscheidend
gehandhabt (gar anstatt irgendwie
‚hinweg‘ [zumal in, bis als sogenannte/n ‚Welt/lichkeit{en}‘,
‚böse Mächte‘ pp.] abtrennbar
/ ab- und auszusondernd) verortet.
Marco
v. Münchhausens ‚kleine
Saboteure‘), noch ‚die kleinen Füchse‘
(welche zwar auch den Weinberg verderben, vgl. KoHeLeT) und wohl gleich gar nicht
die oft ‚teuflisch‘-genannte plus empfundene
bösartige Illoyalität
umfasst, bis umarmt – oder aber es werden wesentliche Teilaspekte ‚des
Durcheinanderbringens, und (überhaupt möglichen) Verführens, bis
Verhindern(können)s‘ (vgl. die alte, gar personifizierend
auslagern s/wollende, Störendes abkapselnde Formulierung ‚Satanas /
Durcheinanderbringer‘, bis – oder eben gerade in wesentlichen Unterschieden – zu Imunisierungskonzepten wider, existenziell ja kaum bestreitbares.
schlechtes Verhalten
/ Böses) erhellend, als /\ eben
keineswegs nur
/ allein / hauptsächlich ‚außenliegend / von
der / dem / den anderen her kommend‘ – sondern in / bei / durch uns / mich selbst entscheidend
gehandhabt (gar anstatt irgendwie
‚hinweg‘ [zumal in, bis als sogenannte/n ‚Welt/lichkeit{en}‘,
‚böse Mächte‘ pp.] abtrennbar
/ ab- und auszusondernd) verortet.
 [Wo, bis
wie, die/welche ‚Überlebensthemen‘ mit ‚Würdefragen‘ zu kollidieren drohen] Spätestens grundlos( tiefst)e / unbegründete, gar unverursachte, Anlässe/Gelegenheiten – nicht erst/nur für Hass, äh Liebe – fänden ‚sdch‘/wir immer
und überall.
[Wo, bis
wie, die/welche ‚Überlebensthemen‘ mit ‚Würdefragen‘ zu kollidieren drohen] Spätestens grundlos( tiefst)e / unbegründete, gar unverursachte, Anlässe/Gelegenheiten – nicht erst/nur für Hass, äh Liebe – fänden ‚sdch‘/wir immer
und überall.  [(Meine) nicht-perfektionistischen Zofen
. erweisen . sich/wir . als Masorchistinnen] Wenn
‚die Zofe‘ einen Knicks macht, erhöht sie immerhin der Herrschafts Gelegenheiten ihre Arbeit
zu … ‚loben/tadeln‘?-Fragezeichen
– (Wann) Bleiben da / wo vom und durch ‚Perfektionismus‘-Bäsching getarnt, bis (vor einem/dem Selbst) verborgen, wird: ‚hinter
den (eigenen / gemeinsamen / vereinbarten) Möglichkeiten zurück zu bleiben‘ – wichtige ‚Finalitäten‘-Warnungen zuverlässigst überhört
und übersehen!-Ausrufezeichen
[(Meine) nicht-perfektionistischen Zofen
. erweisen . sich/wir . als Masorchistinnen] Wenn
‚die Zofe‘ einen Knicks macht, erhöht sie immerhin der Herrschafts Gelegenheiten ihre Arbeit
zu … ‚loben/tadeln‘?-Fragezeichen
– (Wann) Bleiben da / wo vom und durch ‚Perfektionismus‘-Bäsching getarnt, bis (vor einem/dem Selbst) verborgen, wird: ‚hinter
den (eigenen / gemeinsamen / vereinbarten) Möglichkeiten zurück zu bleiben‘ – wichtige ‚Finalitäten‘-Warnungen zuverlässigst überhört
und übersehen!-Ausrufezeichen
Schlimmer, jedenfalls aber deutlicher, noch: nicht einmal als Mangel oder Versagen – etwa bauartbedingt (‚natürliches‘, ‚unzivilisiertes‘ pp.), oder versehentlich Erkenntnis-irrtümlich, ‚getäuscht‘ bis namentlich ‚Gehorsamsverweigerungs‘-Fehlerhaftigkeiten – des/der jeweiligen Menschen (wie/da zumindest ‚sündiger Menschenheit‘ überhaupt), respektive vorfindlichen Realitäten / Schöpfung (oder dem daraus Gemachten / Gewordenen), muss (und sollte) die (kaum ernsthaft bestreitbare) Existenz solch kritischer Korrekturinstanzen, äh ‚Innerlichkeiten / (Persönlichkeits-)Bestandteile‘ – gar überhaupt vpn alternativen Komplementen, sogar namentlich ‚des Negativ‘ genannten, bis wirkenden / ‚der Negation(smöglichkeit/en)‘ (also von derart ernsthafter, tatsächlich oppositioneller, bis sogar ebenbürtiger, /ezär kenedgo/ Gegenübermacht-Freiheit).
 [Apokalypsebogen über
Hauptschiffportalbereich der Basilika San Marco]
[Apokalypsebogen über
Hauptschiffportalbereich der Basilika San Marco]
Dazu kommt / gehört, dass / wie Vollendbarkeit/en des Vorfindlichen / gegenwärtige Gegebenheiten 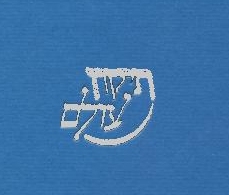 als / auf / in /
zu ‚deren Mangel‘ zu reduzieren, selbst
einer, bis diese( Sichtweise diese)r, ist / wird – ‚es‘ uns als Aufgabe, bis
Berufung/en, verdunkelnd / entstellend / entziehen( s/wollen)d,
als / auf / in /
zu ‚deren Mangel‘ zu reduzieren, selbst
einer, bis diese( Sichtweise diese)r, ist / wird – ‚es‘ uns als Aufgabe, bis
Berufung/en, verdunkelnd / entstellend / entziehen( s/wollen)d, 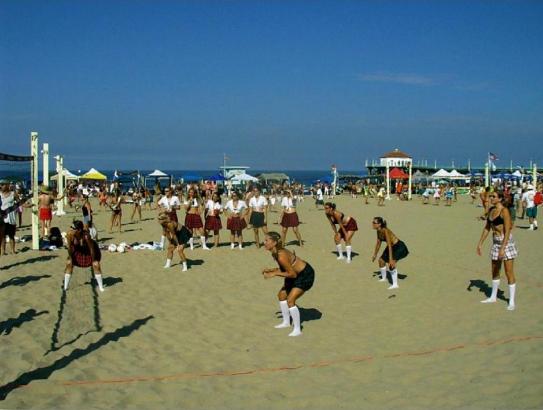
zumal (nicht einmal allein, oder immer nur ‚schweinehündisch‘-depressive) Vernichtungs- bis Selbstvernichtungsbedürfnisse (gar insbesondere apokalyptisch / gnostisch, zu rechtfertigen scheinende) fördernd.
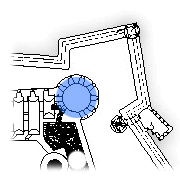 Gesichert
erscheint allenfalls: Mit welchen Gottheiten/Menschen
ich besser nicht/s zu tun haben … [Denn
– was ‚Wissen‘ angeht: Sicherheit bleibt vor allem
eine wirkmächtige Illision! Deren (zwar gar
optionale, jedoch unausweichlich
vertrauensrelevanten) Handhabungsweisen sich einem
(‚dennoch‘ – bis eben
da/wo/wenn dadurch auch/gerade keine
Gesichert
erscheint allenfalls: Mit welchen Gottheiten/Menschen
ich besser nicht/s zu tun haben … [Denn
– was ‚Wissen‘ angeht: Sicherheit bleibt vor allem
eine wirkmächtige Illision! Deren (zwar gar
optionale, jedoch unausweichlich
vertrauensrelevanten) Handhabungsweisen sich einem
(‚dennoch‘ – bis eben
da/wo/wenn dadurch auch/gerade keine
vollständige Determinierbarkeit
gesichert gewiss) ‚schicksalhaft‘(-nennbar)-überrollend ‚wie/als
(absichtswiderig
bis unverursacht) von selbst (oder Anderheiten/Ungeheuerlichem) / übermächtig gefügt zufallend / komtingent (oder willkürlich gelegenheitsfensterlich
bis beliebig verteilt) einschlagend‘ erscheinende / (gar auch gegenteilig) wirkende Vorhergesagtheiten (zumindest/zumal
auffällig ‚des Befüchteten‘ – genauer jedoch des/der auszubleiben bis
einzutreten erhofften/zugetrauten/geliebten Ereignisse) präsentieren (tun oder&und erhebliche Beeinflussungen
zulassen)]  Mindestens die ganzen Südseiten,
nicht nur der Festung,
entlang mit Eifer, als Sicherheit,
gesucht/verfehlt:
Mindestens die ganzen Südseiten,
nicht nur der Festung,
entlang mit Eifer, als Sicherheit,
gesucht/verfehlt: Geborgenheit?
Gleich, und bereits dicht, bei der Scharfeckbastion des Ent- bis jedenfalls Unterscheidens zwischen / über / aus ‚Gut / Besser versus Böse / Schlecht‘, dem (uns ‚unerspart‘ gebliebenen. überwindbaren) Menschenheitsproblemen: Reduktionistischer Vereinfachungen /pschat/ פשט als/hyperhoch, so geläufigen, doch bis da irrigen, prinzipiellen Basis(definition) von ‚Richtig‘, äh vergeblich ‚ohne Falsch/es‘ gelegen,
 Zu wesentlichen Heftigkeiten (an/der/in Gewissheitsangelegenheiten
/ Sicherheitsfragen) gehört:
Dass/Falls/Wie Erfahrungen / Verteilung(skurven bis -verfah)en / Wahrscheinlichkeiten
zwar größer/mehr oder kleiner/weniger (zudem falsch, passend, strittig oder unbekannt) sein/werden
können (gleich gar
als Ausprägungen und Vorhandenheiten
anderer Dinge und Ereignisse); –
(dies/e An-/Einsichten, Modelle,
Prognisen, Rechnungen, Repräsentationen,
Vorstellungemn) aber dennoch/deswegen
ups-peinlicherweisen michts (gleich gar Determinierendes
/ Programmierendes / schicksalhaft [auch nur, wenigstens
Gerechtigkeiten / Notwendigkeit {nicht er-}] Zwingendes) mit gegenwärtig aktuellem/nächstem – insofern ‚tatsächlich‘-nennbaren,
teils intersubjektiv konsensfähig überprüfbaren – ‚Ausbleiben‘ oder ‚Eintreten‘ des/eines
Dinges oder Ereignisses und ggf. ‚seiner‘ Ausprägung/en (als
innerhin/allerdings Demken / Erwartungen / Gefühlen
/ / Glauben / Furchten /
Ideen L Leidenschaften / Tun & Unterlassen / Vorbereitungen, Wünschen menschlicherseits)
zu tun haben! [Turmseitig ‚äußerlich‘ unten und oben: Gerade
in Geborgenheiten-relevanten
Sicherungsfragen genügt vorrangiges/hauptsächliches
alleine keinewegs. „Macchiavelli erkannte
bereits, dass sich die meisten Menschen ihres Besitzes erst sicher wähnen, wenn
sie von
anderen etwas dazuerwerben.“ (E.G.B. in ‚Liebesangelegenheiten‘) – ‚Es
Zu wesentlichen Heftigkeiten (an/der/in Gewissheitsangelegenheiten
/ Sicherheitsfragen) gehört:
Dass/Falls/Wie Erfahrungen / Verteilung(skurven bis -verfah)en / Wahrscheinlichkeiten
zwar größer/mehr oder kleiner/weniger (zudem falsch, passend, strittig oder unbekannt) sein/werden
können (gleich gar
als Ausprägungen und Vorhandenheiten
anderer Dinge und Ereignisse); –
(dies/e An-/Einsichten, Modelle,
Prognisen, Rechnungen, Repräsentationen,
Vorstellungemn) aber dennoch/deswegen
ups-peinlicherweisen michts (gleich gar Determinierendes
/ Programmierendes / schicksalhaft [auch nur, wenigstens
Gerechtigkeiten / Notwendigkeit {nicht er-}] Zwingendes) mit gegenwärtig aktuellem/nächstem – insofern ‚tatsächlich‘-nennbaren,
teils intersubjektiv konsensfähig überprüfbaren – ‚Ausbleiben‘ oder ‚Eintreten‘ des/eines
Dinges oder Ereignisses und ggf. ‚seiner‘ Ausprägung/en (als
innerhin/allerdings Demken / Erwartungen / Gefühlen
/ / Glauben / Furchten /
Ideen L Leidenschaften / Tun & Unterlassen / Vorbereitungen, Wünschen menschlicherseits)
zu tun haben! [Turmseitig ‚äußerlich‘ unten und oben: Gerade
in Geborgenheiten-relevanten
Sicherungsfragen genügt vorrangiges/hauptsächliches
alleine keinewegs. „Macchiavelli erkannte
bereits, dass sich die meisten Menschen ihres Besitzes erst sicher wähnen, wenn
sie von
anderen etwas dazuerwerben.“ (E.G.B. in ‚Liebesangelegenheiten‘) – ‚Es
![]()
![]() bleibet‘ also ‚dabei‘:Zunächst und vor allem ist
‚Sicherheit‘ zwar eine Illusion – allerdings nicht ausschließlich nur dies;
auch ‚Planungssicherheit‘
allenfalls ein fragwürdiger Ersatz, und ‚vuka‘-Gefahen älter
als sie bemerkt werden]
bleibet‘ also ‚dabei‘:Zunächst und vor allem ist
‚Sicherheit‘ zwar eine Illusion – allerdings nicht ausschließlich nur dies;
auch ‚Planungssicherheit‘
allenfalls ein fragwürdiger Ersatz, und ‚vuka‘-Gefahen älter
als sie bemerkt werden]  So haben auch Revolutionären bis Terroisten
eben gewiss keine dauerhafte Möglichkeit im Gefecht gegen reguläre Truppen zu
bestehen;
So haben auch Revolutionären bis Terroisten
eben gewiss keine dauerhafte Möglichkeit im Gefecht gegen reguläre Truppen zu
bestehen;  doch singular / vereinzelt bis situativ, sogar
(bis
eben gerade persönlich / überindividuell ob
virtualita / mythologisch, kriminell und/oder gar hyperreal überwältigend) auch gegen professionellen
Objekt- bis Personenschutz, können manche Leute manchmal, durchaus verheerend
genug, wirken (namentlich, um Gemeinwsen
bis ‚Politik‘ zu ‚ändern‘ respektive – inklusive
Polzei und Truppen bis Vertrauen[sgewissheiten] – zu destabilisieren).
doch singular / vereinzelt bis situativ, sogar
(bis
eben gerade persönlich / überindividuell ob
virtualita / mythologisch, kriminell und/oder gar hyperreal überwältigend) auch gegen professionellen
Objekt- bis Personenschutz, können manche Leute manchmal, durchaus verheerend
genug, wirken (namentlich, um Gemeinwsen
bis ‚Politik‘ zu ‚ändern‘ respektive – inklusive
Polzei und Truppen bis Vertrauen[sgewissheiten] – zu destabilisieren).  [Unterschätze keine Menschen, deren
Kinder bedroht erscheinen] Gerade
daher Versicherungen, teils auch obligatorisch vorgeschriebene (Profis), weder
bestreitend noch ablehend.
[Unterschätze keine Menschen, deren
Kinder bedroht erscheinen] Gerade
daher Versicherungen, teils auch obligatorisch vorgeschriebene (Profis), weder
bestreitend noch ablehend.
erheben ups sich – gar ‚brav‘, bis selbst ‚artig‘ – des Selbsteturmes (zumal eher fundamental) markgräflichen (denn etwa dichotomen, oder dialektischen Entweder-positiv-Oder-negativ-)Untergeschosse:
 Na immerhin ‚Schülerinnen‘? [Ein /\ Das (eben, da mit,
bet
Na immerhin ‚Schülerinnen‘? [Ein /\ Das (eben, da mit,
bet![]() wet beginnend
– ‚sekundäres‘, doch schon Beziehungsrelationales anerkemmende, anstatt
wet beginnend
– ‚sekundäres‘, doch schon Beziehungsrelationales anerkemmende, anstatt
‚einzig absolutes‘)
‚Sicher׀heit(sverlassens)‘-Wort selbst, spricht und schreibt (in! hebräischen Denken, sogar am
Ende des konsonantischen Wurzelzeichentrippels) ‚sich‘ bekanntlich / charakteristisch mit / in
der ungeheuerlichen beinahe Zerrissenheit
des chet ![]() :]
בטח׀ה /batach (bitcha)/לבטוח
:]
בטח׀ה /batach (bitcha)/לבטוח
v. to
trust, rely on, depend; be secured
בטחה
nf.
security, safety, sureness
Hier
‘spätestens’ für’s/im Markgrafenzimmer ,allegorisiert/analog‘ herangezogen werde/würden: Was respektive Wer (‚aktiv‘/genus-verbi ‚neural‘/‚passi‘, ‚modal‘ pp.)
bewacht / bewährt / bewertet / fehlt (we,/wo Vieldeutigkeiten-Raderausfgälle chaosverdächtig) / …
/ gelassen
/ (ge)schützt / (ge)trennt / (ge)wählt /
getan / gewollt / kämpft / regiert / verwaltet / will-!/? – HaXaRa
הכרה
|
Consciousness |
הכרה;
תודעה;
מודעות |
|
sense |
חוש;
תחושה; תודעה,
הכרה; רגש;
תבונה,... |
|
cognisance (Brit.) |
הכרה,
תשומת לב |
|
cognizance (Amer.) |
מודעות,
הכרה |
|
acquaintance |
היכרות;
מכר, מודע |
|
recognition |
הכרה;
זיהוי |
|
acknowledgement |
אישור;
הכרה; אות
תודה |
|
Knowledge |
ידע;
ידיעה; דעת;
הכרה |
|
ken |
ידיעה,
דעת; הכרה;
השגה, תפיסה;
תחום... |
|
Ken |
קן,
שם פרטי לזכר
(גרסה של השם
קנת'); שם... |
|
ידיעה;
הכרה; ידיעת
נסתרות |
|
|
Noesis |
הכרה;
תפיסה
תבונתית |
|
conviction |
הכרה;
הרשעה; שכנוע |
כרה
(>>כירה)
![]()
|
stove |
תנור,
כיריים, כירה |
![]()
[Harnisch – viel, gar alles (Wesentliche endgültig) absolut fest, wenigstens
aber besser, zu wissen] Wissenspanzerung
ab-/anlegend? 
Geradezu Ur-Ängste und/also Ur-Vertrauenssfragen laden zum Verweilen, gleich gar hier unten, äh in, vermeintlichen bis versprochenen / eingehandelten, Sicherheiten (namentlich, ‚dass es/mein Verhalten richtig ist‘), ein:
Verführen zu viele, zu gerne, bis
beabsichtigt, dazu: sich (soweit
nicht sogar einander wechselseitig
/ intersubjektiv konsensfähig) in/mit
intellektuellen Gewissheiten-Panzerungen zu schützen / sichern /
verteidigen / / zurück zu ziehen. 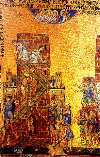 Wann/Wem/Wozu sind/werden
Geborgenheiten solch eigentümlich gewoehnt
unterschiedlichste Orte? [Der
Bedeutungen-Vielfalten-Vielzahlen ‚reduzieren‘
indem sie durch Mehrungen herangezogener Sprachen – an/gegenüber jener/jenen
eigenen Denkens und (grammatikalischen
Geborgenheits-)Empfindens –
udeutlicher / uneindeutiger / unselbstverständlicher / unzwingender werden]
Wann/Wem/Wozu sind/werden
Geborgenheiten solch eigentümlich gewoehnt
unterschiedlichste Orte? [Der
Bedeutungen-Vielfalten-Vielzahlen ‚reduzieren‘
indem sie durch Mehrungen herangezogener Sprachen – an/gegenüber jener/jenen
eigenen Denkens und (grammatikalischen
Geborgenheits-)Empfindens –
udeutlicher / uneindeutiger / unselbstverständlicher / unzwingender werden]
Paradoxerweise macht es diesbezüglich weniger Unterschied/e, ob es sich dabei beispielsweise um ‚naturwissenschaftliche Kenntnisse‘, oder ‚solche zwischenmenschlicher Verhaltensregeln, bis –regelmäßigjeitshäufungen, in der jeweiligen Gemeinschaft, bis Gesellschaft‘ handelt, als vielmehr ‚wie ‚genau‘ diese sind, und wie präziese sie gegenseitig eingehalten / befolgt werden‘ (wobei das Verhalten von Sauerstoff-Molekülen eher/häufiger, als jenes von physiologischen Körperzellen, oder gar jenes von anderen inzwischen ‚natürlich‘-genannten, über soziale bis juristische Personen, intersubhektiv erwartungsgemäß verlaufen mag/wird).
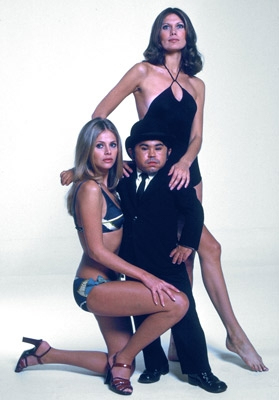 Ausfallschritte
der einen (Dienstbarkeit) – deuten-?-ז״א [Zwar
huldigt die Gefangene (‚immerhin‘ oder ‚sogar‘)
in Hofschuen, die Sklavin jedoch ganz barfüssig (Willkür/en unterworfen - ähmlich aussehend)
fügsam] Egal wem (‚zu sichern / siegen‘-?) belieben:
Ausfallschritte
der einen (Dienstbarkeit) – deuten-?-ז״א [Zwar
huldigt die Gefangene (‚immerhin‘ oder ‚sogar‘)
in Hofschuen, die Sklavin jedoch ganz barfüssig (Willkür/en unterworfen - ähmlich aussehend)
fügsam] Egal wem (‚zu sichern / siegen‘-?) belieben: 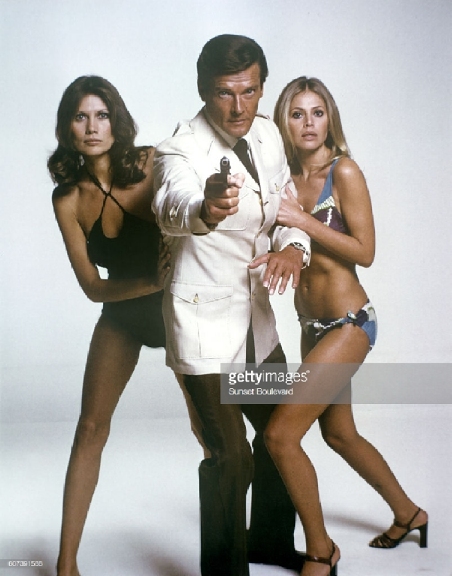 ‚Würde ich – wäre / gäbe ich das /
Dein / ein / Euer / Ihr / kein / mein / sein Dienstmächen – (nicht) in die Knie gehen?‘ [Klar, bis zwar, hat Sicherheit manchmal nicht nur / allein / rein wesentlich, doch eben immer auch Hyperrealitäten-Aspekte / -Repräsentationscharakter] Ob
verboten oder zugelassen, bemerkt oder bestritten usw. unterscheiden sich
gefühlte und gemessene – nicht erst
/ nur – Kriminalitäten zur selben Zeit am selben Ort.
‚Würde ich – wäre / gäbe ich das /
Dein / ein / Euer / Ihr / kein / mein / sein Dienstmächen – (nicht) in die Knie gehen?‘ [Klar, bis zwar, hat Sicherheit manchmal nicht nur / allein / rein wesentlich, doch eben immer auch Hyperrealitäten-Aspekte / -Repräsentationscharakter] Ob
verboten oder zugelassen, bemerkt oder bestritten usw. unterscheiden sich
gefühlte und gemessene – nicht erst
/ nur – Kriminalitäten zur selben Zeit am selben Ort.
 [Manchmal wäre ein Badeanzug vorzuziehen] Dabei und dagegen ‚fällt das ganze Vorhaben‘
– allein schon auf der elementaren Gefahrenabwehr-,,
äh Lebensrisiken-Kenntnisseite
– geradezu ‚ins Wasser‘, wo / da (zumal dem fientischen Geschehen / ‚Handeln‘ vorausgehend) Unvollständigkeiten der sogenannten ‚Information‘
[Manchmal wäre ein Badeanzug vorzuziehen] Dabei und dagegen ‚fällt das ganze Vorhaben‘
– allein schon auf der elementaren Gefahrenabwehr-,,
äh Lebensrisiken-Kenntnisseite
– geradezu ‚ins Wasser‘, wo / da (zumal dem fientischen Geschehen / ‚Handeln‘ vorausgehend) Unvollständigkeiten der sogenannten ‚Information‘
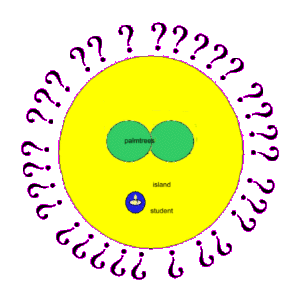 [Allwissenheit bleibt
zumindest Überraumzeitlichem
vorbehalten, ansonsten gilt: Je mehr bekannt, desto
längere / mehr Berührungen mit Unbekanntem; vgl.
‚gerade griechisch‘ Sokrates]
[Allwissenheit bleibt
zumindest Überraumzeitlichem
vorbehalten, ansonsten gilt: Je mehr bekannt, desto
längere / mehr Berührungen mit Unbekanntem; vgl.
‚gerade griechisch‘ Sokrates]
zu aspektischen Selektivitäten verführen, bis zwingen:  Bekleidet
mit Fach- und Sachkundenachweisen?
[Eine Expertin jedenfalls, ‚weiß fast alles von fast nichts‘. – Kennt
bestenfalls welche, die dies von / über
relativ benachbarte/n ‚fast-nichts/e‘ tun]
Bekleidet
mit Fach- und Sachkundenachweisen?
[Eine Expertin jedenfalls, ‚weiß fast alles von fast nichts‘. – Kennt
bestenfalls welche, die dies von / über
relativ benachbarte/n ‚fast-nichts/e‘ tun]
Menschen
–
selbst diesbezüglich als ‚angst-krank‘, ‚phobisch‘, ‚panisch‘ pp. bezeichnete erfinderische / kreative –
vermögen nicht einmal sich vor all dem
Schrecken zu ängstigen, vor dem sie sich (auch ‚nur insofern) zurecht‘ (da immerhin, wie
wahrscheinlich auch
immer, möglich) fürchten vernünftig-dürften
/ herbeiprophezeien und/oder professionell
dagegen/\dafür trainieren können – bereits / noch ganz abgesehen von all
dem beliebig ‚großen Rest‘ der zwar unmöglichen, also grenzenlos ausdenkbaren, Ungeheuerlichkeiten.  [Überhaupt
begründ- bis damit auch widerlegbare, bis zu
kalkulierende, Furcht/en (nicht allein ohnehin wichtige Angstphänomene), erweisen sich,
manche überraschenderweise, als weniger heftig, bis beherrschbar, gegenüber sonstigen Schrecken vor den Schrecken]
[Überhaupt
begründ- bis damit auch widerlegbare, bis zu
kalkulierende, Furcht/en (nicht allein ohnehin wichtige Angstphänomene), erweisen sich,
manche überraschenderweise, als weniger heftig, bis beherrschbar, gegenüber sonstigen Schrecken vor den Schrecken]
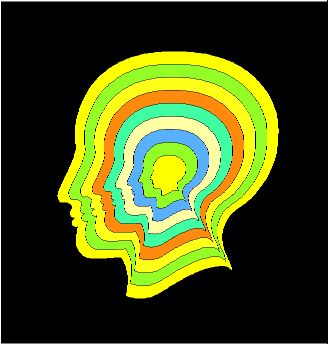 [Wo
sicherheitsbedürftige Aspekte des / eines, bis der, Menschen behaust / verborgen]
[Wo
sicherheitsbedürftige Aspekte des / eines, bis der, Menschen behaust / verborgen]
 [Was, gar nicht allein junge und alte,
Menschen benötigen ist nicht
etwa ‚grammatikalische / intelektuelle Sicherheit‘ (namentlich maximal kontrasrklar: ‚was
böse / schlecht / dämonisch / teuflisch / ngativ / falsch‘), sondern ups ‚emotionale Geborgenheit‘
– namentlich in (inner- bis)
zwischenmenschlichen Beziehungsrelationen]
[Was, gar nicht allein junge und alte,
Menschen benötigen ist nicht
etwa ‚grammatikalische / intelektuelle Sicherheit‘ (namentlich maximal kontrasrklar: ‚was
böse / schlecht / dämonisch / teuflisch / ngativ / falsch‘), sondern ups ‚emotionale Geborgenheit‘
– namentlich in (inner- bis)
zwischenmenschlichen Beziehungsrelationen]  Populistische Volkstümmeleien sind werder
notwendigerweise noch aööe ‚evangelikal‘ doch stets missionarisch, bis
verbissen, unterwegs.
Populistische Volkstümmeleien sind werder
notwendigerweise noch aööe ‚evangelikal‘ doch stets missionarisch, bis
verbissen, unterwegs.
Dass (schon) Dummheit/en (nicht erst Bosheit vis Verschwärung) wahlenentscheidend sein/werden kann/können, war eigentlich nie ernsthaft strittig – wo, und bereits falls, es sich um Wichtiges, respektive Bevölkerungsmehrheiten, handelt – mag falsches (Wahl-)Verhalten jedoch (hoffentlich) affizieren / aufschrecken dürfen.
 Zwar
wollen manche Benimmexpertinnen (Ihnen/sich)
verbitem als/zum Knicksen einen kurzen oder gerade geschnittenen Rock seitlich
anzufassen – doch spätestens in
Hunpelröcken … Sie wissen schon.
Zwar
wollen manche Benimmexpertinnen (Ihnen/sich)
verbitem als/zum Knicksen einen kurzen oder gerade geschnittenen Rock seitlich
anzufassen – doch spätestens in
Hunpelröcken … Sie wissen schon.
[‚Also ‚Herr Graf‘, lautet womöglich
eine (zumal eher beliebte) Art
Vollzugsmeldung, denn/Erleuterungen:
‚Rotkäppchen

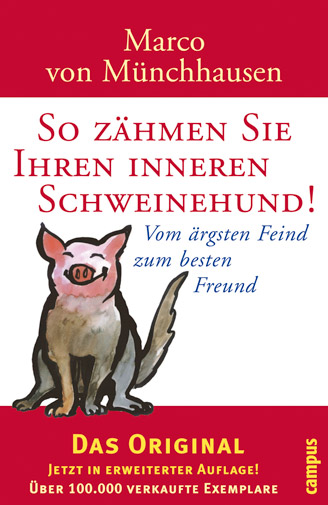 und ihr inneres Schweinehundchen machen nun brav
Sitz, bis Knicks.‘]
und ihr inneres Schweinehundchen machen nun brav
Sitz, bis Knicks.‘] Zumal, nein: Zumindest, unreflektiert – dies
(eigene) Verhalten also selbst nicht bemerken
(müssend, bis vorzugsweise nicht unterlassen/ändern
wollen sollend)!
 Vom ‚inneren Schweinehundling‘,
gar dem ärgsten Feind, bis zum / als ‚inneren Archivar‘ ,dem gar
qualifiziertesten inneren Freund: Master/a interior, begleiten
einen / Euch / uns / mich hier drunten, nicht
etwa allein, doch immerhin. zeichnerisch abbildend, zumal
Vom ‚inneren Schweinehundling‘,
gar dem ärgsten Feind, bis zum / als ‚inneren Archivar‘ ,dem gar
qualifiziertesten inneren Freund: Master/a interior, begleiten
einen / Euch / uns / mich hier drunten, nicht
etwa allein, doch immerhin. zeichnerisch abbildend, zumal ![]() Marco v. Münchhausen und
Marco v. Münchhausen und ![]() George Pennington, bis immerhin / wenigstens bereits
Augustinus (jedenfalls mit Adeodat, äh
inzwischen / endlich E.B. Referenzen-würdig).
George Pennington, bis immerhin / wenigstens bereits
Augustinus (jedenfalls mit Adeodat, äh
inzwischen / endlich E.B. Referenzen-würdig). 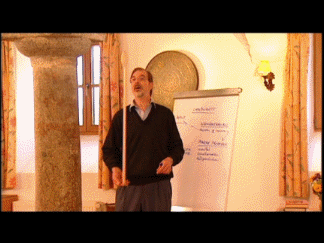
[![]() Widmung Seite fünf: „Ich [G.P.] widme
dieses Buch meinen vielen Lehrern,
ohne die es nie hätte entstehen können,
Widmung Seite fünf: „Ich [G.P.] widme
dieses Buch meinen vielen Lehrern,
ohne die es nie hätte entstehen können,
und meinen
vielen Schülern, die ebenso viel dazu beigetragen haben.“  [Der Buchversion des, ups mehr-deutigen Titels, Inhaltsverzeichnis,
Polling 2013/2014, in einem Jahrzehnt, gegenüber dem Film seiner
Seminare-Gliederung 2005, teils deutlich weiterentwickelt, zumal sein Autor G.P. Wert
darauf legt: weder ausgelernt, noch gliedernd
ausschließlich linear darzustellende Reihenfolgen geliefert, zu haben –
macht deutlich wie ‚bewusst‘ gemeint, dass
sich jedenfalls negative
Diskriminierungsabsichten des ‚unbewisst‘-Genannten in Grenzen halten]
[Der Buchversion des, ups mehr-deutigen Titels, Inhaltsverzeichnis,
Polling 2013/2014, in einem Jahrzehnt, gegenüber dem Film seiner
Seminare-Gliederung 2005, teils deutlich weiterentwickelt, zumal sein Autor G.P. Wert
darauf legt: weder ausgelernt, noch gliedernd
ausschließlich linear darzustellende Reihenfolgen geliefert, zu haben –
macht deutlich wie ‚bewusst‘ gemeint, dass
sich jedenfalls negative
Diskriminierungsabsichten des ‚unbewisst‘-Genannten in Grenzen halten] 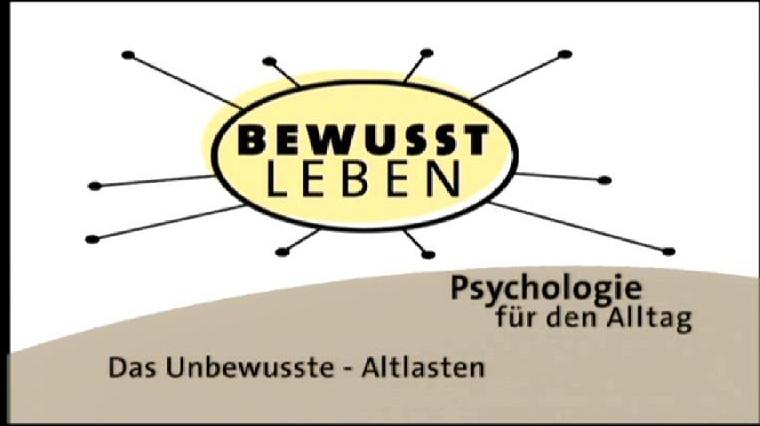 ‚Bewusst leben‘ unterstellt
Möglichkeiten, gar Gefahren, dies(es ‚Ziel‘ / ‚Mittel‘
/ diesen ‚Sinn‘) zu
unterlassen/erreichen, jedenfalls
versäumen/verfehlen,
zu können.
‚Bewusst leben‘ unterstellt
Möglichkeiten, gar Gefahren, dies(es ‚Ziel‘ / ‚Mittel‘
/ diesen ‚Sinn‘) zu
unterlassen/erreichen, jedenfalls
versäumen/verfehlen,
zu können.  [#Nur
Schlechtes# oder
#nur
Gutes dahinter/dabei zu
denkempfinden#
irrt ergründlich – allerdings auch in ‚allerbester höfischer Gesellschaft‘]
[#Nur
Schlechtes# oder
#nur
Gutes dahinter/dabei zu
denkempfinden#
irrt ergründlich – allerdings auch in ‚allerbester höfischer Gesellschaft‘] 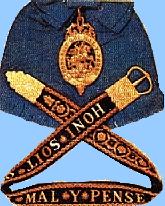
Gerade seine ‚motivationalen‘ Bemühungen, Freiheiten / Unterstellungen dies widrigenfalls
zu unterlassen, verbirgt ein derart betreffender Titel / Autor
nicht.
![]() „Vorwort 11 indogene
Einsicht, im Leben komme es daruf an, Hindernisse
in Kraftquellen zu verwandeln. Haupthindernis des Autors sei gewesen von/in
Schulen weder auf’s Leben, noch auf’s Menschsein, vorbereitet worden, mit
seinen damaligen Hauptfragen „Was läuft hier überhaupt?"
„Was will ich?" und „Wie mache ich es richtig?" alleine
gewesen, bis geblieben, zu sein.
„Vorwort 11 indogene
Einsicht, im Leben komme es daruf an, Hindernisse
in Kraftquellen zu verwandeln. Haupthindernis des Autors sei gewesen von/in
Schulen weder auf’s Leben, noch auf’s Menschsein, vorbereitet worden, mit
seinen damaligen Hauptfragen „Was läuft hier überhaupt?"
„Was will ich?" und „Wie mache ich es richtig?" alleine
gewesen, bis geblieben, zu sein.  [Auch das, nicht
als wissenschaftliches
Werk konzipierte, Buch erhebt intersubjektive
Ansprüche in/aus G.P.‘s Seminaren bewährt, bis allgemein zureffend, zu sein]
[Auch das, nicht
als wissenschaftliches
Werk konzipierte, Buch erhebt intersubjektive
Ansprüche in/aus G.P.‘s Seminaren bewährt, bis allgemein zureffend, zu sein]
![]() Einleitung
12 Im Buch gehe es um „Grundlagen unserer
Lebenstüchtigkeit.“ Quasi um unsrer „Betreibssystem“ als/da Menschen: „Diese Fähigkeit, uns unseren eigenen
[sic!] Bedürfnissen und der gegebenen Situation
entsprechend zu organisieren und zu verhalten, basiert auf dem
Wissen
Einleitung
12 Im Buch gehe es um „Grundlagen unserer
Lebenstüchtigkeit.“ Quasi um unsrer „Betreibssystem“ als/da Menschen: „Diese Fähigkeit, uns unseren eigenen
[sic!] Bedürfnissen und der gegebenen Situation
entsprechend zu organisieren und zu verhalten, basiert auf dem
Wissen ![]() um
uns selbst.“ Jener Art davon, die griechisch etwa bei Platon wie Aristoteles gemeinsam
als phronesis (meist ‚praktische Weisheit‘)
bezeichnet, dessen Anwendung zu
eudaimonia (‚Wohlergehen‘wortgetreulicher:
‚guten Geistern‘) in allen Lebensbereichen führe [sic!
mindestens aber ‚beitrage‘; O.G.J. wider bereits/zumal antike Determnismen-Wahl in/an der Aus-/Eindrucksweise].
um
uns selbst.“ Jener Art davon, die griechisch etwa bei Platon wie Aristoteles gemeinsam
als phronesis (meist ‚praktische Weisheit‘)
bezeichnet, dessen Anwendung zu
eudaimonia (‚Wohlergehen‘wortgetreulicher:
‚guten Geistern‘) in allen Lebensbereichen führe [sic!
mindestens aber ‚beitrage‘; O.G.J. wider bereits/zumal antike Determnismen-Wahl in/an der Aus-/Eindrucksweise].
[Die gerne als
‚Kompetenzen‘ oder auch ‚Soft Skills‘ bezeichnet und unterteilt werden; doch
genauer besehen bleibe alles „Selbstkompetenz,“, ob im Umgang mit Anderen, oder mit/für sich ‚alleine‘, respektive
unter zusätzlichen Erschwernissen wie (spezifische; A.S.) Verantwortung, Arbeitsdruck,
Verhandlungs- bis Verständigungsschwierigkeiten etc. pp.] 
![]() Zur Gestaltung und Struktur des Buches
14 Zur Darstellung von Zusammenhängen verwende G.P. „kognitive
Landkarten", d. h. Zeichnungen, die einen Überblick
Zur Gestaltung und Struktur des Buches
14 Zur Darstellung von Zusammenhängen verwende G.P. „kognitive
Landkarten", d. h. Zeichnungen, die einen Überblick
über
den behandelten Bereich vermitteln. Mit demenstprechenden Vor- und Nachteilen.
Alle Themen hängen mehr oder weniger
zusammen,
bedingen einander, auch wenn sie manchmal hundert Seiten auseinander liegen.
Ich werde auf diese Zusammenhänge an gegebener Stelle hinweisen. Dennoch hat
die Themenabfolge eine logische
Struktur und folgt im
Wesentlichen
der Übersichtslandkarte
im Kapitel „Was ist Selbstkompetenz?".
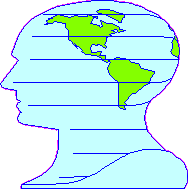
[Gar
wer durchaus, bis besser, an/nach ‘gentleness‘ auf- oder ausgerichtet – gentlewomen
and gentlemen, Milady] 
![]() Orientierung 15
[an ‚eigener/innerlicher‘ senkrechter
/ani/-Achse-אני des tänzerischen Standbeins
da/wo/soweit äußerlich gar Chaos ‚‘wirke‘/scheint.
Orientierung 15
[an ‚eigener/innerlicher‘ senkrechter
/ani/-Achse-אני des tänzerischen Standbeins
da/wo/soweit äußerlich gar Chaos ‚‘wirke‘/scheint. ![]()
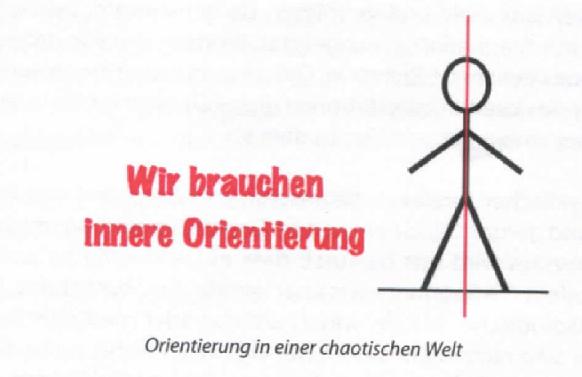 – Zwar mag das Paradigma ‚früher einfacherer‘, bis ‚verlorener Vertrautheit/Behaustheit ups auf Erden‘ die üblichen
Urstände feiern; doch soll der gemeinte Wandel hier nicht etwa bestritten oder gewertet
werden; O.G.J. nut KoHeLeT] „Es war keine Welt, die den Menschen Sicherheit
bot, aber mit ihren ewig wiederkehrenden Zyklen war [sic! erschien;
O.G.J. Erwartbar- bios Berechenbarkeiten nicht notwendigerweise mit
Bejerrschungsillusionen gleichsetzend] sie immerhin einigermaßen überschaubar und verlässlich.
– Zwar mag das Paradigma ‚früher einfacherer‘, bis ‚verlorener Vertrautheit/Behaustheit ups auf Erden‘ die üblichen
Urstände feiern; doch soll der gemeinte Wandel hier nicht etwa bestritten oder gewertet
werden; O.G.J. nut KoHeLeT] „Es war keine Welt, die den Menschen Sicherheit
bot, aber mit ihren ewig wiederkehrenden Zyklen war [sic! erschien;
O.G.J. Erwartbar- bios Berechenbarkeiten nicht notwendigerweise mit
Bejerrschungsillusionen gleichsetzend] sie immerhin einigermaßen überschaubar und verlässlich.
Dann lernten wir, einer linearen,
zielgerichteten Denkweise den Vorzug zu geben.“ Zyklen seinen mit Stagnation
[bis Fortschrittshindernissen; O.G.J.] gleichgesetzt worden. Inzwischen seien wir „der linearen Denkweise […]
auch nicht
mehr sicher [sic!]. Langsam wird uns bewusst, dass es
nicht ewig so weitergehen kann.“ Zumal angesichts von
Weltuntergangskatastrophen-Senzarien seinen würden  [wovon sich/uns O.G.J.
allerdings eher ‚alarmistische Abstumpfungen‘,
bis ‚asketisch-libertinistische Verachtungen
/ Sinnlosigkeiten‘ und ‚Untergangsgelüßte / Amokneigungen‘,
als – mangels Freiwilligkeit / dank Zwang – ‚etwa qualifiziertes
Fürchte Dich nicht (gleich gar: sondern
G’tt)‘ erwartet]
[wovon sich/uns O.G.J.
allerdings eher ‚alarmistische Abstumpfungen‘,
bis ‚asketisch-libertinistische Verachtungen
/ Sinnlosigkeiten‘ und ‚Untergangsgelüßte / Amokneigungen‘,
als – mangels Freiwilligkeit / dank Zwang – ‚etwa qualifiziertes
Fürchte Dich nicht (gleich gar: sondern
G’tt)‘ erwartet] 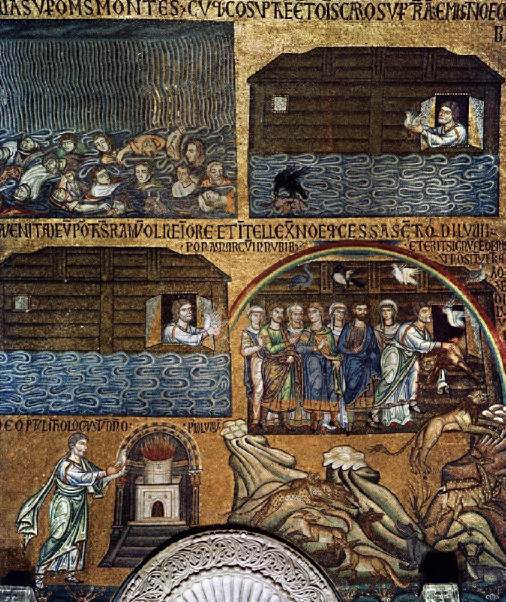 „wir
nicht mehr sicher [sic!]“ sein, „wer eigentlich wofür zuständig“ sei. „Die gestrigen Gewissheiten haben sich als Irrtümer, Fehlentwicklungen
oder Illusionen erwiesen.“ Nichts sei mehr gewiss. [Dreifach qualifiziertes Aufhebungsverständnis,
des jeweils ‚für Richtig / gar Wahrheit‘-Gehaltenen
könnte ‚bereits
mental / rational / denkerisch‘ an sich
unverzichtbare Irritationen ‚erhellen‘, bis ups ‚verflüssigen‘]
„wir
nicht mehr sicher [sic!]“ sein, „wer eigentlich wofür zuständig“ sei. „Die gestrigen Gewissheiten haben sich als Irrtümer, Fehlentwicklungen
oder Illusionen erwiesen.“ Nichts sei mehr gewiss. [Dreifach qualifiziertes Aufhebungsverständnis,
des jeweils ‚für Richtig / gar Wahrheit‘-Gehaltenen
könnte ‚bereits
mental / rational / denkerisch‘ an sich
unverzichtbare Irritationen ‚erhellen‘, bis ups ‚verflüssigen‘] 
Die Antwort
des Sufi[-Trancetänzers warum ihnen im ständigen
Drehen, des Seh- bis Höhrorientierungschaoses nicht
übel wird] gab“ [G.P.] „zu denken. Wenn die ganze Welt chaotisch wird
[sic! respektive so
irritierend / verschreckend / empörend erscheint; O.G.J.], dann sollten wir vielleicht eine solche innere Achse
in uns selber entwickeln, um im zunehmenden [sic!] Chaos nicht unsere Orientierung [Senkrechte /
Gelassenheit – up to ‘gentleness‘] und [sic! nicht notwendigerweise mit
schwarz-weiß(-gestrefz)er Kontrastmaximierung verwechselte; O.G.J.] Klarheit zu
verlieren [sic!].

Wenn es außen keine
[denkerischen, äh bekenntnishaft
bezeugte: O.G.J.] Gewissheiten[-Götzen, äh
Prinzipien; O.G.J. solche durchsus
respektierend statt vergottend]
mehr [sic!] gibt, in denen wir zuverlässige Orientierung finden
können, dann müssen wir wohl lernen, uns auf uns selber
zu besinnen und eine innere Orientierung
suchen. Es sieht ganz so aus, als wären Eigenverantwortlichkeit und eine gute
Selbstkompetenz heute wichtiger [sic!] denn je [vgl. Peter
Claus].“
[Was/Wer
da so/wie rumläuft …] 
![]() Persönliche
Grundlagen 17 [drei didaktisch
doch/ups imperativisch formulierte,
durchaus haltungsartige Voraussetzungen (sic! – gleichwohl
zirkelschlüssig auch mit Ergebnischarakter;
O.G.J.) um ‚bewusst zu leben‘]
Persönliche
Grundlagen 17 [drei didaktisch
doch/ups imperativisch formulierte,
durchaus haltungsartige Voraussetzungen (sic! – gleichwohl
zirkelschlüssig auch mit Ergebnischarakter;
O.G.J.) um ‚bewusst zu leben‘] 
[Autobiographien/Essays
weder verzichtbar, noch hinreichend, Haltung/en (even ‘gentleness‘) ‚zu
verinnerlichen/ändern‘] 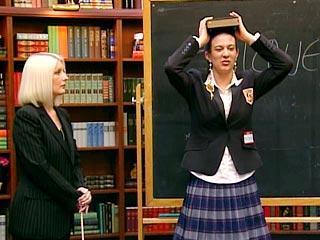 „1. Ich muss
[sic!] mich kennen.
„1. Ich muss
[sic!] mich kennen. ![]() […] Selbstreflexion [ups] öffnet diese Tür. Aber auch unsere
Reflexion im [ups] Spiegel, den uns die Umwelt jeden
Tag vorhält. Und [na klar; O.G.J. weder Deterministisches, noch
inhaltliche Beliebigkeiten, der/als Kontemplation förderbd] natürlich die
[sic!] Meditation.
[…] Selbstreflexion [ups] öffnet diese Tür. Aber auch unsere
Reflexion im [ups] Spiegel, den uns die Umwelt jeden
Tag vorhält. Und [na klar; O.G.J. weder Deterministisches, noch
inhaltliche Beliebigkeiten, der/als Kontemplation förderbd] natürlich die
[sic!] Meditation.
 [‚Spieglein, Spieglein an der Wand …‘]
[‚Spieglein, Spieglein an der Wand …‘]
 Wenn wir mit uns selber nicht wirklich gut vertraut sind, können wir auch nicht bewusst
und [ups] eigenverantwortlich leben.“ Durchaus ein lebenslanger Prozess.
Wenn wir mit uns selber nicht wirklich gut vertraut sind, können wir auch nicht bewusst
und [ups] eigenverantwortlich leben.“ Durchaus ein lebenslanger Prozess.  [Was keineswegs ausschlöße, ‚dass‘/wo Menschen so bleiben können & dürfen, wie
‚sie sind‘ / sich vorstellen bis ups inszenieren; O.G.J. auch
mit W.V.
– wider, namentlich asketische, Spiegelverbote]
[Was keineswegs ausschlöße, ‚dass‘/wo Menschen so bleiben können & dürfen, wie
‚sie sind‘ / sich vorstellen bis ups inszenieren; O.G.J. auch
mit W.V.
– wider, namentlich asketische, Spiegelverbote]
[‚Wir lieben
die Stürme,
die brausenden Wogen, der eiskalten Winde
raues Gesicht!‘]
 „2. Ich muss [sic! anknüpfende
Verwendung gewohnter Sprachformulierungen,
oder doch anerkennende Übernahe des
‚mechanischen Weltbildes‘ / hoffende Überzeugung vom Determinismus? O.G.J. ‚in
Sorge‘ vor/um ‚sei-spontan‘-Üaradoxien
mit P.W. etal.]
mich mögen.“ Und zwar so wie ich mit allem, sei. Mir
mein bester, nicht unkritischer doch prinzipiell wohlwollender Freund
sein[/werden].
„Nicht leicht, da viele die negativen [sic!
hinsichtlich omnipräsenter
Vorzeige-Sehnsüchte sind ‚positiv‘-genannte
„2. Ich muss [sic! anknüpfende
Verwendung gewohnter Sprachformulierungen,
oder doch anerkennende Übernahe des
‚mechanischen Weltbildes‘ / hoffende Überzeugung vom Determinismus? O.G.J. ‚in
Sorge‘ vor/um ‚sei-spontan‘-Üaradoxien
mit P.W. etal.]
mich mögen.“ Und zwar so wie ich mit allem, sei. Mir
mein bester, nicht unkritischer doch prinzipiell wohlwollender Freund
sein[/werden].
„Nicht leicht, da viele die negativen [sic!
hinsichtlich omnipräsenter
Vorzeige-Sehnsüchte sind ‚positiv‘-genannte ![]() allerdings nicht etwa
besser/unschädlicher; O.G.J. durchaus
mit G.P. wider mancherlei (zumal ich/wir oder eben bestimmte/diese Anderen
– das massgebliche/missionarische) Vorbild( für alle Menschenheit-Wahn] Urteile so verinnerlicht haben, dass Selbstzweifel ein Hausrecht
erworben“ hätten. „Ein Mensch, der mit
Selbstzweifeln oder Minderwertigkeitsgefühlen lebt, hat keinen sicheren Stand.
Auch eigene negative Gefühle den Eltern [bis mamchmal/manch Lehrenden
überhaupt; O.G.J. auch mit G.P.‘s
Warnungen vot Familienüberbewertungen] gegenüber spielen hierbei eine Rolle. Wir haben keine
Eltern; wir sind unsere Eltern[/Erziehenden. – Was hier dennoch weder als ‚identische
Selbsigkeit damit‘, noch als
‚individualitätsfreie, kollektiv-sippenhaftende, bis karmatische, Fortsetzung bis Verwirklichung Derselben/des
Erbes‘ oder gar als ‚Exemplare unserer
Art/Menschen‘ gemeint/genommen; O.G.J. mit ebenfalls indogenem bis und/aber
semitischen Denkweisen in ‚Generationen/Geschlechtern inklusive
Individualitäten‘]
allerdings nicht etwa
besser/unschädlicher; O.G.J. durchaus
mit G.P. wider mancherlei (zumal ich/wir oder eben bestimmte/diese Anderen
– das massgebliche/missionarische) Vorbild( für alle Menschenheit-Wahn] Urteile so verinnerlicht haben, dass Selbstzweifel ein Hausrecht
erworben“ hätten. „Ein Mensch, der mit
Selbstzweifeln oder Minderwertigkeitsgefühlen lebt, hat keinen sicheren Stand.
Auch eigene negative Gefühle den Eltern [bis mamchmal/manch Lehrenden
überhaupt; O.G.J. auch mit G.P.‘s
Warnungen vot Familienüberbewertungen] gegenüber spielen hierbei eine Rolle. Wir haben keine
Eltern; wir sind unsere Eltern[/Erziehenden. – Was hier dennoch weder als ‚identische
Selbsigkeit damit‘, noch als
‚individualitätsfreie, kollektiv-sippenhaftende, bis karmatische, Fortsetzung bis Verwirklichung Derselben/des
Erbes‘ oder gar als ‚Exemplare unserer
Art/Menschen‘ gemeint/genommen; O.G.J. mit ebenfalls indogenem bis und/aber
semitischen Denkweisen in ‚Generationen/Geschlechtern inklusive
Individualitäten‘]  Und wenn es uns nicht gelingt, sie
[derart wesentliche Bezugspersonen, müssen nicht notwendigerweise
allein/überhaupt ‚physiologisch/soziale/akademische Eltern‘ /
‚Sippenangehörige‘ (gewesen/geworden) sein; O.G.J.] wenigstens [sic! –
qualifiziert; O.G.J. mit Distanz-Einsichten/Bedarf des/am/zu Respekt/s] zu ehren,
Und wenn es uns nicht gelingt, sie
[derart wesentliche Bezugspersonen, müssen nicht notwendigerweise
allein/überhaupt ‚physiologisch/soziale/akademische Eltern‘ /
‚Sippenangehörige‘ (gewesen/geworden) sein; O.G.J.] wenigstens [sic! –
qualifiziert; O.G.J. mit Distanz-Einsichten/Bedarf des/am/zu Respekt/s] zu ehren, ![]() [Verweis G.P.‘s auf ‚Elterngebot‘] dann haben wir dort, wo unser
Selbstwertgefühl sein sollte, ein Loch.“
[Verweis G.P.‘s auf ‚Elterngebot‘] dann haben wir dort, wo unser
Selbstwertgefühl sein sollte, ein Loch.“
 [Allerdings ‚Zielverfehlungen eurer Eltern werden euch heimsuchen,
bis in die dritte, vierte Generation‘, warnt die /tora/ תורה tanachisch/apostolisch – Vergebung (gar notwendige
Änderungsbedingung) reicht nicht zur/als/statt Zielerreichung/en;
O.G.J. zumal da/soweit ‚eigentliche
Kämpfe und Schlechten‘ in der Familie stattfinden] Recht dicht
gefolgt von sonstigen
Ausbildungs-, Bezugs-
und Sozialisationsorten.
[Allerdings ‚Zielverfehlungen eurer Eltern werden euch heimsuchen,
bis in die dritte, vierte Generation‘, warnt die /tora/ תורה tanachisch/apostolisch – Vergebung (gar notwendige
Änderungsbedingung) reicht nicht zur/als/statt Zielerreichung/en;
O.G.J. zumal da/soweit ‚eigentliche
Kämpfe und Schlechten‘ in der Familie stattfinden] Recht dicht
gefolgt von sonstigen
Ausbildungs-, Bezugs-
und Sozialisationsorten. 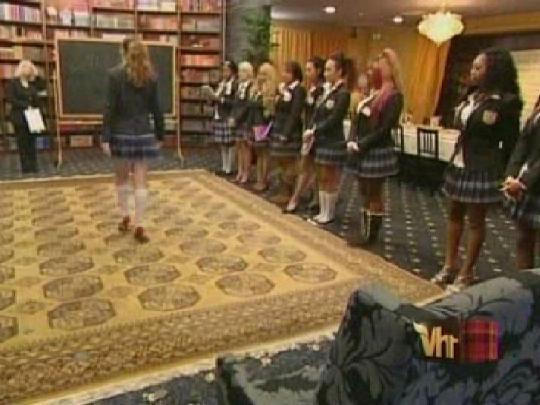 [Gentleness geübt? – Zwar bekommen Menschen weitaus
mehr als ‚Erziehung‘l respektive
‚bezugsgruppenspezifizierte Vorbilde r / Vorgängererfahrungen / Vorurteile‘, mit auf ihre Lebenswege, doch
scheint gerade diesbezügliches besonders beinflussbar/nachwirkmächtig
– gleichwohl sollte eher nicht etwa von
einem ‚unverdorbenen / eigentlichen‘ kulturfreien, antiurbanen, ‚natürlich-unberührt‘
genannten/vermeinten, gar ‚von Artifiziellem ferein‘, ‚zivilisations- äh sündefernen‘
Urzustand auszugehen / zurück zu s/wollen]
[Gentleness geübt? – Zwar bekommen Menschen weitaus
mehr als ‚Erziehung‘l respektive
‚bezugsgruppenspezifizierte Vorbilde r / Vorgängererfahrungen / Vorurteile‘, mit auf ihre Lebenswege, doch
scheint gerade diesbezügliches besonders beinflussbar/nachwirkmächtig
– gleichwohl sollte eher nicht etwa von
einem ‚unverdorbenen / eigentlichen‘ kulturfreien, antiurbanen, ‚natürlich-unberührt‘
genannten/vermeinten, gar ‚von Artifiziellem ferein‘, ‚zivilisations- äh sündefernen‘
Urzustand auszugehen / zurück zu s/wollen]

[‚Alles, zumal sich selbst, fest im Griff zu haben‘ (vgl. Mi.Fr.
‚auf ein Wort‘ mit Sa.Dö.) reicht O.G.J. zur / als
Beschreibung, des verdächtigen Bemühens,
nicht hin: auch den ‚ungeheuerlichen
Rest‘, namentlich die nächsten/ganzen anderen
Leute (nichts Geringeres als immerhin ‚den
Kaiserbau?‘ dieses Hochschlosses), beherrschen szu s/wollen]
 „3. Ich muss [sic!
ein ‚um-zu‘ also, das allerdings mit G.P. bis
O.G.J. ‚auch-unterlassen-bleiben-dürfen-muss‘ falls/da/wo Freiheit existent] mich so organisierten,
dass ich nicht zu klagen habe. Hier geht es um bewusste und eigenverantwortliche Lebensführung.
Die Inhalte dieses Buches können dabei helfen.“ [Besonders heftig/entscheidend angesichts
gerade gegenteiliger ‚um-zu klagen/leiden
(Lasten zu machen/mehren)‘-Möglichkeiten und zahlreich vorkommenden Verhaltens; O.G.J. nicht
allein literarisch/ausdrücklich mit P.W.]
„3. Ich muss [sic!
ein ‚um-zu‘ also, das allerdings mit G.P. bis
O.G.J. ‚auch-unterlassen-bleiben-dürfen-muss‘ falls/da/wo Freiheit existent] mich so organisierten,
dass ich nicht zu klagen habe. Hier geht es um bewusste und eigenverantwortliche Lebensführung.
Die Inhalte dieses Buches können dabei helfen.“ [Besonders heftig/entscheidend angesichts
gerade gegenteiliger ‚um-zu klagen/leiden
(Lasten zu machen/mehren)‘-Möglichkeiten und zahlreich vorkommenden Verhaltens; O.G.J. nicht
allein literarisch/ausdrücklich mit P.W.] 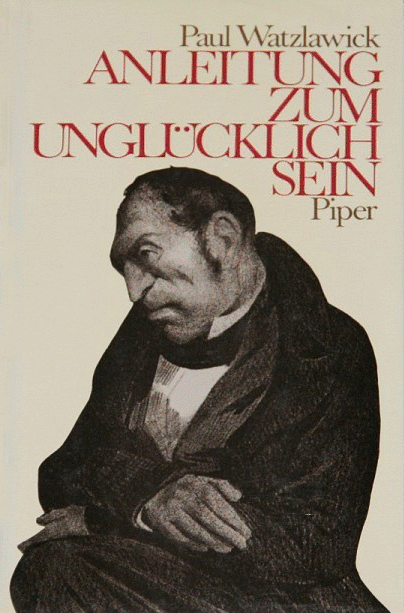 [In einer vielleicht /
hoffentlich etwas häufigeren / anderen Variante (des Beziehungsverhältnisses zwischen launisch-genannten
‚Emotionalitäten‘ und bewusst-geheißenen ‚Rationalitäten‘,
als – selbst uneingesehenen / unbemerkten, bis eben, warum/wem auch immer,
‚beabsichtigten / in Kauf genommenen‘ – Leidenssehnsüchten) erscheinen
O.G.J., namentlich mit M.v.M., die Problematiken / Phänomene, ‚des zwar
durchaus Ahnens, bis Wissen(können)s, was besser/richtig
äh nötig wäre, obwohl/während, äh im doppelten Wortsinne ‚weil‘, es dennoch verfehlt / unterbleibt / scheitert‘ – zu kurz, bis daneben greifend als: ‚Willensschwächen‘, ‚Dummheiten /
Leichtsinn‘, ‚Motivationsmängel‘, ‚schwindende Opfer- äh Leistungsbereitschaft‘ oder etwa
‚Verführung/en zur der Bosheit‘ (auch
‚moralische Fremd-/Selbst-Minderwertigkeiten‘ und weitere Vorwürfe- äh Anreizinstumentarien lassen
eilfertigst, dichotom-urteilend ‚Schuld‘ ab- äh zuweisend, grüßen) eben nicht hinreichend gehandhabt/therapiert sondern sogar auf
Dauer gestellt/erhalten bleibend]
[In einer vielleicht /
hoffentlich etwas häufigeren / anderen Variante (des Beziehungsverhältnisses zwischen launisch-genannten
‚Emotionalitäten‘ und bewusst-geheißenen ‚Rationalitäten‘,
als – selbst uneingesehenen / unbemerkten, bis eben, warum/wem auch immer,
‚beabsichtigten / in Kauf genommenen‘ – Leidenssehnsüchten) erscheinen
O.G.J., namentlich mit M.v.M., die Problematiken / Phänomene, ‚des zwar
durchaus Ahnens, bis Wissen(können)s, was besser/richtig
äh nötig wäre, obwohl/während, äh im doppelten Wortsinne ‚weil‘, es dennoch verfehlt / unterbleibt / scheitert‘ – zu kurz, bis daneben greifend als: ‚Willensschwächen‘, ‚Dummheiten /
Leichtsinn‘, ‚Motivationsmängel‘, ‚schwindende Opfer- äh Leistungsbereitschaft‘ oder etwa
‚Verführung/en zur der Bosheit‘ (auch
‚moralische Fremd-/Selbst-Minderwertigkeiten‘ und weitere Vorwürfe- äh Anreizinstumentarien lassen
eilfertigst, dichotom-urteilend ‚Schuld‘ ab- äh zuweisend, grüßen) eben nicht hinreichend gehandhabt/therapiert sondern sogar auf
Dauer gestellt/erhalten bleibend] 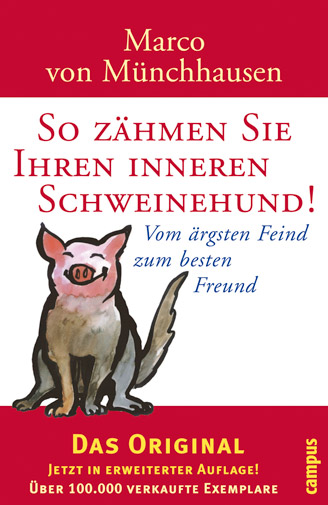
![]() Was ist Selbstkompetenz?
18 G.P. „definiere Selbstkompetenz als die Fähigkeit zu gutem
Selbstmanagement. Es ist die Kompetenz, sich selbst so zu organisieren und zu verhalten,
wie es uns selber und der gegebenen Situation entspricht[sic!].“ Das Leben
sei „so vielfältig [und vielzahlig; O.G.J. eben was
wem wann und wie entspräche,
nicht erst/nur was Reaktionen auf/in Situationen angeht,
für plural bis wandelbar, oder zumindest für strittig, haltend], „dass der Einsatzbereich der Selbstkompetenz
Was ist Selbstkompetenz?
18 G.P. „definiere Selbstkompetenz als die Fähigkeit zu gutem
Selbstmanagement. Es ist die Kompetenz, sich selbst so zu organisieren und zu verhalten,
wie es uns selber und der gegebenen Situation entspricht[sic!].“ Das Leben
sei „so vielfältig [und vielzahlig; O.G.J. eben was
wem wann und wie entspräche,
nicht erst/nur was Reaktionen auf/in Situationen angeht,
für plural bis wandelbar, oder zumindest für strittig, haltend], „dass der Einsatzbereich der Selbstkompetenz  [‚Wir sind ja der Meere schon viele gezogen und dennoch sank usere Fahne nicht.‘ –
Wogegen sich die heftigsten (da
indoeuropäischer Pluralismus-Horror) / endgültigen (da
ethische/pistische Wahrheits-Universalismen hinterfragt / gefärdet
/ entgottet) der
ganzen Proteststürme (des Heteronomismus- sowie
durchaus komplementär, statt immer passgenauem, Geführtwerdensbedarfs – nicht) erheben (müssten – wo/falls/wo
beziehungsrelationale, persönliche, innermenschliche, bis zwischenwesentliche ‚Geborgenheit/en‘ nicht durch/von
prinzipoellen Subjekt-Objekt-Beziehungen ersetzlich)]
[‚Wir sind ja der Meere schon viele gezogen und dennoch sank usere Fahne nicht.‘ –
Wogegen sich die heftigsten (da
indoeuropäischer Pluralismus-Horror) / endgültigen (da
ethische/pistische Wahrheits-Universalismen hinterfragt / gefärdet
/ entgottet) der
ganzen Proteststürme (des Heteronomismus- sowie
durchaus komplementär, statt immer passgenauem, Geführtwerdensbedarfs – nicht) erheben (müssten – wo/falls/wo
beziehungsrelationale, persönliche, innermenschliche, bis zwischenwesentliche ‚Geborgenheit/en‘ nicht durch/von
prinzipoellen Subjekt-Objekt-Beziehungen ersetzlich)]
unüberschaubar, ja schier unendlich zu sein scheint.“
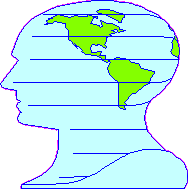 Doch System-theoretisch
lasse sich das hier zu Überblickende
auf die drei Ebenen 1. Input 2. innere Prozesse (der ‘black box‘ / des jeweiligen Menschen) und 3. Output reduzieren. Wozu G.P. in
Seminaren an der Flip-Chart eine
seiner ‚denkerischen Landkarten‘ entwickelte/verwendet.
Doch System-theoretisch
lasse sich das hier zu Überblickende
auf die drei Ebenen 1. Input 2. innere Prozesse (der ‘black box‘ / des jeweiligen Menschen) und 3. Output reduzieren. Wozu G.P. in
Seminaren an der Flip-Chart eine
seiner ‚denkerischen Landkarten‘ entwickelte/verwendet.  [„Die kompetente Handhabung von körperlichen Funktionen wie Stoffwechsel,
Flüssigkeits- und Wärmehaushalt etc. gehören natürlich[!] auch zur
Selbstkompetenz.“ Sie seien jedoch nicht G.P.‘s Fachgebiet. Zudem häbe es
„hierzu eine Menge ausgezeichneter Literatur.“]
[„Die kompetente Handhabung von körperlichen Funktionen wie Stoffwechsel,
Flüssigkeits- und Wärmehaushalt etc. gehören natürlich[!] auch zur
Selbstkompetenz.“ Sie seien jedoch nicht G.P.‘s Fachgebiet. Zudem häbe es
„hierzu eine Menge ausgezeichneter Literatur.“]
[‚Niederes Vorwerk‘
der Burgfestung Hohenzollern – hier Mnemoanalogie
des Wahrnehmens / ‚Inputs‘]
 „Die inneren Prozesse, die wir zu verwalten haben, können mental,
emotional oder auch körperlicher Natur[!] sein. Meist hängen diese drei Bereiche eng zusammen, ja
bedingen einander sogar.
„Die inneren Prozesse, die wir zu verwalten haben, können mental,
emotional oder auch körperlicher Natur[!] sein. Meist hängen diese drei Bereiche eng zusammen, ja
bedingen einander sogar.
Gemeinsam beinhalten Sie das Bewusstsein unserer eigenen Stärken und
Schwächen, unserer Zu- und Abneigungen, unserer Werte und Ziele, also der
Kräfte, die uns von innen her Sinn und Richtung im Leben geben.“
 [Bei/Trotz all seiner
wesentlichen, empirisch unterlegten, Kritik / Aufmerksamkeit vorherrschender
begrifflich-denkerischer Auf- und Zuteilungen – so sogar der antiken
Dreiteilung ‚mental – emotional - körperlich‘ –, bleibt dieser Autor O.G.J.
erkenntnisleitend zu sehr
zeitgenössisch-kulturell Etabliertem, namentlich des ‚Narueakusmus-Ideals und der ‚gnosisverdächtigen‘-Denkform ‚Geist-versus-Materie‘, ,zu Diensten‘]
[Bei/Trotz all seiner
wesentlichen, empirisch unterlegten, Kritik / Aufmerksamkeit vorherrschender
begrifflich-denkerischer Auf- und Zuteilungen – so sogar der antiken
Dreiteilung ‚mental – emotional - körperlich‘ –, bleibt dieser Autor O.G.J.
erkenntnisleitend zu sehr
zeitgenössisch-kulturell Etabliertem, namentlich des ‚Narueakusmus-Ideals und der ‚gnosisverdächtigen‘-Denkform ‚Geist-versus-Materie‘, ,zu Diensten‘] 
 Und insbesondere bemerkt der Autor zum/beim Dritten erhellend: „Der Ausdruck, die Output-Ebene,“ sei „unsere zweite Schnittsteiie zur Außenwelt. Unser
Ausdruck bekommt seine Kraft und seine Authentizität aus der bewussten und
kompetenten Handhabung der ersten beiden Bereiche (Wahrnehmung und innere
Prozesse) und nicht aus der Befolgung
vorgegebener Werte und Verhaltensschablonen. Wer aus sich selber heraus agiert
und interagiert, wird im Ausdruck klarer und überzeugender in Erscheinung
treten, als einer, der sich lediglich anpasst und
nur die entsprechenden Tools anwendet.
Und insbesondere bemerkt der Autor zum/beim Dritten erhellend: „Der Ausdruck, die Output-Ebene,“ sei „unsere zweite Schnittsteiie zur Außenwelt. Unser
Ausdruck bekommt seine Kraft und seine Authentizität aus der bewussten und
kompetenten Handhabung der ersten beiden Bereiche (Wahrnehmung und innere
Prozesse) und nicht aus der Befolgung
vorgegebener Werte und Verhaltensschablonen. Wer aus sich selber heraus agiert
und interagiert, wird im Ausdruck klarer und überzeugender in Erscheinung
treten, als einer, der sich lediglich anpasst und
nur die entsprechenden Tools anwendet.
Tools
(Hilfsmittel und Verfahren, die man lernen [sic! jedenfalls im Sinne von
‚trainieren‘: O.G.J.] kann) dienen in der Regel der Output-Optimierung. Wenn
wir uns aber einen Menschen vorstellen, der zwar alle Tools kennt, aber seine
Wahrnehmung nicht geübt hat und infolgedessen
weder
nach aussen wirklich aufmerksam, noch seine inneren Prozesse kompetent zu
verwalten in der Lage ist, so wird das Ergebnis immer recht dürftig ausfallen. Wer aus
sich selbst agiert, […] dennoch einige Tools kennt und anwendet, so wird das
für den Eindruck, den er macht,
vielleicht vorteilhaft, aber nicht ausschlaggebend sein.“ 
![]() Die Wahrnehmung 21
Die Wahrnehmung 21  „Angeblich haben wir fünf Sinne:
sehen, hören, schmecken, riechen und tasten.
„Angeblich haben wir fünf Sinne:
sehen, hören, schmecken, riechen und tasten.
Aber es gibt auch andere, subtilere
Sinne, wie unseren Sinn für Gleichgewicht,
für Temperatur, für Schmerz, für
Wohlbefinden oder Unwohlsein. Rudolf Steiner
sprach von zwölf Sinnen, von denen
er manche als „eher körperlich" und andere
als „eher geistig" bezeichnete.
Und tatsächlich, wer seine Wahrnehmung
genauer beobachtet, kann es
zunehmend schwer finden, mit den fünf Sinnen
unserer Lehrbücher auszukommen. Hier
soll uns allerdings nicht die Systematik
sondern nur der alltägliche Gebrauch
unserer Sinne beschäftigen.“
![]() Außen- und Innenwahrnehmung 21 „innen). Jonuo ist das lateinische
Wort
Außen- und Innenwahrnehmung 21 „innen). Jonuo ist das lateinische
Wort
für Schwelle, für die Grenzlinie
zwischen dem Außen und dem Innen
eines Hauses. Von dieser Schwelle
unserer Wahrnehmung aus können wir
beide Welten am besten erleben, die
äußere und die innere. Auch gleichzeitig
wie Janus. […]Manchmal jedoch,
besonders in emotionalen Situationen, kann uns diese
Janus-Perspektive abhanden kommen.
Dann wird unsere Aufmerksamkeit
entweder von innen oder von außen so
vereinnahmt, dass wir den Überblick verlieren. […]Es ist sicherlich möglich,
mit einer eingeschränkten
Wahrnehmung zu leben, indem wir uns
auf Konzepte, Theorien und
andere mentale Konstrukte verlassen.
Dennoch meine ich, dass für ein bewusstes,
eigenverantwortliches und erfülltes
Leben eine gut geschulte Wahrnehmung eine unverzichtbare Voraussetzung ist. Sie
versetzt uns in die Lage, uns selber und die Welt um uns herum bewusster und
daher auch kompetenter, zu handhaben. Dadurch steigen unsere Chancen, in
unserem Leben Erfolg und Erfüllung zu finden.'^“ [O.G.J.
erinnert dies(er Unterschied – gar zwischen ‚erfüllt Leben‘ und ‚gelebt werden‘) an das ‚biblisch
dokumentierte, zu gerne umgedeutete/missbrauchte‘ לא-Versprechen G’ttes ‚keine (anderen) Götter / Theorien /
Prinzipien / Vorgaben (als gOtt / höher und/oder
gleichrangig) neben IHM haben/halten zu müssen!‘] 
![]() Achtsamkeit 22
Achtsamkeit 22
![]() Formen der Wahrnehmung 23 Konzentration [Fokusierte Aufmerksamkeit,
[einzel]punktförmige Konzentration(sform) hier/bei O.G.J. auch als/in den roten
Uniformjacken (der/zur Optimierung der Fehlerfahndung/en), bis
‚bedingt‘/aufgehoben des Roten Salons hier, repräsentiert]
Formen der Wahrnehmung 23 Konzentration [Fokusierte Aufmerksamkeit,
[einzel]punktförmige Konzentration(sform) hier/bei O.G.J. auch als/in den roten
Uniformjacken (der/zur Optimierung der Fehlerfahndung/en), bis
‚bedingt‘/aufgehoben des Roten Salons hier, repräsentiert]
 „Der Objektbezug gilt
als wünschenswerter als ein Zustand nicht fokussierter Wahrnehmung. […]
Konzentration ist eine sehr nützliche Art der Wahrnehmung, die in vielen
Situationen unseres Lebens wertvoll ist. Die konzentrierte Wahrnehmung
ermöglicht es uns auch, zu denken [sic! was eine zwar gänige, doch fragwürdige,
Definition, also Abgrenzung / Einengung von/zu ‚Denken‘
voraussetzt/bewahrt/fördert, die zu irrigen Dichotonomien, bis Feindschaften
zuwisch der ‚Vita activa‘ versus der ‚Vita contemplativa‘ zumindest beträgt;
O.G.J. wenihstens mit Ha.Ar. bis E.B. soweit nicht auch mit neurologischen
Forschungsbedfunden]. Volle Konzentration ist ein nicht-dualistischer Zustand
des Geistes, der in bestimmten
„Der Objektbezug gilt
als wünschenswerter als ein Zustand nicht fokussierter Wahrnehmung. […]
Konzentration ist eine sehr nützliche Art der Wahrnehmung, die in vielen
Situationen unseres Lebens wertvoll ist. Die konzentrierte Wahrnehmung
ermöglicht es uns auch, zu denken [sic! was eine zwar gänige, doch fragwürdige,
Definition, also Abgrenzung / Einengung von/zu ‚Denken‘
voraussetzt/bewahrt/fördert, die zu irrigen Dichotonomien, bis Feindschaften
zuwisch der ‚Vita activa‘ versus der ‚Vita contemplativa‘ zumindest beträgt;
O.G.J. wenihstens mit Ha.Ar. bis E.B. soweit nicht auch mit neurologischen
Forschungsbedfunden]. Volle Konzentration ist ein nicht-dualistischer Zustand
des Geistes, der in bestimmten
Formen der Meditation zur Anwendung
kommt. Dort hat er sicher
seine Vorzüge, aber für die
praktischen Belange unseres täglichen Lebens ist
er eine wenig hilfreiche Form der
Wahrnehmung. Genau genommen ist volle
Konzentration ein Zustand
weitestgehender Geistesabwesenheit. Zudem kann
man mit nur einem Objekt im
Brennpunkt unserer Aufmerksamkeit auch nicht [im geläufigen
Begriffsverständnis; O.G.J.] denken.“
![]() Konzentration und Denken 24 Dazu seien
mindestens zwei Objekte erforderlich. Zudem seien nicht mehr als drei, bis
maximal vier, Aufmerksamkeitskanäle gleichzeitig offen zu halten „Alles, was über vier hinaus geht,
führt zu
Konzentration und Denken 24 Dazu seien
mindestens zwei Objekte erforderlich. Zudem seien nicht mehr als drei, bis
maximal vier, Aufmerksamkeitskanäle gleichzeitig offen zu halten „Alles, was über vier hinaus geht,
führt zu
Priorisierung und dem Verlust der
Wahrnehmung auf einem oder mehreren der
anderen Kanäle. […]Die gedankliche
Verarbeitung der Inhalte mehrerer Wahrnehmungskanäle geschieht
sequentiell, in einer logischen
Kette, einen Schritt nach dem anderen.
Diese sequentielle Arbeitsweise
macht den Geist ziemlich langsam. Sie macht es
notwendig, die Wahrnehmungen, die am
momentanen logischen Prozess nicht
beteiligt sind, fallen zu lassen und
wieder aufzunehmen, wenn sie dran sind,
berücksichtigt zu werden. Es ist
eine Art geistiges Jonglieren, was verständlich
macht, warum die Zahl der möglichen
Elemente begrenzt bleiben muss.“ Und jenseits/auerhalb davon? „Welche
Art von Wahrnehmung braucht ein
Samurai auf dem Schlachtfeld, wenn
er von 20 Gegnern umringt ist? Wie
soll ein Geschäftsmann seine vielen und
komplexen Aufgaben wahrnehmen, ohne
den Überblick zu verlieren? Wie behält
eine Mutter von mehreren Kindern den
Überblick? Würden diese Künstler
der Komplexität ihre Inputs
sequentiell (nacheinander) abarbeiten, sie wären
auf jeden Fall verloren. […] “
![]() Vom Denken zur weichen Aufmerksamkeit 26
Vom Denken zur weichen Aufmerksamkeit 26  „Ein erfolgreicher
Samurai, ob im Geschäft, im Haushalt oder auf dem Schlachtfeld,
„Ein erfolgreicher
Samurai, ob im Geschäft, im Haushalt oder auf dem Schlachtfeld,
muss einen anderen, einen weicheren,
inklusiveren Wahrnehmungs-
Modus nutzen, um die Komplexität seiner
Situation erfolgreich zu handhaben. […]Zeit für einen Ausfallschritt.“
 [Stets verbunden mit der (gar wesentlichsten)
entweder-oder-Frage dialektischer Dichotomie: Zum ‚Kampftanz‘ als
‚Ausfallschritt‘ oder beim ‚Fruchtbarkeitstanz‘ als ‚Knicks‘? Ohne die
tänzerischen Beziehungsrelationen allzu
wörtlich reduziert zu nehmen
wären; O.G.J. eingedenks der durchaus immerhin zeitweiligen Alternative
überhaupt nicht damit/miteinander zu tanzen: Radiofrage an die
„Abiturientin, was sie während ihrer Schuljahre am besten gelernt habe. Ohne
auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete sie: ‚Jederzeit und überall
intelligent und nteressiert dreinzuschauen.‘“]
[Stets verbunden mit der (gar wesentlichsten)
entweder-oder-Frage dialektischer Dichotomie: Zum ‚Kampftanz‘ als
‚Ausfallschritt‘ oder beim ‚Fruchtbarkeitstanz‘ als ‚Knicks‘? Ohne die
tänzerischen Beziehungsrelationen allzu
wörtlich reduziert zu nehmen
wären; O.G.J. eingedenks der durchaus immerhin zeitweiligen Alternative
überhaupt nicht damit/miteinander zu tanzen: Radiofrage an die
„Abiturientin, was sie während ihrer Schuljahre am besten gelernt habe. Ohne
auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete sie: ‚Jederzeit und überall
intelligent und nteressiert dreinzuschauen.‘“]
 „Niemals in all den Jahren
hat jemand gesagt, dass eine geniale Idee das alleinige Ergebnis konzentrierten
Denkens gewesen wäre. […] Jeder, der seiner Kreativität
eine Chance geben will, ist gut beraten, auch die weicheren Zustände der
Wahrnehmung zu pflegen.“
„Niemals in all den Jahren
hat jemand gesagt, dass eine geniale Idee das alleinige Ergebnis konzentrierten
Denkens gewesen wäre. […] Jeder, der seiner Kreativität
eine Chance geben will, ist gut beraten, auch die weicheren Zustände der
Wahrnehmung zu pflegen.“
 [Militärische Drillserrgants –
[Militärische Drillserrgants – ![]() erstens gelten (dieselben) Regeln (auch) für sie, und
erstens gelten (dieselben) Regeln (auch) für sie, und ![]() zweitens enden
Ausbildungslehrgäbge (weder
notwendigerweise damit es zu können und/oder
zu lieben, noch damit was zu tun)]
zweitens enden
Ausbildungslehrgäbge (weder
notwendigerweise damit es zu können und/oder
zu lieben, noch damit was zu tun)] 
„Eine der Auswirkungen unseres jahrelangen, schulischen [sic! wobei zumal eher kontemplationsfeindliche (zumal ‚individuelle‘ Intuitionen
und Inspirationen abhalten s/wollende) Trennungen um allein, alles für/auf
‚die Vita aktiva‘ in allen Lebensbereichen vorzuschreiben und durchzusetzen versucht/garantiert
wurde bis wird; O.G.J. ] Drills auf das
Denken, d.h. auf die
konzentrierte Art der Wahrnehmung,
ist, dass diejenigen, die den Drill verinnerlichen, kaum jemals
aufhören zu denken. [sic! wie zu viele bemühte Leute sich und andere
hier ‚Denken‘ verirrend zu
sagen/empfinden/verstehen pflegen; O.G.J. erleichtert über Sir Georges
Ein- bis Rücksichten:] Eigentlich ist denken nicht das
richtige Wort für[/wider]
das ständige Geplapper im Kopf [sic!
und nicht nur, bis genauer genommen überhaupt nicht, da O.G.J. mit Wittgenstein
bis Mieth sowohl Denkensverortungen im Gehirn, als auch gemeinwesentliche Gemurmel kritisierend/emtblößend]. Es ist ein kontinuierlicher
Strom von Worten und Gedanken, oft begleitet von den entsprechenden
[sic!] Emotionen und körperlichen Reaktionen. Dieses innere Geplapper hört nie
auf. Oft frage ich [G.P.] in meinen Trainings: „Ist jemand hier in der Lage,
nicht zu denken?" 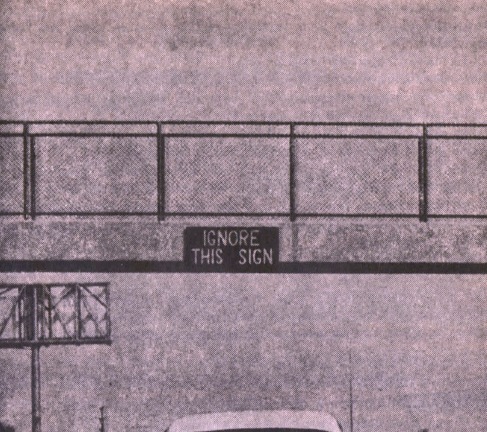 [Zudem verwechseln
genug Leite Kontemplation, und auch schon
Meditation oder Pausen, mit einem ‚Nullsummenspiel‘ der/um Lebenszeitenverwendung; O.G.J. hier mit P.W.s ‚Hienweis‘/remes solche nicht ganz los werden
zu können]
[Zudem verwechseln
genug Leite Kontemplation, und auch schon
Meditation oder Pausen, mit einem ‚Nullsummenspiel‘ der/um Lebenszeitenverwendung; O.G.J. hier mit P.W.s ‚Hienweis‘/remes solche nicht ganz los werden
zu können]
Immer
wieder bekomme ich unter den überwiegend negativen Antworten auch die Gegenfrage zu hören:„Das geht doch
gar nicht, oder?" Menschen, die nicht mehr willentlich aufhören können zu
denken [sic? ‚das/ein richtige/s Wort sei/wäre? O.G.J.], haben in sich keine Stille, keinen
geistigen [sic!] Freiraum, keine Gemütsruhe [Selbstedistanzen? O.G.J. ‚blauhumorig‘],
nur ständigen mentalen Lärm [sic! difamierende Bezeichnung ‚motivieren/werben‘
durchaus für/gegen Unterschiedeliches: O,G,.J.
didaktisch]. Es
macht sie verrückt [sic! zumindest
auch/eher ‚fügsam / manipulierbar / verfügbar‘-!/? O.G,J. auch so manche
Entspannungsabsichten bis Meditationstechniken verdächtigend],
ohne [sic!] dass sie es bemerken.“  [‚Gelobt war, was hart‘ mache – gebraucht wird
‚gerade bewegliche Härte‘ weiterhin]
[‚Gelobt war, was hart‘ mache – gebraucht wird
‚gerade bewegliche Härte‘ weiterhin] 
„Viele von uns haben einfach vergessen, wie man über das
Denken [sic!] hinaus kommt, wie man auf die weicheren Zustände der Wahrnehmung
zugreift. Wir bilden uns ein, wir müssten dazu
„abschalten". Nichts könnte falscher sein.
Denken ist ein exklusiver
Wahrnehmungszustand, in dem die meisten Wahrnehmungskanäle ohnehin abgeschaltet
sind. Anschalten ist angesagt. Die Wahrnehmung muss
[sic!] wieder geöffnet werden, nicht noch weiter geschlossen.“
![]() Wie man die weiche Aufmerksamkeit herstellt 28
Wie man die weiche Aufmerksamkeit herstellt 28 
Schritt 1: Das visuelle Panorama
Schritt 2: Das akustische Panorama
Schritt 3: Das sensorische Panorama
Lassen Sie sich Zeit, sich an die
panoramische Qualität Ihrer gleichzeitigen visuellen, akustischen und
körpedichen Wahrnehmungen zu gewöhnen.
Sie sind nun in der„Weichen
Aufmerksamkeit".
![]() Aufhören [sic!
‚benennend/bewertend‘; O.G.J.] zu denken 29
Aufhören [sic!
‚benennend/bewertend‘; O.G.J.] zu denken 29
„Wenn es Ihnen gelungen ist, dieser
Anleitung zu folgen, werden Sie bemerkt
haben, dass während der
schrittweisen Öffnung Ihrer Wahrnehmung Ihr Denken
immer mehr nachließ um schließlich ganz
aufzuhören. Durch die Überfülle
der gleichzeitigen Eindrücke aus den
drei sensorischen Panoramen ist unser
mentaler „Benenner" schlicht
überfordert. Da aber unser Denken die Namen
braucht, die wir den Dingen geben,
läuft es leer. Was bleibt ist ein stilles Gewahr-Sein[/Werden].“

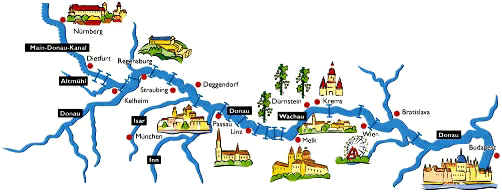 [Gemeint eigentlich/gar nicht ‚Drnken‘
sondern ‚Aufhalte-, Änderungs- bis Unterbrechungsfragen des Gedankenflusses‘]
„Aber
es wird nicht lange still bleiben. Bald wird irgend ein Reiz
Ihren Geist [sic!] stimulieren, ihn zu benennen und denkend darauf Bezug zu
nehmen. In der weichen Aufmerksamkeit können wir leicht beobachten, wie der
Geist [sic!] beim geringsten Anlass anspringt, die Bandbreite der Wahrnehmungen
reduziert und seinen Job des
objektbezogenen Denkens wieder aufnimmt, [… Nun stellt G.P. im Seminar eine
Rechenaufgabe.]
[Gemeint eigentlich/gar nicht ‚Drnken‘
sondern ‚Aufhalte-, Änderungs- bis Unterbrechungsfragen des Gedankenflusses‘]
„Aber
es wird nicht lange still bleiben. Bald wird irgend ein Reiz
Ihren Geist [sic!] stimulieren, ihn zu benennen und denkend darauf Bezug zu
nehmen. In der weichen Aufmerksamkeit können wir leicht beobachten, wie der
Geist [sic!] beim geringsten Anlass anspringt, die Bandbreite der Wahrnehmungen
reduziert und seinen Job des
objektbezogenen Denkens wieder aufnimmt, [… Nun stellt G.P. im Seminar eine
Rechenaufgabe.] ![]() Die zum Denken notwendige Reduzierung der
Bandbreite der Wahrnehmung kann dabei genau beobachtet werden. Wir können alles
in unsere weiche Aufmerksamkeit einschließen, aber wir sind außerstande in
diesem Zustand logisch zu denken, geschweige denn zu rechnen.“
Doch „mit ein bisschen Übung werden Sie
feststellen, dass die Intensität Ihrer Wahrnehmung in der weichen
Aufmerksamkeit nicht nachgelassen hat. Ganz im Gegenteil: Sie hat zugenommen.
Aber da ist kein Kommentator mehr in ihrem Geist [sic!], der Ihnen davon
erzählt. Die weiche Aufmerksamkeit ist, genau wie ihr Gegenteil (die volle Konzentration)
ein nicht-dualistischer Zustand des Geistes [sic!].
Die zum Denken notwendige Reduzierung der
Bandbreite der Wahrnehmung kann dabei genau beobachtet werden. Wir können alles
in unsere weiche Aufmerksamkeit einschließen, aber wir sind außerstande in
diesem Zustand logisch zu denken, geschweige denn zu rechnen.“
Doch „mit ein bisschen Übung werden Sie
feststellen, dass die Intensität Ihrer Wahrnehmung in der weichen
Aufmerksamkeit nicht nachgelassen hat. Ganz im Gegenteil: Sie hat zugenommen.
Aber da ist kein Kommentator mehr in ihrem Geist [sic!], der Ihnen davon
erzählt. Die weiche Aufmerksamkeit ist, genau wie ihr Gegenteil (die volle Konzentration)
ein nicht-dualistischer Zustand des Geistes [sic!].
Der zum Denken notwendige
Wahrnehmungsmodus ist eng. Das Wort eng kommt aus dem Lateinischen angustia,
die Enge. Die Angst hat den
selben Wortstamm, wie auch die angina pectoris. Angesichts des weit
verbreiteten zwanghaften Dauerdenkens und unserer Stress- und
Herzinfarkt-Statistiken ist diese Wortverwandtschaft mehr als nur
interessant."  [Stress hat – für manche erstaunlich – viel
mit Grenzfragen bis –verletzungen zu tun]
[Stress hat – für manche erstaunlich – viel
mit Grenzfragen bis –verletzungen zu tun]
[Eine/Die nicht ganz so
hohe/riskannte Kunst, wie das Mehrdeutigkeiten balancierende
Seiltanzen, bleibt das nicht-Mittige Gleichgewicht der Unformen des
Spielleutezuges, erst vollständig, mit kreativen/Zusammenhänge findenenden ‚blauen‘ und
den ‚roten‘ Teilen] 
![]() Die Balance halten 30 „Einiges von unserem zwanghaften
Dauerdenken ist sichedich hilfreich bei der Bewältigung unseres Alltags. Die meisten
dieser Gedanken allerdings sind irrelevant und unnütz. Sie füllen nur unseren
inneren Raum und lassen uns keinen Moment der Ruhe. […] Zu viel weiche
Wahrnehmung ist ebenso wenig wünschenswert, wie zu viel denkende Konzentration.
Wir müssen [sic!] unser mentales Gleichgewicht zwischen den beiden Zuständen
finden. Die weiche Achtsamkeit ist nicht irrational, sie ist transrational,
jenseits von Gedanken und Konzepten.“
Die Balance halten 30 „Einiges von unserem zwanghaften
Dauerdenken ist sichedich hilfreich bei der Bewältigung unseres Alltags. Die meisten
dieser Gedanken allerdings sind irrelevant und unnütz. Sie füllen nur unseren
inneren Raum und lassen uns keinen Moment der Ruhe. […] Zu viel weiche
Wahrnehmung ist ebenso wenig wünschenswert, wie zu viel denkende Konzentration.
Wir müssen [sic!] unser mentales Gleichgewicht zwischen den beiden Zuständen
finden. Die weiche Achtsamkeit ist nicht irrational, sie ist transrational,
jenseits von Gedanken und Konzepten.“
 [Insbesondere nicht ohne bereits/vorher
unterwegs zu sein, angefangen zu haben, antwortet einem / beschenkt einen ‚das
Leben‘ selten, bis nie mit Inspirationen/ Genialitäten; O.G.J. mit N.N. bis
P.S.]
[Insbesondere nicht ohne bereits/vorher
unterwegs zu sein, angefangen zu haben, antwortet einem / beschenkt einen ‚das
Leben‘ selten, bis nie mit Inspirationen/ Genialitäten; O.G.J. mit N.N. bis
P.S.]
![]() Geistesgegenwart 31
Geistesgegenwart 31
![]() Praktische Anwendungen der weichen Aufmerksamkeit 33
Praktische Anwendungen der weichen Aufmerksamkeit 33
![]() Die Übung der weichen Aufmerksamkeit 37
Die Übung der weichen Aufmerksamkeit 37
![]() Die Metaebene der
Wahrnehmung 39
Die Metaebene der
Wahrnehmung 39
![]() Metaebene und Bewusstsein [sic!] 41
Metaebene und Bewusstsein [sic!] 41  Klarheitsangelegenheiten: We® sich (wann
welche) Ihre®/
meiner Aufmerksamkeit/en wünsch(t)e? [Eher eine Art Gegenteil von ‚Schlafen‘,
obwohl auch ‚weiche Aufmerksamkeit‘ / Kontemplation
so aussehen, und investiert nicht so selten (gar – wann-? präzisierbar – nächtlich
verbessert) dazu beitragen, kann] Keine
Luxusangelegenheit, oder erst übrig geblieben Wahrnehmungskapazitäten vorbehalten
/ verschwended. [Ohne, hinreichende
kritische undװaber wohlwollende
/ gentle, metakognitive
Selbsrreflektion(smodi/-übung) bleibt
der / ein Mensch stets, ‚schwarz‘ und/oder ‚weiß‘(-deut- wo nicht sogar verzwecklich
verwendbar)
Klarheitsangelegenheiten: We® sich (wann
welche) Ihre®/
meiner Aufmerksamkeit/en wünsch(t)e? [Eher eine Art Gegenteil von ‚Schlafen‘,
obwohl auch ‚weiche Aufmerksamkeit‘ / Kontemplation
so aussehen, und investiert nicht so selten (gar – wann-? präzisierbar – nächtlich
verbessert) dazu beitragen, kann] Keine
Luxusangelegenheit, oder erst übrig geblieben Wahrnehmungskapazitäten vorbehalten
/ verschwended. [Ohne, hinreichende
kritische undװaber wohlwollende
/ gentle, metakognitive
Selbsrreflektion(smodi/-übung) bleibt
der / ein Mensch stets, ‚schwarz‘ und/oder ‚weiß‘(-deut- wo nicht sogar verzwecklich
verwendbar) ![]() allenfalls dazwischen (gar bis mahnisch-depressiv) abwechselnd, entweder
‚weinerlich‘ (bis suizidal)
frustriert, oder aber eben ‚so überzeugt, davon vollkommen
zu sein‘, dass
sich ‚der Rest der Welt‘
(Ihnen / Euch) anzupassen habe; O.G.J.] Manche fragen in der
Tat: “Shall / Will we curtsy?“
allenfalls dazwischen (gar bis mahnisch-depressiv) abwechselnd, entweder
‚weinerlich‘ (bis suizidal)
frustriert, oder aber eben ‚so überzeugt, davon vollkommen
zu sein‘, dass
sich ‚der Rest der Welt‘
(Ihnen / Euch) anzupassen habe; O.G.J.] Manche fragen in der
Tat: “Shall / Will we curtsy?“ ![]() „Zwar s/wollen vielleicht selbst Sie / wir ‚besser
knicksen‘ können bis dürfen; doch (zumal uns vis-a-vis / Euch selbst gegenüber) welche( Lücke)n haben / wahren רא׀יש־וו־חית anstatt Ab(- gar als An- versus Auf)stand bis צימצום bedenken / behaupten / belegen /
simulieren / üben / zeigen zu müssen.“
„Zwar s/wollen vielleicht selbst Sie / wir ‚besser
knicksen‘ können bis dürfen; doch (zumal uns vis-a-vis / Euch selbst gegenüber) welche( Lücke)n haben / wahren רא׀יש־וו־חית anstatt Ab(- gar als An- versus Auf)stand bis צימצום bedenken / behaupten / belegen /
simulieren / üben / zeigen zu müssen.“
![]() Mentale Prozesse 43
Mentale Prozesse 43 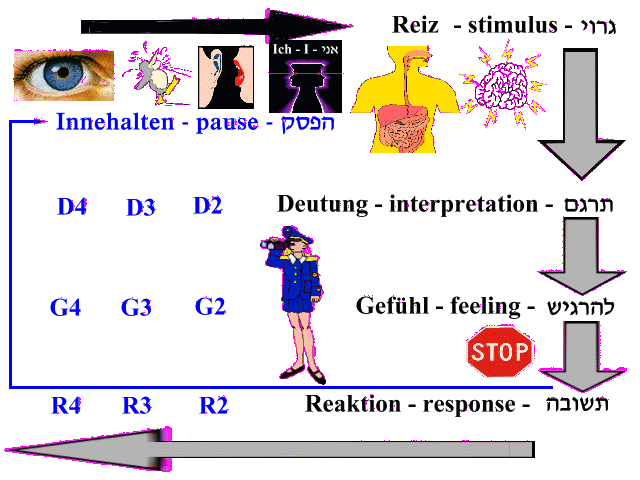 [Immerhin auf/von der ‚inneren Gartenbank‘ bekannt(lich ‚farbig‘)]
[Immerhin auf/von der ‚inneren Gartenbank‘ bekannt(lich ‚farbig‘)]
![]() Selektive Wahrnehmung 43
Selektive Wahrnehmung 43
![]() Deutung 44
Deutung 44
![]() Bewertung im Gefühl 44
Bewertung im Gefühl 44
![]() Reaktion 45
Reaktion 45
![]() Der konditionierte Reflex 46
Der konditionierte Reflex 46
![]() Innehalten 47
Innehalten 47
![]() Wahlfreiheit 50
Wahlfreiheit 50
![]() Es gibt keine „richtige" Reaktion
51
Es gibt keine „richtige" Reaktion
51
![]() Mentale Flexibilität 52
Mentale Flexibilität 52
![]() Der Umgang mit Idealen: Guter Rat für Perfektionisten
55
Der Umgang mit Idealen: Guter Rat für Perfektionisten
55
![]() Perfektionistenmobbing 57 (bis grammatikalische Reverenz anstatt
Verführung/en – folgerichtig: Abstandsfragen des Respekts)
Perfektionistenmobbing 57 (bis grammatikalische Reverenz anstatt
Verführung/en – folgerichtig: Abstandsfragen des Respekts)
![]() Wer bin ich?
Neigung, Eignung, Begabung, I*VIotivation 62
Wer bin ich?
Neigung, Eignung, Begabung, I*VIotivation 62 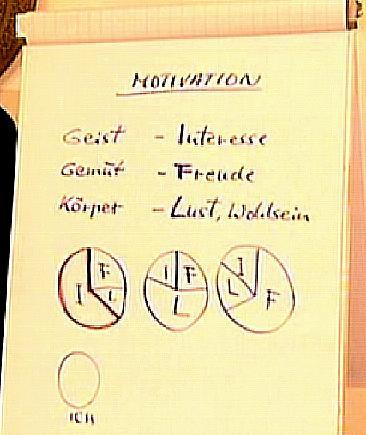 [„Eigenartig
wie das Wort
eigenartig es fast als fremdartig hinstellt eine
eigene Art zu haben.“ Erich Fried quted by G.P.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
[„Eigenartig
wie das Wort
eigenartig es fast als fremdartig hinstellt eine
eigene Art zu haben.“ Erich Fried quted by G.P.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
„Was für eine Art Mensch
bin ich? Was sind meine Begabungen? Was
motiviert
[sic!] mich? Was begeistert mich? Was stösst mich
ab? Wie finde ich meine Orientierung im Leben? Für die Beantwortung dieser Fragen hätten wir in unseren frühen
Jahren viel gegeben. Eltern stellen diese Fragen über ihre Kinder. Viele
versuchen ihre Kinder nach den eigenen Ideen
und Erwartungen zu formen, um dann festzustellen, dass das in den meisten
Fällen nicht gelingt.“
![]() Die drei Primär-Motivatoren
63
Die drei Primär-Motivatoren
63
Im
‚Selbstbeobachtungsversuch‘, was den Autor eine Woche lang motiviert habe, ergaben sich systematisierend schließlich drei
‚Zettelhaufen‘ änlicher
Antriebe:
„Der erste Motivator [sic! bei anderen Menschen steht einer der
anderen beiden, bis alle gleich weit,
vorne; mit G.P.], den
ich identifizieren konnte, war das Interesse: Neugier, das Bedürfnis,
über praktische [sic!] Dinge, die in meinem Leben eine Rolle spielten, informiert [sic! wachsende Datenkenntnis bleibt dennoch begrenzt und
genügt (zu) nicht(s); O.G.J.] zu sein, ebenso wie über Ideen, Konzepte
und Neuigkeiten fachlicher, politischer, ökonomischer, ökologischer
oder sozialer Art, der Wunsch,
ein Buch oder eine Zeitung zu lesen, mich über etwas zu erkundigen, das mit
meiner Arbeit oder meiner Familie zu tun
hatte, mich über etwas, das anderswo passierte, zu
informieren [sic!]. All
das fasste ich unter dieser Überschrift zusammen.
 [‚Nichts
ist praktischer als eine gute Theorie‘ bringt
Einsichten auf die(se)
Formel, dass / wie unsere Auffassungen / Wahrnehmungen überhaupt, weder
neutrale Kenntnisse
(‚Informationen‘-genannt, bis nicht
medienunabhängig, beliebig übertragbar), noch alternativlos
vollständig zwingend bestimmt, sondern ups gewählte, äh begründete,
handlungsnotwendigerweise – doch beeinflussbare und beeinflusst
werdende – Vereinfachungen, der/von/aus Realität/en und/oder/mindestens
dafür-Gehaltenem, bleiben]
[‚Nichts
ist praktischer als eine gute Theorie‘ bringt
Einsichten auf die(se)
Formel, dass / wie unsere Auffassungen / Wahrnehmungen überhaupt, weder
neutrale Kenntnisse
(‚Informationen‘-genannt, bis nicht
medienunabhängig, beliebig übertragbar), noch alternativlos
vollständig zwingend bestimmt, sondern ups gewählte, äh begründete,
handlungsnotwendigerweise – doch beeinflussbare und beeinflusst
werdende – Vereinfachungen, der/von/aus Realität/en und/oder/mindestens
dafür-Gehaltenem, bleiben]
Der zweite Haufen war etwas
schwieriger zusammenzufassen. Ich fand heraus,
dass ihr gemeinsamer Nenner ein sozialer Faktor war.
Ich nannte diesen Motivator Freude. Freude
ist natüdich [sic!]
etwas, was man ganz für sich alleine erleben kann. Aber
wir machen auch Anderen gerne eine Freude, wir teilen unsere Freuden gerne mit
ihnen, und wollen auch an ihren Freuden teilhaben. Freude hat definitiv einen sozialen Aspekt. Wenn ich einem Freund etwas
erzähle, das mir Freude gemacht hat, und ich sehe seine Augen aufleuchten, wenn
er es hört, verstärkt das meine eigene Freude noch einmal. Ich fand, dass viele
Dinge, die ich getan hatte, diesen sozialen Aspekt hatten. Erfahrungen mitzuteilen, Freundschaften und
Geschäftsbeziehungen zu pflegen, jemanden anzurufen oder zu besuchen, all das
warTeil meines normalen sozialen Lebens. Aber wenn ich mich fragte, was mich
dazu motiviert hatte, fand ich in diesen Aktivitäten immer wieder dieses
Element der geteilten Freude.
 [Gar nicht so wenige Leute empfinden …
sich/einander lieber überhaupt, bis intensiever, als notwendigerweise angenehm,
zumal (da wo) gegenteiliges leichter (respektive ohne den/die ander/n, sich
verweigernd könnenden, Subjekte) ereichbar erscheint]
[Gar nicht so wenige Leute empfinden …
sich/einander lieber überhaupt, bis intensiever, als notwendigerweise angenehm,
zumal (da wo) gegenteiliges leichter (respektive ohne den/die ander/n, sich
verweigernd könnenden, Subjekte) ereichbar erscheint]
Der dritte Motivator [sic!] betraf in erster Linie mein sinnlich/körpediches
Wohl-Sein: Lust. Es ging dabei nicht in erster Linie um sexuelle Lust
(um die natürlich auch), sondern um praktische
[sic!] Dinge, wie zum Beispiel um die Wahl eines bequemen Stuhles, das
Aufhängen eines Bildes an der Wand meines Schlafzimmers, das Öffnen der
Fenster, um fnsche Luft hereinzulassen, Lust auf eine kühle Dusche und meine
Auswahl von Speisen und Kleidung. Viele der Dinge, die ich während der Woche
getan hatte, waren stark lustbetont, d.h. sie dienten in erster Linie dem
Zweck, mich wohl zu fühlen [sic! jedenfalls Unwohlsein zu mindern; O.G.J.].
[…]
Der Einfachheit halber kürze ich
[G.P.] die drei pnmären Motivatoren [sic!] im Folgenden ab. I steht für Interesse bzw. intellektuelle Begabung,
F für Freude bzw. soziale
Begabung und L für Lust/Wohlsein bzw. sinnlich/sensorisch/handwerkliche Begabung.“
Alles ‚Talente‘ bis (gar Kant-ups)
‚Neigungen‘ bzw. ‚Ideocharismen/Intelligenzarten‘, die von wesentlicherer Bedeutung seien als (zumal externe)
Anreize und
Motivatopnsmaßnamen – insoweit G.P. auch mit anderen Autoren wie hier etwa M.v.M. und R.K.S.. 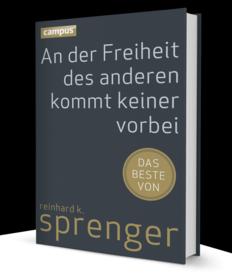
|
|
|
Intellektuelle
Interessen(orientierung),
immerhin basaler Fachkundebedürfnisse (jedenfalls für deren Befriedigung. äh ‚für |
|
|
|
Freuden(freundschafts) Interessen(orientierung), jedenfalls siziale
Intelligenz anwendend |
||
|
|
Lust Interessen(orientierung), sensorische ‚Spürigkeiten‘ wenigstens zu
Unwohlseinsminderung/-begrenzung |
||
|
Ohnehin eben alle, jeweils mehr oder minder
deutlich ausgeprägten, Michungsverhäötnisse dieser drei Aspekte als
Persönlichkeiten charakterisierend typologisierend. |
|
![]() Intrinsische Motivation 67
Intrinsische Motivation 67
![]() Jeder ist anders 69
Jeder ist anders 69
![]() Empfohlene Hausaufgaben 69
Empfohlene Hausaufgaben 69
![]() Eine kurze Überprüfung der Lebenserfüllung 70
Eine kurze Überprüfung der Lebenserfüllung 70  [Stets ist das ‚Glas
des Lebens‘ zwar voll – womit? Ist
die wesentliche Frage]
[Stets ist das ‚Glas
des Lebens‘ zwar voll – womit? Ist
die wesentliche Frage]
„“
![]() Emotionen 72
Emotionen 72
![]() Emotionen sind Energie 72
Emotionen sind Energie 72
![]() Dreierlei Herausbewegung 76
Dreierlei Herausbewegung 76
![]() E-movieren tut gut 77
E-movieren tut gut 77
![]() Schock 79
Schock 79
![]() Eine Landkarte der Emotionen 80
Eine Landkarte der Emotionen 80
![]() Gefahren emotionalen Staus 83
Gefahren emotionalen Staus 83
![]() Verschiedene Arten zu weinen 87
Verschiedene Arten zu weinen 87
![]() Ein anderer Weg:
Meditation 88
Ein anderer Weg:
Meditation 88
![]() Angst
90
Angst
90
![]() Das [sic!] Unbewusste 92
Das [sic!] Unbewusste 92 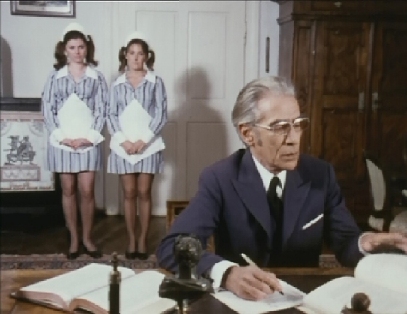 Selbst – also
‚gerade‘ optional – falls/wo es sich dabei /
‚bei welchen (Beiden / Drei / Wem)‘ / hier um
‚Unterbewusstes‘, oder gar eher um ‚Unreflektiertes / (‚warum‘
oder ‚wozu‘ auch immer)
Unreflektierbares‘, bis was
davon\dagegen sonst (noch / nicht / doch
‘unknowns‘), handeln könnte-antwortend?/./!/
Selbst – also
‚gerade‘ optional – falls/wo es sich dabei /
‚bei welchen (Beiden / Drei / Wem)‘ / hier um
‚Unterbewusstes‘, oder gar eher um ‚Unreflektiertes / (‚warum‘
oder ‚wozu‘ auch immer)
Unreflektierbares‘, bis was
davon\dagegen sonst (noch / nicht / doch
‘unknowns‘), handeln könnte-antwortend?/./!/
[Markgräfliche
Archivarbeiten – mit Personalbereitschaft]
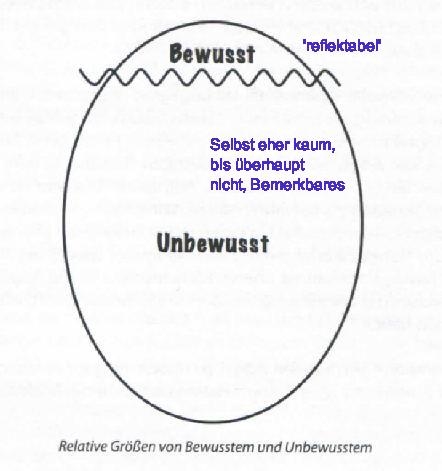 [Analogie der Geamtheit
unserer Empfindungspotenziale (namentlich
mentaler und emotionaler) in/als eine/r Eifoem vorgestellt] Wenn/wo wir auch
nur/gerade versuchsweise, gleich gar ohne davon notwendigerweise alle – außer
vielleicht jenen, die sich für ‚allwissend‘ halten (müssen oder wollen) – (gleich
gar ‚narzistisch‘) gekränkt, bis erniedrigt, zu sein/werden, dass Nichtbewuusstheit/en gegen,
[Analogie der Geamtheit
unserer Empfindungspotenziale (namentlich
mentaler und emotionaler) in/als eine/r Eifoem vorgestellt] Wenn/wo wir auch
nur/gerade versuchsweise, gleich gar ohne davon notwendigerweise alle – außer
vielleicht jenen, die sich für ‚allwissend‘ halten (müssen oder wollen) – (gleich
gar ‚narzistisch‘) gekränkt, bis erniedrigt, zu sein/werden, dass Nichtbewuusstheit/en gegen, 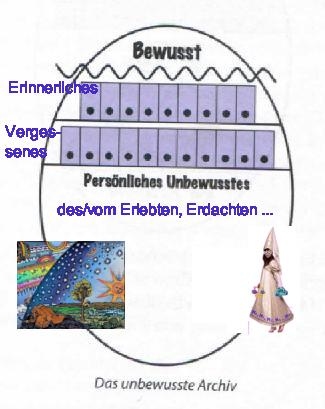 [Methaphorische Fortsetzung des Bildes, etwa
mit G.P.: ‚Lebenserfahrung‘ (gleich gar aus der aktuell reflektierenden
Erinnerung geratene) in ‚inneren Aktenordnern‘ (gleich
gar, bis, des Futurum exaktum) ‚abgelegt‘, respektive (eben
teils sogar reflektier- bis gezielt nutzbar) verwaltet vom/mit ‚innerem/n
Archivar‘]
[Methaphorische Fortsetzung des Bildes, etwa
mit G.P.: ‚Lebenserfahrung‘ (gleich gar aus der aktuell reflektierenden
Erinnerung geratene) in ‚inneren Aktenordnern‘ (gleich
gar, bis, des Futurum exaktum) ‚abgelegt‘, respektive (eben
teils sogar reflektier- bis gezielt nutzbar) verwaltet vom/mit ‚innerem/n
Archivar‘] 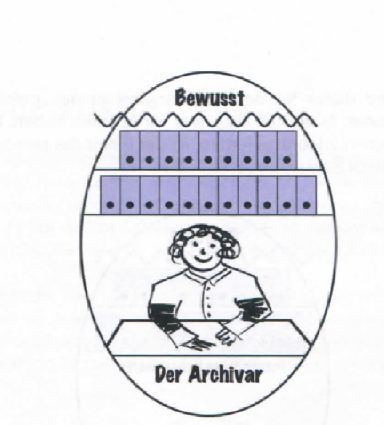
bestünden
/ eröffnen sich immerhin die beiden folgenden Einsichtsmöglichkeiten / Erklärungsoptionen (empirisch wenig bestrittener
Phänomene): Aha-Erlebnisse bis (inspirierter) Kreativität und (zumal
situativ eher unangemessene, bis permanennte) Alarmreflexreaktionen auf bestimmte Menschen/typen.  [Grenzenziehungen und gleich gar
Größenverhältnisse / Zohnen zwischen ‚Bewussheiten‘ und\aber ‚Unbewusstem‘ erweisen sich allerdings,
unter / mit / in welchen ‚namentlichen‘ Bezeichnungen auch immer, für manche
sogar erstaunlich, als unwesetlich gegenüber den denkerisch empfindenden, bis
axiomatisch setzenden, überhaupt Existenzfragen ‚beider‘, bzw. auch schon eines
davon, überhaupt]
[Grenzenziehungen und gleich gar
Größenverhältnisse / Zohnen zwischen ‚Bewussheiten‘ und\aber ‚Unbewusstem‘ erweisen sich allerdings,
unter / mit / in welchen ‚namentlichen‘ Bezeichnungen auch immer, für manche
sogar erstaunlich, als unwesetlich gegenüber den denkerisch empfindenden, bis
axiomatisch setzenden, überhaupt Existenzfragen ‚beider‘, bzw. auch schon eines
davon, überhaupt]
![]() Kreativität und Inspiration 94
Kreativität und Inspiration 94
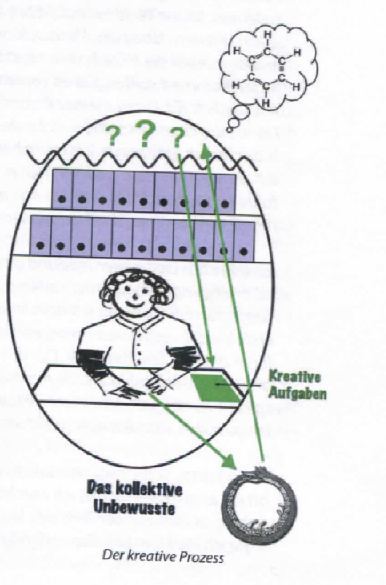 [Von so scheinbar simplen ‚Funktionen‘ und ‚Talenten‘, wie: ‚vorgesehenem Erwachen‘ (ohne
äußerliche / personelle bis technische Hilfsmittel), über
Lernvorgänge (nicht allein haptischer
Fertigkeiten, Vokabeln oder gliedernder Referatskonzeptionen – ‚im Über- gar- anstatt
reinem
[Von so scheinbar simplen ‚Funktionen‘ und ‚Talenten‘, wie: ‚vorgesehenem Erwachen‘ (ohne
äußerliche / personelle bis technische Hilfsmittel), über
Lernvorgänge (nicht allein haptischer
Fertigkeiten, Vokabeln oder gliedernder Referatskonzeptionen – ‚im Über- gar- anstatt
reinem Ver-Schlafen‘), bis zu kreativen / genialen
/ weisen An- respektive Einsichten
/ Hoffnungen, ‚Lösung(sweg)en‘ und (Argumentations-, Denkweisen-, Forschungs-, Mitteleinsatz-, Personalwahl-,
Rang- und Zielekombinatuions-)Entscheidungen
(zumal ups
nicht ohne vorherige Aneignung von Kentnissen)] Allerdings stets (also) anlasunabhängig aktivuerbare Verfügbarkeiten (mindestens) ‚beiderlei‘ Werdens-Zofem. 
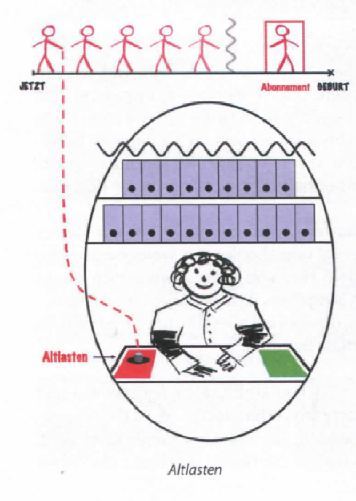 [Psychologischerweise
haben wir ein/das (Reflex-)Problem eher seltener allein/nur mit einem / bei
dem ganz bestimmten, aktuell
‚diesmaligen‘, individuell( personifiziert)en
Menschen, als eher mit einem jeden dementsprechend( erinnernd wirkend)en Typ-Mensch] Als
Anlässe zofende Erinnerungen an/von jederzeit abrufbar erlernten/gebildeten (also für ‚richtig‘ bis ‚zwingend‘ gehaltenen, soweit
selbst überhauot bemerjten)
Reaktiobsmustern.
[Psychologischerweise
haben wir ein/das (Reflex-)Problem eher seltener allein/nur mit einem / bei
dem ganz bestimmten, aktuell
‚diesmaligen‘, individuell( personifiziert)en
Menschen, als eher mit einem jeden dementsprechend( erinnernd wirkend)en Typ-Mensch] Als
Anlässe zofende Erinnerungen an/von jederzeit abrufbar erlernten/gebildeten (also für ‚richtig‘ bis ‚zwingend‘ gehaltenen, soweit
selbst überhauot bemerjten)
Reaktiobsmustern. _geradeaus_Hanni_nach_links_zum_Grafen_sehend-unverfilmt.png)
‚Dürfen / Lassen Euch, bis Ihre Gewohnheiten, jeme ‚anderen‘ Alterslasten,
äh –lagen,
fuerchten / grüßen?‘
![]() Abonnements 100
Abonnements 100
![]() Den Abonnements auf der Spur 101
Den Abonnements auf der Spur 101
![]() Die Wunden der Vergangenheit
heilen 103
Die Wunden der Vergangenheit
heilen 103  [Falls wir final
betrachtet (also angesichtes des Todesvogels der
Sterblichkeit), nicht ‚mit einem leichten Lächeln‘ auf
alles Erlebte / Erinnerte zurücksehen können
– bestehe ups Änderungsbedarf, gar inklusive umgehender Möglichkeiten dazu;
vgl. G.P. unten S. 219]
[Falls wir final
betrachtet (also angesichtes des Todesvogels der
Sterblichkeit), nicht ‚mit einem leichten Lächeln‘ auf
alles Erlebte / Erinnerte zurücksehen können
– bestehe ups Änderungsbedarf, gar inklusive umgehender Möglichkeiten dazu;
vgl. G.P. unten S. 219] 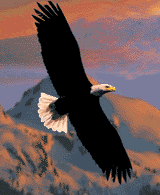
![]() Konflikte -
innen und außen 106
Konflikte -
innen und außen 106 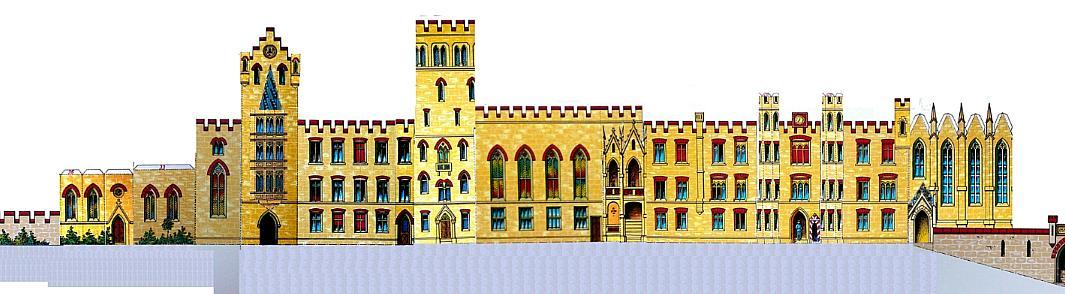
[Dass etwa ‚Innenfassaden‘, von diesem Turm aus
verborgener ‚abgewickelt‘ die hofseitige des Hochschlosses, etwas ‚äußerliches‘
haben, steht hier für, den gar kleineren, Irrtum,
beides weder immer scharf trenn zu können, noch zu sollen. 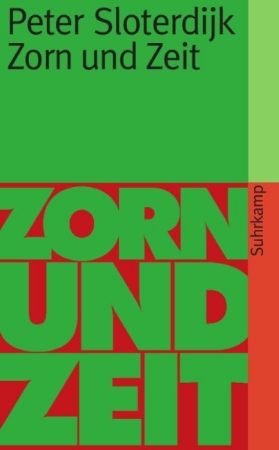 Heftiger
(so manche Antriebe, als solche, betreffend) jene
Versuchungen (welchen ‚Namens‘ auch immer) die
‚juristische Modalität / ‚Recht(sstreitigkeiten)/Gesetz‘, zumindest jedoch
Gerichtshöfe (mithin noachidische/gesellschaftsvertragliche
Gebote/Weisungen basaler Verhaltenskoordination),
überflüssig machen zu s/wollen, können
sich nicht etwa notwendigerweise/unwidersprochen auf
Jeremia 31 /et torati/ berufen]
Heftiger
(so manche Antriebe, als solche, betreffend) jene
Versuchungen (welchen ‚Namens‘ auch immer) die
‚juristische Modalität / ‚Recht(sstreitigkeiten)/Gesetz‘, zumindest jedoch
Gerichtshöfe (mithin noachidische/gesellschaftsvertragliche
Gebote/Weisungen basaler Verhaltenskoordination),
überflüssig machen zu s/wollen, können
sich nicht etwa notwendigerweise/unwidersprochen auf
Jeremia 31 /et torati/ berufen]
![]() Die Konflikt-Landkarte 109
Die Konflikt-Landkarte 109
![]() Innere Konflikte beenden 113
Innere Konflikte beenden 113 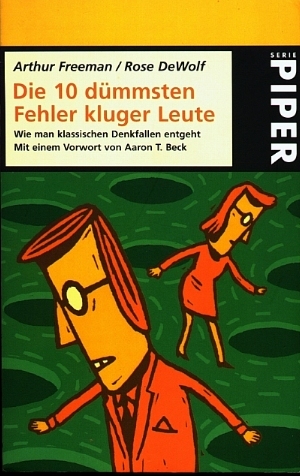 [Vergleiche insbesonder der neuten
der zehn ‚dümmsten Fehler kluger‘ Menschen]
[Vergleiche insbesonder der neuten
der zehn ‚dümmsten Fehler kluger‘ Menschen]
![]() Die drei Optionen: Love
it - Change it - Leave it 114
Die drei Optionen: Love
it - Change it - Leave it 114 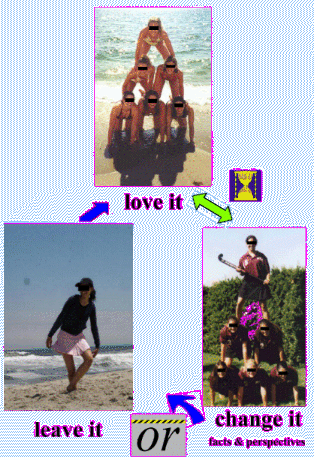
![]() Die Kraft der inneren Bilder 123
Die Kraft der inneren Bilder 123
![]() Körperliches Selbstmanagement 127
Körperliches Selbstmanagement 127 
![]() Die Intelligenz des Körpers 127
Die Intelligenz des Körpers 127
![]() 247 Arten sich zu strecken 128
247 Arten sich zu strecken 128
![]() Schlaf 132
Schlaf 132 
![]() Hilfsmittel 133
Hilfsmittel 133
![]() Kurze Pausen für Körper und [sic!]
Geist 136
Kurze Pausen für Körper und [sic!]
Geist 136
![]() Den „Home Ground"
kultivieren 138
Den „Home Ground"
kultivieren 138 
![]() Innen und außen: Das Gleichgewicht halten 139 [Abb. Balance]
Innen und außen: Das Gleichgewicht halten 139 [Abb. Balance]
![]() Sozialer Narzissmus 140
Sozialer Narzissmus 140
![]() Negative Urteile und Gefühle 143
Negative Urteile und Gefühle 143 
![]() Das Wort „nur" 148
Das Wort „nur" 148
![]() Gedanken zum Urteilen über Andere 149
Gedanken zum Urteilen über Andere 149
![]() Streit 150
Streit 150
![]() Projektion 152
Projektion 152
![]() Einsichten aus der Projektion: Yin-Yang-Tao
154
Einsichten aus der Projektion: Yin-Yang-Tao
154 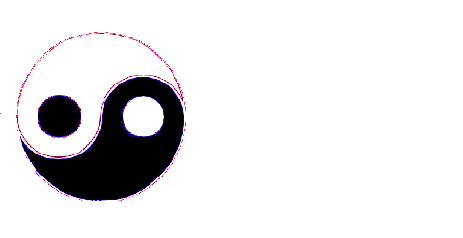
![]() Kommunikation 161
Kommunikation 161 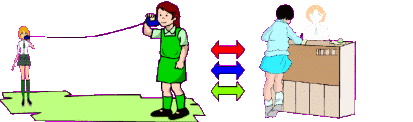
![]() Worte und innere Haltung 162 [Der zumal singuläre ‚Wert‘-Begriff,
beitbei Adams Smith immerhin ‚ökonomisch‘-konzipiert,und neueren
‚Moralphisospien‘ sind/ersetzen/garantieren keine (zumal ‚innere‘) Haltung]
Worte und innere Haltung 162 [Der zumal singuläre ‚Wert‘-Begriff,
beitbei Adams Smith immerhin ‚ökonomisch‘-konzipiert,und neueren
‚Moralphisospien‘ sind/ersetzen/garantieren keine (zumal ‚innere‘) Haltung] 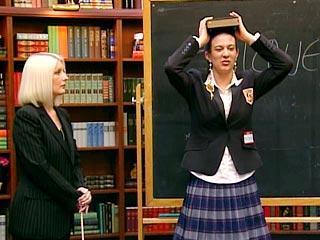
![]() Der verbale Giftschrank 163
Der verbale Giftschrank 163 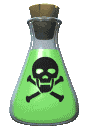
![]() Die drei Elemente eines Dialogs 165
Die drei Elemente eines Dialogs 165
![]() Geschäftliche Besprechungen 169
Geschäftliche Besprechungen 169
![]() Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist kurz 170
Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist kurz 170
![]() Die Magie des Gesprächs 171
Die Magie des Gesprächs 171
![]() Mentale Präsenz während der Kommunikation 172
Mentale Präsenz während der Kommunikation 172
![]() Die Verwaltung des inneren Raumes beim Dialog 173
Die Verwaltung des inneren Raumes beim Dialog 173
![]() Übung der Präsenz im Gespräch 175
Übung der Präsenz im Gespräch 175
![]() Ein guter Dialog 176
Ein guter Dialog 176
![]() Konfrontation 176
Konfrontation 176  [Falls
und soweit philosophisch/theologisch nicht sogar
doch ‚Konflikte-Erfahrungen‘ betreffend; O.G.J.]
[Falls
und soweit philosophisch/theologisch nicht sogar
doch ‚Konflikte-Erfahrungen‘ betreffend; O.G.J.]
Sei „sich hinstellen, sich Gehör/Respekt [sic!‘ jedenfalls‘/aber ups: ‚diesbezügliche Gefolgschaft‘ –
zumindest ‚Zugeständnisse / Vor- bis Rücksicht(en) / Entgegenkommen‘; O.G.J.
dies für weniger ‚harmlos/irritationsfrei‘ oder gar ‚(pazifistisch) machtfrei‘,
bis ‚unaufwendig / kostenlos‘ als ‚wozu
motivieren/ ermuntern S/Wollende?‘ haltend] verschaffen, jemandem Grenzen setzen, sauber [sic!
‚Sie sind nicht gezwungen, mich zu
vergewaltigen‘ drückt allerdings kaum ‚Unreines‘
aus; O.G.J. und zwar mit G.P. überzeugt von
nachhaltigen, bestenfalls ambivalenten, Wirkungen der Gefolgschaftssehnsüchte und mehrfach interessierter Fügsamkeitserziehung/en] Nein sagen... Alles Dinge, die gelegentlich unausweichlich
sind, vor denen aber viele Menschen Angst
haben. [Wie bitte? _ Ein/Mein ‚Knicks‘ als Ausdruck/Geste, bis Symbol, für/von
‚Nein!‘ לא׀אל׀אין] 
[Zwar
‚fehlt es‘ häufig/meist schon und auch ‚am Aus-‚
respektive genauer eher am ‚Eindruck‘ den ‚unsere‘ wechselseitigen ‚Bedürfnisse und dafür Gehaltenes‘ (zumal
die ‚eigenen‘ auf/für einen selbst)
machen/haben; doch genügen (wechselseitig)
hinreichende ‚Bedarfs‘- und ‚Interessen‘-Kenntnisse
hier/bei Knappheiten gerade nicht, um –
zumal konfrontativ( verteilend)e
– Aushandlungen bis Rechtsordnungsdurchsetzungen
zu ersetzen/umgehen] Kommunikation [sic!
überhaupt Interaktion/en, bis inklusive sozialer
‚Nicht-Beziehungs-Beziehungen‘; O.G.J.] ist eine Brücke, auf der wir einander näher kommen können. Das ist wahr [sic!]. Aber manchmal stellen wir fest, dass jemand uns zu
nahe tritt und [sic! vgl. Respekts(abstands)problemstellung versus
Individualdistanzfragen; O.G.J.] uns nicht mit Respekt [sic!
jedenfalls nicht mit hinreichendem ‚Individualdistanzabstand ‚inhaltlicher‘/verhaltensmäßiger
Art‘ was Forderung an / Zumutungen
für mich/Euch angeht; O.G.J.] behandelt, sondern [sic! ‚etwas‘/eine Verhaltensänderung von uns/mir wollend; O.G.J. dies
weder ‚respektlos‘ noch ‚neutral‘ oder gar ‚einfach
kleinlich‘, ‚überflüssig‘, äh ‚leicht‘, findend] unsere Freiheit beschneidet, unseren
Bewegungsspielraum behindert [sic! Des/Der Anderen
Freiheit bleibt Grenze der meinigen/unseren
– weder unveränderbar noch absolut auflöslich; O.G.J. nicht nur mit R.K.S. bis תורה].
Kommunikation [sic!
überhaupt Interaktion/en, bis inklusive sozialer
‚Nicht-Beziehungs-Beziehungen‘; O.G.J.] ist eine Brücke, auf der wir einander näher kommen können. Das ist wahr [sic!]. Aber manchmal stellen wir fest, dass jemand uns zu
nahe tritt und [sic! vgl. Respekts(abstands)problemstellung versus
Individualdistanzfragen; O.G.J.] uns nicht mit Respekt [sic!
jedenfalls nicht mit hinreichendem ‚Individualdistanzabstand ‚inhaltlicher‘/verhaltensmäßiger
Art‘ was Forderung an / Zumutungen
für mich/Euch angeht; O.G.J.] behandelt, sondern [sic! ‚etwas‘/eine Verhaltensänderung von uns/mir wollend; O.G.J. dies
weder ‚respektlos‘ noch ‚neutral‘ oder gar ‚einfach
kleinlich‘, ‚überflüssig‘, äh ‚leicht‘, findend] unsere Freiheit beschneidet, unseren
Bewegungsspielraum behindert [sic! Des/Der Anderen
Freiheit bleibt Grenze der meinigen/unseren
– weder unveränderbar noch absolut auflöslich; O.G.J. nicht nur mit R.K.S. bis תורה]. 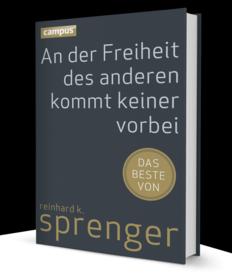 Das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Wir müssen
[sic! eher selten eine ‚einfache‘ Aufgabe? O.G.J.
sehr individualistische sowie typische Unterschiede beobachtend: Was – welche
Verletzungen, Verstöße …, welches Aussehen, Klingen, Reden …
Ding/Ereignis/Wesen – einen wann, wozu ‚an- bis
aufregt] nur ein Auge
darauf haben, und wenn es uns zu viel wird, unsere :Bedürfnisse
zum Ausdruck bringen und den Übergriffen(!) Anderer
Grenzen setzen.
Das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Wir müssen
[sic! eher selten eine ‚einfache‘ Aufgabe? O.G.J.
sehr individualistische sowie typische Unterschiede beobachtend: Was – welche
Verletzungen, Verstöße …, welches Aussehen, Klingen, Reden …
Ding/Ereignis/Wesen – einen wann, wozu ‚an- bis
aufregt] nur ein Auge
darauf haben, und wenn es uns zu viel wird, unsere :Bedürfnisse
zum Ausdruck bringen und den Übergriffen(!) Anderer
Grenzen setzen.
In
solchen Fällen ist unser Ausdruck
immer
[sic! ‚Bitten‘ zumal solche um ‚Verzeihung‘, bis
qualifizierte ‚Vergebung‘, kommen
zumindest nicht allen Leuten immer nur kooperativ vor; sie können jedoch
durchaus gegenteiliges meinen und/oder
bewirken; O.G.J.] eine
Konfrontation. Der Andere
meint vielleicht, dass sein Verhalten
in Ordnung sei, aber wir
sind damit nicht
glücklich. Wenn wir ihm das sagen wollen [sic! bis ‚müssten‘;
O.G.J.], können wir
nicht anders [sic! zumindest
kommen einem manche der, ja vielleicht doch, Alternativen, etwa von ‚Selbstaufgaberisiken
/ deutlich überzogen( knicksend/weinend)er Unterwerfung‘,
bis zu( hingenommene)r ‚Vorherrschaft der
Dummheit‘ (um-zu …), wenigstens zunächst, wenig
wünschenswert, oder zu philosiphisch/theologisch-fremd,
vor. – Immerhin (weitergehende/s als?) G.P.‘s unten vorgeschlagene ‚Bitten‘ mögen der aufmerksamkeitsökonomischen ‚arroganten
Lust an der (na klar, ‚eindeutig-verteidogenden? Gegen‘-)Provokation‘ entgegen ‚vorandrohen‘; O.G.J.], als den Anderen
zu konfrontieren.
 [Die so zwar durchaus mögliche, statt gerade
nur so notwendige, Konsequenz der Grund-These: dass Emotionen, energetischen
Phänomenen ähnlich, bewegen (‚wollen‘), legt tauschhändlerisch-kompensatorische,
bis verbrauchsorientierte /
abnutzungsgefährdete, eben buchhalterisch-haushaltende
Vorstellungen/Handhabungen (zumal etwa von/über
‚Toleranz‘, ‚Entspannung/Erholung‘, Geduld, Gelassenheit, Humor etc., bis gleich gar
Liebe – als/da ‚endlich‘) bedenklich nahe.
– Wie sie zudem jedoch – naturwissenschaftlich allerdings widerlegten – Nerven-Erklärungen des 19. Jahrhunderts/Mechanischen Weltbildes mit/in
‚Kochtopfdruck‘-Assoziationen zu verdanken/verdenken
sind]
[Die so zwar durchaus mögliche, statt gerade
nur so notwendige, Konsequenz der Grund-These: dass Emotionen, energetischen
Phänomenen ähnlich, bewegen (‚wollen‘), legt tauschhändlerisch-kompensatorische,
bis verbrauchsorientierte /
abnutzungsgefährdete, eben buchhalterisch-haushaltende
Vorstellungen/Handhabungen (zumal etwa von/über
‚Toleranz‘, ‚Entspannung/Erholung‘, Geduld, Gelassenheit, Humor etc., bis gleich gar
Liebe – als/da ‚endlich‘) bedenklich nahe.
– Wie sie zudem jedoch – naturwissenschaftlich allerdings widerlegten – Nerven-Erklärungen des 19. Jahrhunderts/Mechanischen Weltbildes mit/in
‚Kochtopfdruck‘-Assoziationen zu verdanken/verdenken
sind]
Die Frage, die sich viele in einem solchen
Fall stellen, ist:„Soll ich, darf ich das?"
Oft
schon haben wir gesehen, wie sich eine harmlose [sic! allenfalls ein
‚Begegnung‘ mag einem – jenseits von Wortdefinitionsfragen – einseitig ‚harmlos‘
/ ohne einen (anderen nenneswert) betreffende
Folgen bleibend vorkommen; O.G.J. ‚Konfrontation‘ und ‚Konflikt‘ einer ‚Ent-
bis Vergegnung‘ (vgl. zumindest ‚begrifflich‘ Buber/Rosenzweig) zumindest
anders verstehend/auseinanderhaltend als G.P. bis
manch( gar pantheistisch)e Mystik vorschlägt] 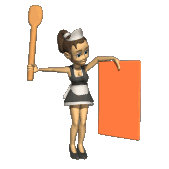 Konfrontation zu einem ausgewachsenen Konflikt
entwickelte. Das ist nicht, was wir wollen. [sic!] Also zögern wir, bevor wir uns hinstellen,
unsere Wünsche [sic! was O.G.J. nicht bloss ‚zu harmlos klingt‘] anmelden, eine Grenze setzen, nein
sagen. Dieses Zögern(!)
kann gefährlich sein, da die meisten Dinge
[sic! namentlich Gefühle und überhaupt Auffassungen, zumal von Interessen bis
Regeln wie Rechten/Pflichten; O.G.J. mit G.P. sehr viel von qualifizierten vor-Reaktions- plus
Reflektionspausen haltend], um die es dabei geht, emotionaler Natur [sic!] sind. Wenn wir uns nicht
beizeiten wehren, werden sich die Emotionen in [sic!
wem von/wo? O.G.J. wechselseitiger
gewöhnend/auf-Dauererwartungen-stellend ritualisiert sehend/denkend: ‚zwischen‘] uns hochschaukeln und inneren
[sic!] Druck aufbauen, bis wir schließlich so geladen sind, dass wir
nicht mehr [sic!] fähig
sind, die Sache auf eine ruhige und sachliche Weise zu handhaben. [sic!
welch fragwürdig( geworden)es Ideal emotionslos-ruhiger,
sachlich-objektartig-brav( gebildet)er, unbetroffen-distanzierter, nüchtern-rationaler
(falls/soweit nicht verachtend/ablehnender, respektive
tabubruchanfällig/popularisierbar) Handhabungsillusion von – dies/so zumal
mit/nach G.P. nicht seienden – Gefühlen und Betroffenheit/en; O.G.J. als großer
Freund/Anhänger von Affektkontrolle/n, zvilisatorisch begrenzten
Interaktionsregeln des Umgangs mit- bis zumal gegeneinander, und für
angemessenen Einsatz des gesamten Ausdruckswerkzeugkastens / -spektrums von und
mit G.P.] Unter solchen
[sic!] Umständen können auch
kleine [sic!] Konfrontationen
außer Kontrolle geraten.
Konfrontation zu einem ausgewachsenen Konflikt
entwickelte. Das ist nicht, was wir wollen. [sic!] Also zögern wir, bevor wir uns hinstellen,
unsere Wünsche [sic! was O.G.J. nicht bloss ‚zu harmlos klingt‘] anmelden, eine Grenze setzen, nein
sagen. Dieses Zögern(!)
kann gefährlich sein, da die meisten Dinge
[sic! namentlich Gefühle und überhaupt Auffassungen, zumal von Interessen bis
Regeln wie Rechten/Pflichten; O.G.J. mit G.P. sehr viel von qualifizierten vor-Reaktions- plus
Reflektionspausen haltend], um die es dabei geht, emotionaler Natur [sic!] sind. Wenn wir uns nicht
beizeiten wehren, werden sich die Emotionen in [sic!
wem von/wo? O.G.J. wechselseitiger
gewöhnend/auf-Dauererwartungen-stellend ritualisiert sehend/denkend: ‚zwischen‘] uns hochschaukeln und inneren
[sic!] Druck aufbauen, bis wir schließlich so geladen sind, dass wir
nicht mehr [sic!] fähig
sind, die Sache auf eine ruhige und sachliche Weise zu handhaben. [sic!
welch fragwürdig( geworden)es Ideal emotionslos-ruhiger,
sachlich-objektartig-brav( gebildet)er, unbetroffen-distanzierter, nüchtern-rationaler
(falls/soweit nicht verachtend/ablehnender, respektive
tabubruchanfällig/popularisierbar) Handhabungsillusion von – dies/so zumal
mit/nach G.P. nicht seienden – Gefühlen und Betroffenheit/en; O.G.J. als großer
Freund/Anhänger von Affektkontrolle/n, zvilisatorisch begrenzten
Interaktionsregeln des Umgangs mit- bis zumal gegeneinander, und für
angemessenen Einsatz des gesamten Ausdruckswerkzeugkastens / -spektrums von und
mit G.P.] Unter solchen
[sic!] Umständen können auch
kleine [sic!] Konfrontationen
außer Kontrolle geraten.
![]() Es ist wichtig, dass
wir unsere Angst [sic!] vor Konfrontationen verlieren
[sic! ‚in/mit/zu/durch Respektsabstandwahrung/-entwicklung‘ könnte deren
‚warnende Leitfunktionen‘, wie sie/die G.P. hervorhebt, aufbewahrend höherverschachtelt
erhalten/zutreffend verstehen lassen; O.G.J.] und sie anpacken, bevor wir emotional werden.
Schließlich greifen wir damit niemanden an
Es ist wichtig, dass
wir unsere Angst [sic!] vor Konfrontationen verlieren
[sic! ‚in/mit/zu/durch Respektsabstandwahrung/-entwicklung‘ könnte deren
‚warnende Leitfunktionen‘, wie sie/die G.P. hervorhebt, aufbewahrend höherverschachtelt
erhalten/zutreffend verstehen lassen; O.G.J.] und sie anpacken, bevor wir emotional werden.
Schließlich greifen wir damit niemanden an 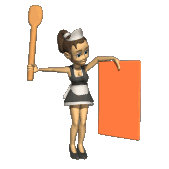 [sic! zumindest stören (meine/unsere)
Widerstände des/der Anderen
Vorgehen, Ruhe, Absichten, Konzentration, ‘flow‘/Schwung, Rutine/Gewohnheit pp.; O.G.J.
solches seinerseits nur/noch zu gerne ‚als Angriff empfindend/deutend‘], sondern machen nur(!) klar, dass wir hier sind und gewisse Vorlieben, Abneigungen
und Rechte(!) haben,
die der Andere berücksichtigen soll. Schuldgefühle
sind dabei [sic! ups allerdings
wechselseitig unterstellend/erwartend (namentlich, ‚dass Konfrontierte Fehler
einzugestehen bis abzuhelfen‘, ‚Konfrontierende, äh Geschädigte Vergebung zu
leisten‘, hätten)? O.G.J. beide Seiten/Parteien weniger kollektiv, als Individuen
ansehend/adressierend und Kenntnisse bis (auch unaufgeforderte) Einhaltungen
gesellschaftlicher Normen erwartend/zumutend]
[sic! zumindest stören (meine/unsere)
Widerstände des/der Anderen
Vorgehen, Ruhe, Absichten, Konzentration, ‘flow‘/Schwung, Rutine/Gewohnheit pp.; O.G.J.
solches seinerseits nur/noch zu gerne ‚als Angriff empfindend/deutend‘], sondern machen nur(!) klar, dass wir hier sind und gewisse Vorlieben, Abneigungen
und Rechte(!) haben,
die der Andere berücksichtigen soll. Schuldgefühle
sind dabei [sic! ups allerdings
wechselseitig unterstellend/erwartend (namentlich, ‚dass Konfrontierte Fehler
einzugestehen bis abzuhelfen‘, ‚Konfrontierende, äh Geschädigte Vergebung zu
leisten‘, hätten)? O.G.J. beide Seiten/Parteien weniger kollektiv, als Individuen
ansehend/adressierend und Kenntnisse bis (auch unaufgeforderte) Einhaltungen
gesellschaftlicher Normen erwartend/zumutend]  nicht angebracht. Woher soll der Andere [sic!] denn wissen, dass er eine Grenze
überschreitet, wenn wir [sic! ich/Du; Ma.Bu.] es ihm(!) nicht sagen?
nicht angebracht. Woher soll der Andere [sic!] denn wissen, dass er eine Grenze
überschreitet, wenn wir [sic! ich/Du; Ma.Bu.] es ihm(!) nicht sagen? 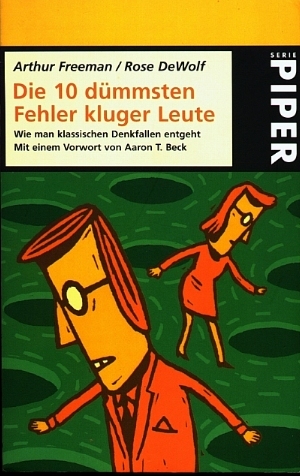 [Es gehört zu den
zehn dümmsten/häufigsten Fehleren kluger Leute,: gedabkenlesens/gefühledeutend
‚Wissen‘ zu unterstellen wie es der/dem Anderen womit/warum/wann ergeht]
[Es gehört zu den
zehn dümmsten/häufigsten Fehleren kluger Leute,: gedabkenlesens/gefühledeutend
‚Wissen‘ zu unterstellen wie es der/dem Anderen womit/warum/wann ergeht]
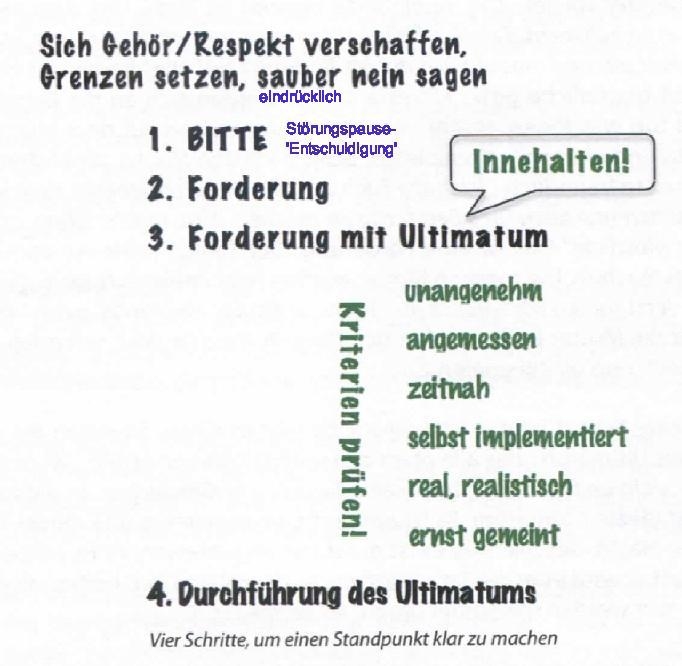 G.P. empfiehlt s/ein vierstufiges Vorgehen um ‚sauber‘-genannt eindrücklich
bis mit Erfolgsaussichten ‚Nein‘-zu-sagen,
Grenzen klar / deutlich
zu setzen, respektive sich (gar zu gerne
mit Gefolgschaft verwechselte /
gleichgesetzte) Aufmerksamkeit zu
verschaffen:
G.P. empfiehlt s/ein vierstufiges Vorgehen um ‚sauber‘-genannt eindrücklich
bis mit Erfolgsaussichten ‚Nein‘-zu-sagen,
Grenzen klar / deutlich
zu setzen, respektive sich (gar zu gerne
mit Gefolgschaft verwechselte /
gleichgesetzte) Aufmerksamkeit zu
verschaffen:
Die erste,
bei Sir George (invited in[!to] The Royal Box), auf ‚höfliches Bitten‘ reduzierte Stufe setzt eines der
häufig sogenannten ‚Wunderwörter‘ ein, und dies gleich um den / die Andere/n von meiner Position, bis Forderung, in Kenntnis zu setzen.
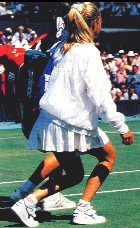
 [Das
auch hier sehr geschätze Bemühen von ‚sir George‘ geht/reicht recht tief und
weit hinauf]
[Das
auch hier sehr geschätze Bemühen von ‚sir George‘ geht/reicht recht tief und
weit hinauf]  [Obwohl
– nein, gerade will ich
Top-Star auf dem heiligen Tennisrasen … Der Hut-besetzen ‘royal box‘(!) zu Wimbledon stand bekanntlich,
bis 2003 die Höflichkeitsbezeugung eines Hofknicks
bzw. Dieners, auch der Spielerinnen und Spieler, zu – seither ‚nur‘ noch falls
bestimmte Personen dort anwesend wären] ‚Wollen Sie mich demütigen/blockieren?‘ oder ‚Darf
ich (‚bitte‘ statt ‚vielleicht‘)
passieren?‘ scheinen (gar eifrig/erzieherisch, bis Schuld zuweisen
s/wollend) gemeint/erwartet/deutbar.
Auch ein: ‚Danke, dass Sie
künftig nicht mehr auf meinem Parkplatz stehen,‘ setzt ja nicht
notwendigerweise voraus, dass es sich überhaupt um meinen Parkplatz (oder
das Fahrzeug / ‚Vergehen‘ der angesprochen Person) handelt. An diesem Beispiel zeigt sich ferber
eine häufig erhebliche Differenz zwischen amtlicher Straßenverkehrsordnung und
der Auffassung, gleich gar von Anwohnern, was deren Rechte im öffentlichen
Parkraum angeht.
[Obwohl
– nein, gerade will ich
Top-Star auf dem heiligen Tennisrasen … Der Hut-besetzen ‘royal box‘(!) zu Wimbledon stand bekanntlich,
bis 2003 die Höflichkeitsbezeugung eines Hofknicks
bzw. Dieners, auch der Spielerinnen und Spieler, zu – seither ‚nur‘ noch falls
bestimmte Personen dort anwesend wären] ‚Wollen Sie mich demütigen/blockieren?‘ oder ‚Darf
ich (‚bitte‘ statt ‚vielleicht‘)
passieren?‘ scheinen (gar eifrig/erzieherisch, bis Schuld zuweisen
s/wollend) gemeint/erwartet/deutbar.
Auch ein: ‚Danke, dass Sie
künftig nicht mehr auf meinem Parkplatz stehen,‘ setzt ja nicht
notwendigerweise voraus, dass es sich überhaupt um meinen Parkplatz (oder
das Fahrzeug / ‚Vergehen‘ der angesprochen Person) handelt. An diesem Beispiel zeigt sich ferber
eine häufig erhebliche Differenz zwischen amtlicher Straßenverkehrsordnung und
der Auffassung, gleich gar von Anwohnern, was deren Rechte im öffentlichen
Parkraum angeht.
Gerade/Sogar
behördliche Verwaltungsakte sind, in Widerspruchsverfahren auch auf deren
‚materielle‘ (das heißt: ‚inhaltlich sachverhaltliche‘) Richtigkeit hin zu überprüfen; da selbst-ups Hoheitsträger
zu irren gelernt haben sollten. 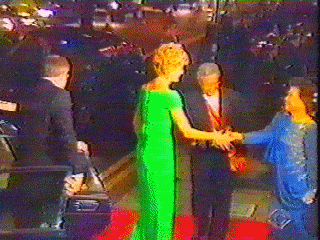 [Zudem sind Menschen wie G.P. zeigt selten
bzw. eher kurzzeitig aufmerksam genug ‚meine Bitte/Forderung‘ sofort,
vollständig ‚wahrzunehmen‘ – davon/dadurch aber zumindest irritierbar
gestärt/unterbrochen, bis durchaus eben ‚konfrontiert‘. Was klassischerweise
Interaktionsaufnamebis –unterbrechungs-Grußgesten, und\aber
dies nicht allein verbaler Arten. zu handhaben erleichtern, statt etwa
‚Inhalte‘ oder ‚Konfrontationen/Konflikte‘ ersetzen]
[Zudem sind Menschen wie G.P. zeigt selten
bzw. eher kurzzeitig aufmerksam genug ‚meine Bitte/Forderung‘ sofort,
vollständig ‚wahrzunehmen‘ – davon/dadurch aber zumindest irritierbar
gestärt/unterbrochen, bis durchaus eben ‚konfrontiert‘. Was klassischerweise
Interaktionsaufnamebis –unterbrechungs-Grußgesten, und\aber
dies nicht allein verbaler Arten. zu handhaben erleichtern, statt etwa
‚Inhalte‘ oder ‚Konfrontationen/Konflikte‘ ersetzen]
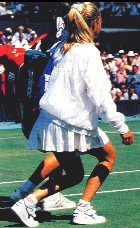 [Zumindest nach dem (Ende), zu Beginn und bei Regen-Unterbrechungen
des Spiels / der Interaktion, vor/von hoheitlichen (Spiel-)Regeln zivilisatorisch, synchronisierte Knicks-Reverenz
beteiligter ‚Kampftänzerinn/en‘]
‚Bitten‘ – gleich gar durch (zumal
‚innerlich‘/virtuell zu nennende/machende)
Knickse / Respektsabstanderhöhungen bei der Annäherung, qualifizierte, einen
also zumindest Mut kostende / demütigende (statt:
etwa ‚kleiner‘, oder ‚unterwürfig machende‘) – mögen/scheinen (allerdingst immer/überall: vgl. die diesbezügliche Klage des
Priesters im Alten Ägypten) ‚aus der ‚Mode‘/Übung gekommen zu sein; sie
haben gar/zumindest von/an ihre/r Tarnfunktionen / Erleichterung der Zumutung
einer Forderung zur Verhaltensänderung entgegen-
bis nachzukommen eingebüßt: So dass viele Menschen keinen hinreichenden
Unterschied zwischen der ‚Höflichkeits- bis Unverschämtheitsform‘ der unausweichlichen
Verpackung und\aber dem, mehr oder minder zumutbaren, ‚materiellen Inhalt Eurer/meiner Forderung, bis Existenz(berechtigung)‘ zu machen, zu haben und/oder zu erkennen
vermögen/bereit sind – und solch peinliche Einsichten gleich gar (noch immer und weiterhin) nicht
gezwungen werden können/müssen.
[Zumindest nach dem (Ende), zu Beginn und bei Regen-Unterbrechungen
des Spiels / der Interaktion, vor/von hoheitlichen (Spiel-)Regeln zivilisatorisch, synchronisierte Knicks-Reverenz
beteiligter ‚Kampftänzerinn/en‘]
‚Bitten‘ – gleich gar durch (zumal
‚innerlich‘/virtuell zu nennende/machende)
Knickse / Respektsabstanderhöhungen bei der Annäherung, qualifizierte, einen
also zumindest Mut kostende / demütigende (statt:
etwa ‚kleiner‘, oder ‚unterwürfig machende‘) – mögen/scheinen (allerdingst immer/überall: vgl. die diesbezügliche Klage des
Priesters im Alten Ägypten) ‚aus der ‚Mode‘/Übung gekommen zu sein; sie
haben gar/zumindest von/an ihre/r Tarnfunktionen / Erleichterung der Zumutung
einer Forderung zur Verhaltensänderung entgegen-
bis nachzukommen eingebüßt: So dass viele Menschen keinen hinreichenden
Unterschied zwischen der ‚Höflichkeits- bis Unverschämtheitsform‘ der unausweichlichen
Verpackung und\aber dem, mehr oder minder zumutbaren, ‚materiellen Inhalt Eurer/meiner Forderung, bis Existenz(berechtigung)‘ zu machen, zu haben und/oder zu erkennen
vermögen/bereit sind – und solch peinliche Einsichten gleich gar (noch immer und weiterhin) nicht
gezwungen werden können/müssen.  [„Ciao (was venexianisch dereinst immerhin als inflationär
abgekürtzte Form / ‘curtsy‘ für ‚Ihre/Eure Sklavin‘
zu übersetzen war, ubd bekanntlich kein
bloßer Abschiedsgruß wurde) könnten Sie
bitte, mir/unserer Beziehung zuliebe, gefälligst endlich das (Gelegenheits-)Fenster …“ – läßt hier sowohl wechselseotige
Respeltsmissverständnisse als auch den Irrtum erahnen: ‚Respekt‘ sei ein
anderes Wort für ‚Gefolgschaft‘]
[„Ciao (was venexianisch dereinst immerhin als inflationär
abgekürtzte Form / ‘curtsy‘ für ‚Ihre/Eure Sklavin‘
zu übersetzen war, ubd bekanntlich kein
bloßer Abschiedsgruß wurde) könnten Sie
bitte, mir/unserer Beziehung zuliebe, gefälligst endlich das (Gelegenheits-)Fenster …“ – läßt hier sowohl wechselseotige
Respeltsmissverständnisse als auch den Irrtum erahnen: ‚Respekt‘ sei ein
anderes Wort für ‚Gefolgschaft‘]
 [Zumal dies war früher auch nicht etwa besser; KoHeLeT
– im langen Rock nicht einmal leichter] Wer sich allerdings nicht für ups
die Störung entschuldigen will, kann
und\oder darf: Eine ‚Bitte‘, bis zumal (wessen Erachtens auch immer) berechtigte Forderung, respektive gar eine Weisung /
Befehle, an bzw. für des/der Andere/n Verhalten, vor zu bringen – sollte sich ernsthaft
überlegen, ob die (eben zudem gerade wechselseitig nicht etwa kostenfreie,
sowie gerade – auch motibationslogisch definitionsgemäß – mit affirmariv
appellierenden Emotionen persönlich betreffend gemachte/entsachlichte) ‚Stufe‘ einer Interaktionshnterbrechung/Orientierungse des – noch so
höflichen/schroffen, authentischen,
sich selbst zunächst/zuerst ‚zurück nehmenden, oder eben vordrängenden‘ – Bittens
um/Einnehmens von Aufmerksamkeit, überhazpt eine situativ angemessene(!) und
hilfreich funktionieren könnende ‚Eskalations-‚ bzw. ‚Einstiegsstufe‘ in ups Verhandlungen/Kompromisse, oder
bereits/doch nur(!) eine, mehr oder minder, ‚brav/artig
betreffende‘ Forderungsformulierung, oder gar
Befehlsumschreibungm sendet/empfangen läßt – statt etwa als
Unterbrechungsverarbeitungsgelegenheit ‚deeskalierend‘ wirken zu können?
[Zumal dies war früher auch nicht etwa besser; KoHeLeT
– im langen Rock nicht einmal leichter] Wer sich allerdings nicht für ups
die Störung entschuldigen will, kann
und\oder darf: Eine ‚Bitte‘, bis zumal (wessen Erachtens auch immer) berechtigte Forderung, respektive gar eine Weisung /
Befehle, an bzw. für des/der Andere/n Verhalten, vor zu bringen – sollte sich ernsthaft
überlegen, ob die (eben zudem gerade wechselseitig nicht etwa kostenfreie,
sowie gerade – auch motibationslogisch definitionsgemäß – mit affirmariv
appellierenden Emotionen persönlich betreffend gemachte/entsachlichte) ‚Stufe‘ einer Interaktionshnterbrechung/Orientierungse des – noch so
höflichen/schroffen, authentischen,
sich selbst zunächst/zuerst ‚zurück nehmenden, oder eben vordrängenden‘ – Bittens
um/Einnehmens von Aufmerksamkeit, überhazpt eine situativ angemessene(!) und
hilfreich funktionieren könnende ‚Eskalations-‚ bzw. ‚Einstiegsstufe‘ in ups Verhandlungen/Kompromisse, oder
bereits/doch nur(!) eine, mehr oder minder, ‚brav/artig
betreffende‘ Forderungsformulierung, oder gar
Befehlsumschreibungm sendet/empfangen läßt – statt etwa als
Unterbrechungsverarbeitungsgelegenheit ‚deeskalierend‘ wirken zu können?
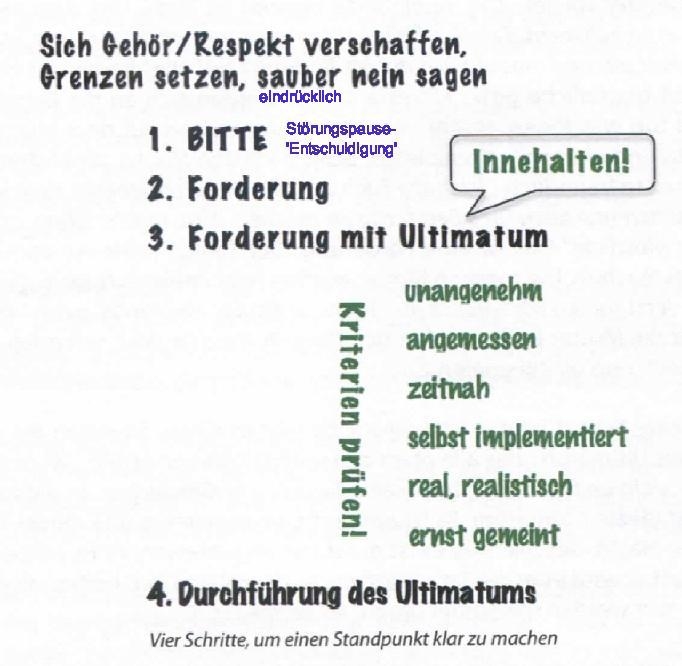 Ob als ‚zweite Stufe‘, oder schon
früh(er beschleunigen
sollend/wollend) kommt es auch, anstatt allein, auf hinreichend
deutlich klare Verständlichkeit (nicht etwa nur auf den stattdessen, da ja ‚verweigert‘
erscheinenden, ansteigenden Nachdruck) der Forderung/Weisung an –
um überhaupt ernsthaft erwarten zu dürfen, dass ihr nachgekommen werden könnte (zumal falls/wo sich deren Kenntnis nicht ‚von
selbst‘ … Sie/Euer Gnaden wissen schon um
unheimliche Unterstellungen dessen was sich wie gehöre).
Ob als ‚zweite Stufe‘, oder schon
früh(er beschleunigen
sollend/wollend) kommt es auch, anstatt allein, auf hinreichend
deutlich klare Verständlichkeit (nicht etwa nur auf den stattdessen, da ja ‚verweigert‘
erscheinenden, ansteigenden Nachdruck) der Forderung/Weisung an –
um überhaupt ernsthaft erwarten zu dürfen, dass ihr nachgekommen werden könnte (zumal falls/wo sich deren Kenntnis nicht ‚von
selbst‘ … Sie/Euer Gnaden wissen schon um
unheimliche Unterstellungen dessen was sich wie gehöre). 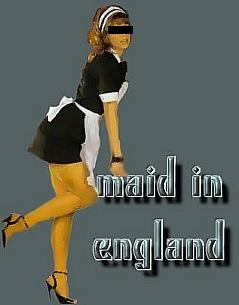 [Gerade in Konfliktlagen sind
Übersetzungskünste von MediatorInnen seltener überflüssig als abrufbar: Es
bewährt sich – für
manche, immerhin
auch/gerade Abraham, sogar
überraschend – selten nur/ausschließlich von niederen,
oberflächlichen, rücksichtslosen, dummen, käuflichen, kriminellen,
gierigen/süchtigen, sexuellen, ups
guten/richtigen, achtsamen, missverstandenen, sachlichen, altruistischen,
emotionalen/affektiven, tymotischen, fürchtigen, hierarchischen, authentischen,
inspirierten etc. ‚Motiven‘/Beweggründen (oder allein ‚dem jeweiligen Gegenteil‘)
auszugehen]
[Gerade in Konfliktlagen sind
Übersetzungskünste von MediatorInnen seltener überflüssig als abrufbar: Es
bewährt sich – für
manche, immerhin
auch/gerade Abraham, sogar
überraschend – selten nur/ausschließlich von niederen,
oberflächlichen, rücksichtslosen, dummen, käuflichen, kriminellen,
gierigen/süchtigen, sexuellen, ups
guten/richtigen, achtsamen, missverstandenen, sachlichen, altruistischen,
emotionalen/affektiven, tymotischen, fürchtigen, hierarchischen, authentischen,
inspirierten etc. ‚Motiven‘/Beweggründen (oder allein ‚dem jeweiligen Gegenteil‘)
auszugehen]
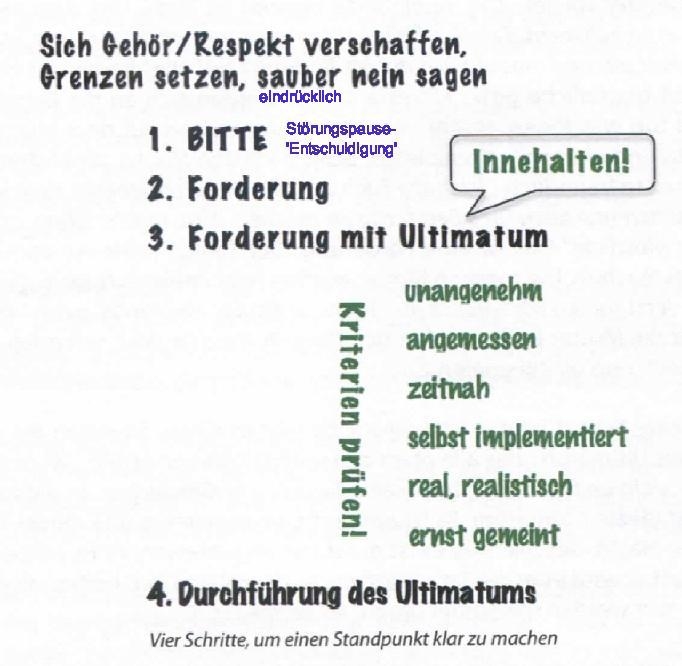 Einer der wohl
wichtigsten Punkte wirksamer Gnrenzziehungen / eindrücklichen-Nei-sagens bleibt
allerdings, sich die Eskalationsstufe des Drohens in
Ruhe und Distanzen (bzw.
bereits vorbereitend) zu überlegen, zumal G.P.‘s Kriterien für eine ‚gute‘/wirksame,
tendenziell auch für all die übrigen Motivationen-Mittel / ‚Schritte‘ wesentlich
sind. Abb, Knicks Graf-Hingis
[Gerade wer ‚recht bekommen‘/gesiegt
hat verbleibt in Beziehungsrelationen-(Macht-)Fragen(entscheidungen / -Antworten sind
stets vorläufig/nur vorübergehend): ‚Ich war für ein paar
Zeiten Dein/e Begleiter- bis Gegner/in, doch nun?‘ –
Es sind/werden Abstände …]
Einer der wohl
wichtigsten Punkte wirksamer Gnrenzziehungen / eindrücklichen-Nei-sagens bleibt
allerdings, sich die Eskalationsstufe des Drohens in
Ruhe und Distanzen (bzw.
bereits vorbereitend) zu überlegen, zumal G.P.‘s Kriterien für eine ‚gute‘/wirksame,
tendenziell auch für all die übrigen Motivationen-Mittel / ‚Schritte‘ wesentlich
sind. Abb, Knicks Graf-Hingis
[Gerade wer ‚recht bekommen‘/gesiegt
hat verbleibt in Beziehungsrelationen-(Macht-)Fragen(entscheidungen / -Antworten sind
stets vorläufig/nur vorübergehend): ‚Ich war für ein paar
Zeiten Dein/e Begleiter- bis Gegner/in, doch nun?‘ –
Es sind/werden Abstände …] 
![]() Kriterien für ein gutes Ultimatum 178
Kriterien für ein gutes Ultimatum 178
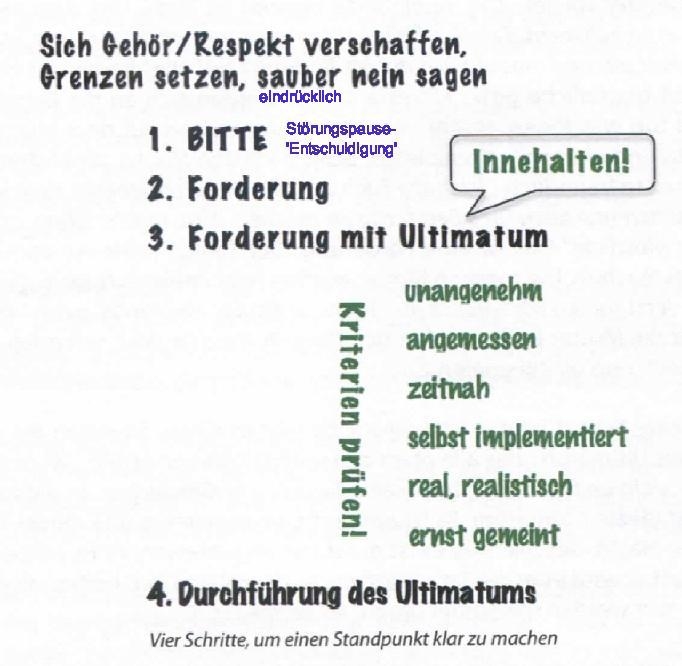
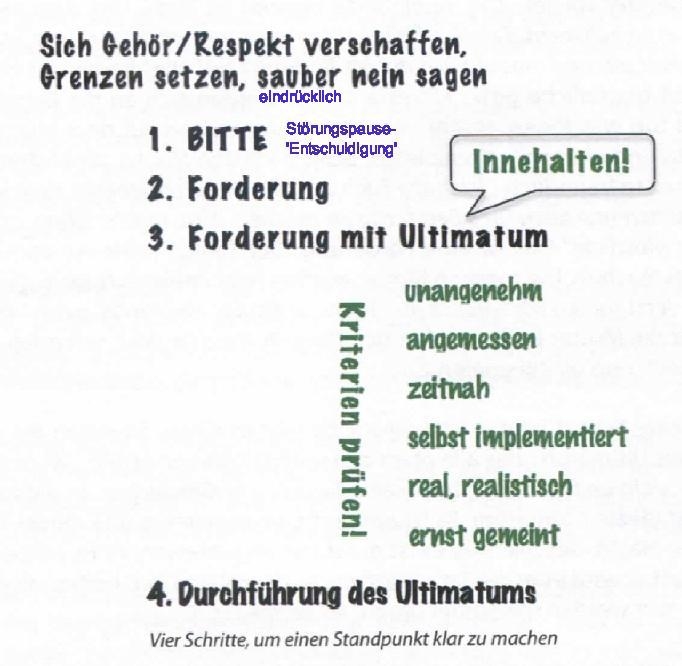 Der Schritt der
Sanktionierung bleobt/wäre allerdings der ‚eigentlich‘ wichtigste –
insbesondere was die als ‚positiv‘-zu bezeichenden angeht und als ‚Dank‘
/bewikascha/ den Ausstieg aus der Konfrontationsbeziehung erleichtert, bis erst
erlaubt, insbesondere jener / jenen Seite/n, die sich – unabhängig vom
Verhaltensergebnis sowie von den Sachverhalten – unterlegen oder überlegen
empfinden ...
Der Schritt der
Sanktionierung bleobt/wäre allerdings der ‚eigentlich‘ wichtigste –
insbesondere was die als ‚positiv‘-zu bezeichenden angeht und als ‚Dank‘
/bewikascha/ den Ausstieg aus der Konfrontationsbeziehung erleichtert, bis erst
erlaubt, insbesondere jener / jenen Seite/n, die sich – unabhängig vom
Verhaltensergebnis sowie von den Sachverhalten – unterlegen oder überlegen
empfinden ...  [Jegliche Art interaktiven
Tanzens (‚kämpfende‘ und ‚befruchtende‘ inklusive) ]
[Jegliche Art interaktiven
Tanzens (‚kämpfende‘ und ‚befruchtende‘ inklusive) ]
![]() Die Soft Skills am Arbeitsplatz 184
Die Soft Skills am Arbeitsplatz 184 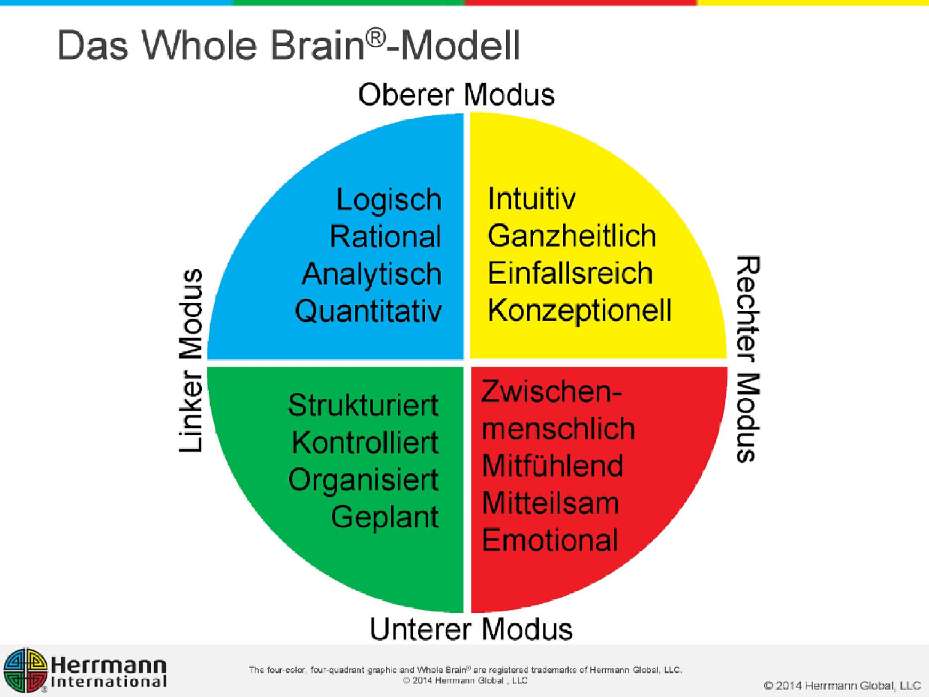
![]() Die Beurteilung der eigenen Anlagen 186
Die Beurteilung der eigenen Anlagen 186
![]() Intrinsische Motivation und Führung
187
Intrinsische Motivation und Führung
187
![]() Work-Life-Balance 188
Work-Life-Balance 188  [Glas des Lebens – stehts voll (‚Sand‘
und/oder ‚Langeweile/Sorgen &
Co.‘ drängen endlos – wo/weil/solang
nichts dagegen geschieht)]
[Glas des Lebens – stehts voll (‚Sand‘
und/oder ‚Langeweile/Sorgen &
Co.‘ drängen endlos – wo/weil/solang
nichts dagegen geschieht)]
![]() Mentale Organisation 189
Mentale Organisation 189
![]() Mentale und körperliche Belastbarkeit 190
Mentale und körperliche Belastbarkeit 190 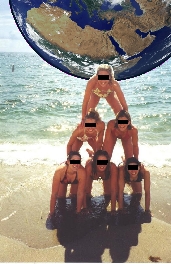
![]() Teams 192
Teams 192
![]() Kommunikation und Gesprächsführung 195
Kommunikation und Gesprächsführung 195
![]() Konfliktkompetenz 200
Konfliktkompetenz 200
![]() Führung 201
Führung 201
![]() Entscheidungen treffen 203
Entscheidungen treffen 203
![]() Kreativität 204
Kreativität 204
 Reiz-Reaktions-Verhältnisse
unabwendlich. Doch beeibflussbar-!/? [Manch merkfreundliches, holzschnittartige bis drillfähige, Vereinfachung / Wiederholung mag zu erwarten [bis ‚zu
einfach(e, äh beabsichtigte oder mitgesungene] PR‘ / medienkonform vgleiche /pschat/ stätestens gegen Verbrechen) sein]
Praktische
Übungen S. 206
Reiz-Reaktions-Verhältnisse
unabwendlich. Doch beeibflussbar-!/? [Manch merkfreundliches, holzschnittartige bis drillfähige, Vereinfachung / Wiederholung mag zu erwarten [bis ‚zu
einfach(e, äh beabsichtigte oder mitgesungene] PR‘ / medienkonform vgleiche /pschat/ stätestens gegen Verbrechen) sein]
Praktische
Übungen S. 206
![]() Die Wahrnehmung 206
Die Wahrnehmung 206
![]() Wahrnehmung und Achtsamkeit 206
Wahrnehmung und Achtsamkeit 206
![]() Aus dem [sic!] Denken aussteigen [sic!] 208
Aus dem [sic!] Denken aussteigen [sic!] 208
![]() Die Metaebenen-Wahrnehmung 208
Die Metaebenen-Wahrnehmung 208
![]() Aus konditionierten Reflexen aussteigen
208
Aus konditionierten Reflexen aussteigen
208
![]() Mentale Flexibilität 209
Mentale Flexibilität 209
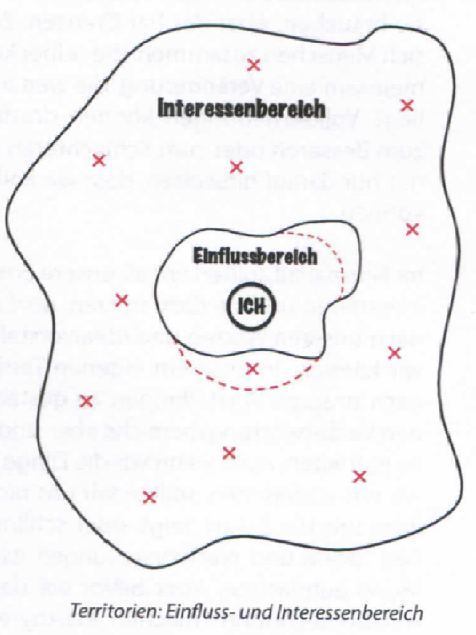 [Übergriffigkeiten bei Unfähig- bis
Unwilligkeit, Verletzungen von Individualdistanzen
–
gleich gar in guten, bis für nötig gehaltenen, Absichten –
zählen (wir hier) zu den Hauptschwierigkeoten (halten
Kriminalitätsabwehr jedoch/darüber keineswegs für sichergestellt)]
[Übergriffigkeiten bei Unfähig- bis
Unwilligkeit, Verletzungen von Individualdistanzen
–
gleich gar in guten, bis für nötig gehaltenen, Absichten –
zählen (wir hier) zu den Hauptschwierigkeoten (halten
Kriminalitätsabwehr jedoch/darüber keineswegs für sichergestellt)]
![]() Neigung [Ne.He.s ich-Quadranten],
Motivation [G.P.s
Trias und\aber M.v.M.s
Schweinehundewesen],
Talent 209
Neigung [Ne.He.s ich-Quadranten],
Motivation [G.P.s
Trias und\aber M.v.M.s
Schweinehundewesen],
Talent 209
![]() Emotionen 210
Emotionen 210
![]() Das Unbewusste 211 „Überprüfen Sie, ob Sie eine Altlast
mit sich herumtragen, z.B.
einen inneren Konflikt mit irgendeinem Aspekt Ihrer
Vergangenheit.
[…] Aber stellen Sie sicher, dass er/sie nicht länger als nötig dafür braucht. (Fünf
Jahre auf der Couch sind unnödg lange für einen einfachen Hausputz.)
Das Unbewusste 211 „Überprüfen Sie, ob Sie eine Altlast
mit sich herumtragen, z.B.
einen inneren Konflikt mit irgendeinem Aspekt Ihrer
Vergangenheit.
[…] Aber stellen Sie sicher, dass er/sie nicht länger als nötig dafür braucht. (Fünf
Jahre auf der Couch sind unnödg lange für einen einfachen Hausputz.)
Pflegen
Sie den Dialog mit Ihrem Archivar. Die besten Zeiten dafür sind gleich
nach dem Aufwachen, kurz vor dem Einschlafen
und zu allen Zeiten, in
denen
Ihre
Aufmerksamkeit weich ist und Ihr Denken auf stand-by geschaltet ist.
Geben
Sie ihm (oder ihr) Dinge zu tun, harmlose Übungen, wie Sie rechtzeidg
aufzuwecken, und auch wichtigere
Aufgaben wie die Vorbereitung eines Examens oder einer Präsentation, ein
Musikstück zu perfektionieren, oder Ideen zu
generieren.“
Luxusvariante
‚Kontemplatoipn‘ 24/7?
![]() Klares Denken in
unklaren Situationen 211 [‘To think in front oft he tiger‘] „Der erste Schritt: Setzen Sie sich hin und entspannen Sie
sich.
[Allerdings gibt es auch Personen, bis Situationen, die dazu/zumächst schneller
Bewegung für ‚qualifizierte Ruhe‘ bedürfen; O.G.J.]
Klares Denken in
unklaren Situationen 211 [‘To think in front oft he tiger‘] „Der erste Schritt: Setzen Sie sich hin und entspannen Sie
sich.
[Allerdings gibt es auch Personen, bis Situationen, die dazu/zumächst schneller
Bewegung für ‚qualifizierte Ruhe‘ bedürfen; O.G.J.]
Dann
sehen Sie sich die Situation an. Wer ist beteiligt? Worum geht es? Was ist
Ihre
Rolle darin? Eine Konfliktlandkarte zu zeichnen könnte helfen.
Muss
ein Beschluss gefasst werden? Steht eine Ja-oder-Nein-Entscheidung an?
Oder
ist es eher eine Love-it, Change-it, Leave-it-Angelegenheit? Oder beides?
Halten
Sie auf jeden Fall Ihre Emotionen heraus [sic! bitte nicht
in einer ‚sei-spontan‘-Paradoxie,
oder eigene Gefühle verdrängend/nicht-ernst-nehmend; O.G.J. mit P.W. bis Sa.Dö.
– durchaus auch/gerade ‚den heiligen
Zorn der Verbunft hilfreich zur Seite springen‘ lassend] und versuchen Sie, mit der Situadon
so nüchtern [‚kritisch selbstwahrnehmungsdistanziert‘; vgl. G.P.] wie nur möglich umzugehen. Falls es
nödg ist, sichern Sie sich die Hilfe einer Person, die emotional nicht
eingebunden ist und die nicht aus Loyalität Ihre Partei ergreift.“
Spätestens manche Schieldsrichter heißen zwar ‚unparteisch‘, sind/wirken jedoch
als eine eigene/weitere ‚Partei‘: weder absolut noch onjektiv, sondern
bestenfalls intersubjektiv neutral vermittelnd,
bis entscheidend; O.G.J.
„Wenn Handlungsbedarf Ihrerseits besteht, handeln Sie. Aber oft gibt es nicht
viel,
was Sie tun können. In solchen Fällen üben Sie sich in
Gleichmut und
Geduld [/chasak/
חזק] so gut
Sie können.“  [Darüber/Davon
reden/denken zu können & zu dürfen, ersetz jedoch nicht jedes andere/übrige
Handeln; zudem drohen dabei
‚sich wie von selbst
erfüllende Vorhersagen‘, und andere ‚dumme‘ Fehler kluger Menschen,
gleich gar zwecks (geängstigter) Negationsvermeidung/Vereinfachung
(des deutlichen Ausdrucks / der schönen Repräsentationen); O.G.J. mit Ar.Na. bis P.W. et al.]
[Darüber/Davon
reden/denken zu können & zu dürfen, ersetz jedoch nicht jedes andere/übrige
Handeln; zudem drohen dabei
‚sich wie von selbst
erfüllende Vorhersagen‘, und andere ‚dumme‘ Fehler kluger Menschen,
gleich gar zwecks (geängstigter) Negationsvermeidung/Vereinfachung
(des deutlichen Ausdrucks / der schönen Repräsentationen); O.G.J. mit Ar.Na. bis P.W. et al.]
![]() Meditation S. 212 die gewählte Methode
sei weniger entscheidend, auch länge und tiefe/intensität des Weges
nicht
unbedingt.
Doch ‚wer schnell gehen/vorankommen‘ wolle ‚braucht‘ mit L.O.N. [längst nicht
allein oder speziell für ‚buddgistische‘ Spritualitäts-
bis Kontemplatopnsansprüche; O.G.J. qualifizierte Weisheit auch/zumal Mystik
vorziehend] ‚einen Lehrer‘. G.P. rät durchaus
zu Einsteigerseminaren.
Meditation S. 212 die gewählte Methode
sei weniger entscheidend, auch länge und tiefe/intensität des Weges
nicht
unbedingt.
Doch ‚wer schnell gehen/vorankommen‘ wolle ‚braucht‘ mit L.O.N. [längst nicht
allein oder speziell für ‚buddgistische‘ Spritualitäts-
bis Kontemplatopnsansprüche; O.G.J. qualifizierte Weisheit auch/zumal Mystik
vorziehend] ‚einen Lehrer‘. G.P. rät durchaus
zu Einsteigerseminaren.
![]() Kurzmeditation
212
Kurzmeditation
212 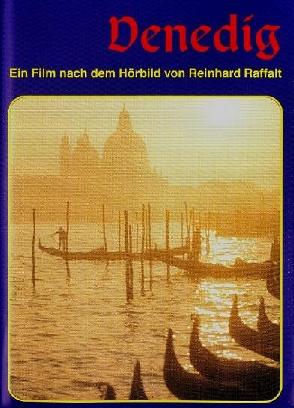 [Doch ist ‚Meditatopn‘ weder ‚neutral‘ noch
nur ein/das ‚inhaltlose/s‘ Enspannung oder Besinnung vermittelndes Medium]
sowohl ohne, als auch mit
konkretem, Thema, wenige Minuten (zur Entspannung/Regeneration bis Inspiration/Archivarkonsultation in erweiterter Wahrnehmungspräsenz auf
allen Kanälen zu SEIN, statt jm Modus des
Tuns zu verbleiben. „ Beobachten Sie Ihre damit
verbundenen Gefühle. Je nach Thema kann das auch recht unangenehm sein,
jedenfalls unangenehmer, als sich davon abzulenken. Aber ein unerfreuliches Thema frontal
anzugehen ist ein weit besserer Weg damit zurande zu kommen, als es zu
verdrängen. Die bloße Betrachtung verringert die Macht, die ein solches Thema
über Sie hat. Und denken Sie daran: Sie müssen in der Sache gar nichts
unternehmen, jedenfalls nicht so lange Sie sie nur betrachten.“
[Doch ist ‚Meditatopn‘ weder ‚neutral‘ noch
nur ein/das ‚inhaltlose/s‘ Enspannung oder Besinnung vermittelndes Medium]
sowohl ohne, als auch mit
konkretem, Thema, wenige Minuten (zur Entspannung/Regeneration bis Inspiration/Archivarkonsultation in erweiterter Wahrnehmungspräsenz auf
allen Kanälen zu SEIN, statt jm Modus des
Tuns zu verbleiben. „ Beobachten Sie Ihre damit
verbundenen Gefühle. Je nach Thema kann das auch recht unangenehm sein,
jedenfalls unangenehmer, als sich davon abzulenken. Aber ein unerfreuliches Thema frontal
anzugehen ist ein weit besserer Weg damit zurande zu kommen, als es zu
verdrängen. Die bloße Betrachtung verringert die Macht, die ein solches Thema
über Sie hat. Und denken Sie daran: Sie müssen in der Sache gar nichts
unternehmen, jedenfalls nicht so lange Sie sie nur betrachten.“
![]() Der Körper S.
212 „Achten Sie auf Ihre körperlichen
Bedürfnisse und tun Sie was nötig ist, um inen gerecht zu werden. Stellen Sie
sicher, dass Ihre Sitzmöbel, ob zu Hause oder bei der Arbeit, Ihren Körper gut
stützen. Dasselbe gilt für ihr Bett, Ihren Autositz und für Ihre Schuhe.“
Qualifiziertes Essen [worüber Menschen, Fachkeute inklisive, allerdings nicht
etwa ‚zu wenig Wissen-genannte
Kenntnisse‘, schon eher ‚viel zu viel Gemurmel
kennend/gebrauxgend‘, bis für/statt Verhalten nehmend; O.G.J. seit/mit Gebesis/
Der Körper S.
212 „Achten Sie auf Ihre körperlichen
Bedürfnisse und tun Sie was nötig ist, um inen gerecht zu werden. Stellen Sie
sicher, dass Ihre Sitzmöbel, ob zu Hause oder bei der Arbeit, Ihren Körper gut
stützen. Dasselbe gilt für ihr Bett, Ihren Autositz und für Ihre Schuhe.“
Qualifiziertes Essen [worüber Menschen, Fachkeute inklisive, allerdings nicht
etwa ‚zu wenig Wissen-genannte
Kenntnisse‘, schon eher ‚viel zu viel Gemurmel
kennend/gebrauxgend‘, bis für/statt Verhalten nehmend; O.G.J. seit/mit Gebesis/![]() ] und genügend jedenfalls Wasser
trinken kommen hinzu. „Strecken Sie sich nach dem Aufwachen und
entspannen Sie sich vor dem Einschlafen. Sollten Sie noch keine persönliche Entspannungsroudne
haben, dann legen Sie sich eine zu, die für Sie funkdoniert. Mit ein bisschen
Übung wird Ihre Entspannungstechnik zu einer wertvollen persönlichen Routine, besonders an und nach anstrengenden
Tagen. Regelmäßige Entspannung wird Ihre
Schlafqualität verbessern und macht Sie weniger anfällig für Stress und Sorgen.“
Das körperliche Stressniveau lasse/empfehle sich regelmäßig, etwa ‚dialogisch‘,
ermitteln: „Die Grundlage einer guten Beziehung zum
eigenen Körper ist seine bewusste Wahrnehmung im Alltag. Das [sic! was
sich nicht von selbst/automatisch einstelle; O.G.J. lieber sich selbst
‚drillend‘] muss man üben.“
] und genügend jedenfalls Wasser
trinken kommen hinzu. „Strecken Sie sich nach dem Aufwachen und
entspannen Sie sich vor dem Einschlafen. Sollten Sie noch keine persönliche Entspannungsroudne
haben, dann legen Sie sich eine zu, die für Sie funkdoniert. Mit ein bisschen
Übung wird Ihre Entspannungstechnik zu einer wertvollen persönlichen Routine, besonders an und nach anstrengenden
Tagen. Regelmäßige Entspannung wird Ihre
Schlafqualität verbessern und macht Sie weniger anfällig für Stress und Sorgen.“
Das körperliche Stressniveau lasse/empfehle sich regelmäßig, etwa ‚dialogisch‘,
ermitteln: „Die Grundlage einer guten Beziehung zum
eigenen Körper ist seine bewusste Wahrnehmung im Alltag. Das [sic! was
sich nicht von selbst/automatisch einstelle; O.G.J. lieber sich selbst
‚drillend‘] muss man üben.“
![]() [Ungleichheit / Nichtidentität, etwa
der Größe/n, über Talentverhältnisse bis Gegenüber-Macht-Relationen-כנגדו sowie Denk- bis Empfindungsweisen pp,, provozieren die, ups bestenfalls unzureichend kontrafaktische Denk-Beschwörung / Rede-Form ‚von/auf gleicher Augenhöhe‘ der/aller
Beteiligten, als irriges
Respektsynonym; erst recht (zumal durch Aroganz-Verbote / resch-Bekämpfung-ריש) unerzwingbar wechselseitig angemessenen (Nächstenliebe-)Abstandes, anstatt ‚Gleichbehandlungen‘ – gerade der sozialen Modalität] Hofknicks: Wer darüber
entscheidet was. bis wer, gleich respektive angemessen – ist/wird mächtiger als
jene die (gar – weder nur individuelle, noch zwingend weibliche – Person) das
nicht tun darf/dürfen!
[Ungleichheit / Nichtidentität, etwa
der Größe/n, über Talentverhältnisse bis Gegenüber-Macht-Relationen-כנגדו sowie Denk- bis Empfindungsweisen pp,, provozieren die, ups bestenfalls unzureichend kontrafaktische Denk-Beschwörung / Rede-Form ‚von/auf gleicher Augenhöhe‘ der/aller
Beteiligten, als irriges
Respektsynonym; erst recht (zumal durch Aroganz-Verbote / resch-Bekämpfung-ריש) unerzwingbar wechselseitig angemessenen (Nächstenliebe-)Abstandes, anstatt ‚Gleichbehandlungen‘ – gerade der sozialen Modalität] Hofknicks: Wer darüber
entscheidet was. bis wer, gleich respektive angemessen – ist/wird mächtiger als
jene die (gar – weder nur individuelle, noch zwingend weibliche – Person) das
nicht tun darf/dürfen! 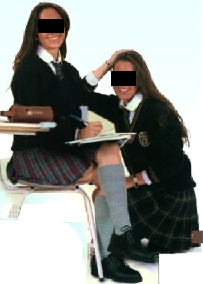
![]() Soziale Beziehungen
213 „Achten Sie darauf, dass Sie wenigstens
einen Menschen haben, mit dem Sie über persönliche oder sensible Themen
sprechen können.
[…]
Soziale Beziehungen
213 „Achten Sie darauf, dass Sie wenigstens
einen Menschen haben, mit dem Sie über persönliche oder sensible Themen
sprechen können.
[…]
 [Spätestens/Ausgerechnet die apostolischen Varnungen:
‚Wer richtet, wird gerichtet‘, schreckt (eindeutig/klar – zumal von der eignen
Gerechtigkeit/Richtigkeit) ‚Überzeugte‘ eher selten ab. – ‚Das Hineinrufen in den
Wald‘ erklärt gleichwohl
nur einen wichtigen Teilaspekt, dessen
‚was hraus /wie zurück schallt‘; zumal keine Urteile zu fällen,. Oder dies andere für einen erledigen zu lassen, noch
verherendere Folögen (auch schon als ‚indoeuropäische
Rechthaberei/Singularvergottung‘) hat] Hüten Sie
sich vor negativen Urteilen über andere und andersartige Menschen. Ganz gleich, wie
gut Sie Ihre Urteile zu
verbergen suchen, die Anderen spüren sie trotzdem und reagieren
entsprechend [sic!
stets auf das was (gedeutet) Ankommt, nicht etwa darauf wie es gemeint oder
(gleich gar intersubjektiv versus vergebend konsensfähig) angemessen/zu
beurteilen war; O.G.J. thomosatheoremisch]. Lernen
Sie, anstelle negativer Urteile, Fragezeichen
zu setzen.
[Spätestens/Ausgerechnet die apostolischen Varnungen:
‚Wer richtet, wird gerichtet‘, schreckt (eindeutig/klar – zumal von der eignen
Gerechtigkeit/Richtigkeit) ‚Überzeugte‘ eher selten ab. – ‚Das Hineinrufen in den
Wald‘ erklärt gleichwohl
nur einen wichtigen Teilaspekt, dessen
‚was hraus /wie zurück schallt‘; zumal keine Urteile zu fällen,. Oder dies andere für einen erledigen zu lassen, noch
verherendere Folögen (auch schon als ‚indoeuropäische
Rechthaberei/Singularvergottung‘) hat] Hüten Sie
sich vor negativen Urteilen über andere und andersartige Menschen. Ganz gleich, wie
gut Sie Ihre Urteile zu
verbergen suchen, die Anderen spüren sie trotzdem und reagieren
entsprechend [sic!
stets auf das was (gedeutet) Ankommt, nicht etwa darauf wie es gemeint oder
(gleich gar intersubjektiv versus vergebend konsensfähig) angemessen/zu
beurteilen war; O.G.J. thomosatheoremisch]. Lernen
Sie, anstelle negativer Urteile, Fragezeichen
zu setzen. 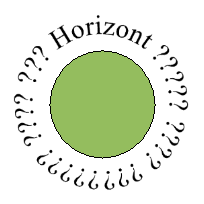 [Auch
Desinteresse, und ernsthafte Trennungen, sind hier konsequent, sogar ups legal, bis durchaus nötig, zumal/zumindest wo
sie (Beurteilungen/‚Beziehungs-Entscheidungen‘ anstelle von Verurteilungen) weder durch ‚moralische Empörung über
Abweichungen/Verletzungen‘, noch durch ‚Hass
gegen/wegen Anderheit/Selbigkeit‘,
disqualifiziert/widerlegt werden]
[Auch
Desinteresse, und ernsthafte Trennungen, sind hier konsequent, sogar ups legal, bis durchaus nötig, zumal/zumindest wo
sie (Beurteilungen/‚Beziehungs-Entscheidungen‘ anstelle von Verurteilungen) weder durch ‚moralische Empörung über
Abweichungen/Verletzungen‘, noch durch ‚Hass
gegen/wegen Anderheit/Selbigkeit‘,
disqualifiziert/widerlegt werden]
Dennoch und\aber-װ trotzdem/deswegen: Wählen Sie Ihre Gesellschaft mit Sorgfalt.“  If/Were ‘to curtsy‘ means/clears
(yourselv/fes), ‘that you are not
Queen/Empress to he person you are curtsying (either even imagined, or not) to‘; Virtualita able
to replay equally. Are YOU/we willing to do the same?
If/Were ‘to curtsy‘ means/clears
(yourselv/fes), ‘that you are not
Queen/Empress to he person you are curtsying (either even imagined, or not) to‘; Virtualita able
to replay equally. Are YOU/we willing to do the same?
[Zumal
sich nicht immer diejenigen für mich/uns interessieren, von denen
wir/ich dies gerne hätte/n – zudem auch bereits
falls/wo solche, die ‚gut(es) tun‘, gar ‚benötigt
werden‘ etc., eher begrenzt ‚verfügbar‘]
Abb.-coronation-curtsy /ezer kenegdo/
gegenübermächtig anstatt Übermächtig Parloaments
as the Majesties ,ost loxal opossotion
![]() Kommunikation 214 „Dieselbe Augenhöhe ist die Vorbedingung [sic! wie
emblematisch/allegorisch/euohemistisch/contrafaktisch auch immer
(gemeint/hyperrealisiert)? O.G:J. wortgetreulicher ernüchtert] für jede gute Kommunikation. Üben Sie sich im Respekt
für Andersartige.
Kommunikation 214 „Dieselbe Augenhöhe ist die Vorbedingung [sic! wie
emblematisch/allegorisch/euohemistisch/contrafaktisch auch immer
(gemeint/hyperrealisiert)? O.G:J. wortgetreulicher ernüchtert] für jede gute Kommunikation. Üben Sie sich im Respekt
für Andersartige.
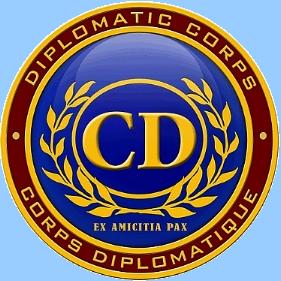 Tolleranz
ist wichtig, greift jedoch häufig / totalitär zu kirz bis sogar daneben. [Es – (zumals/zumeist)
wohlmeinende Fanatiker, die sich zudem ‚für
besonders nette, freundliche Leute‘ halten – eignen sich …
Manche Tiere sagen mit den Augen mehr]
Tolleranz
ist wichtig, greift jedoch häufig / totalitär zu kirz bis sogar daneben. [Es – (zumals/zumeist)
wohlmeinende Fanatiker, die sich zudem ‚für
besonders nette, freundliche Leute‘ halten – eignen sich …
Manche Tiere sagen mit den Augen mehr]
Üben Sie sich auch im
Zuhören.»
Diesbezügliche Zeichen trügen allzuleicht [und zwar ups alle Beteiligten - «Ja aber»-Reaktionen gehören zwar zu den
beleidigensten/herrschaftlichsten Gesprächs-Dummheiten/-Mitteln überhaupt;
O.G.J. durchaus zurückhaltungsorientiert, irrtumsfähig und erkundungsbereit, bis
nicht-Summenverteilungsparadigmatisch-rechthaberisch interessiert, auch ‚depressionserfahren‘: allerdings
(‚jaein‘-aber‘)
das undװaber,
selbst des distanzierten (Respekts-)Abstandes / gerade des Widerspruchs,
weitaus mehr schätzend, als jede als ‚einigkeits-ja‘ getarnte,
Übergriffigkeiten verheimlichter, prompte ‚negativ-Reflex-Reaktion‘; vgl. G.P. vorstehende
Warnung vor ‚nur/bereits denkerisch, ablehnenden Urteilen‘. – Zumal anstelle
einer (gar kontrast-
bis ups konfrontationsbereit offenlegenden)
Nachfrage: ‚ob Verstandenes gemeint/gewollt‘
wird? – ‚Gehorsam‘ von ‚Gefolgschaft' trennend.
„Nehmen
Sie sich die Zeit, die Sie für Ihre Antwort brauchen. Sie
können etwas Zeit gewinnen, indem Sie sagen: «Was Sie eben gesagt haben ist
interessant. Lassen Sie mich einen Moment darüber nachdenken».
Generieren
Sie mehrere alternative Antworten in Ihrem Geist und wählen Sie dann diejenige, die Ihnen am
konstruktivsten erscheint. ![]() [Auch/Spätestens
insoferen werden ups
Pausen, mit G.P. wider deren so gängige
Verkürzung / Vernachläßigung, zum wichtigsten
Charakteristium/Element qualigizierter Gespräche
(nicht erst im Kontrast-Unterschied zu ‘smal
talk‘/Unterhaltungen und Gemurmel,
bis notivationalen Überredungsdebatten – auch/gerade ‚auf Augenhöhe‘ / Euer Gnaden/sich appelativ bittend)]
[Auch/Spätestens
insoferen werden ups
Pausen, mit G.P. wider deren so gängige
Verkürzung / Vernachläßigung, zum wichtigsten
Charakteristium/Element qualigizierter Gespräche
(nicht erst im Kontrast-Unterschied zu ‘smal
talk‘/Unterhaltungen und Gemurmel,
bis notivationalen Überredungsdebatten – auch/gerade ‚auf Augenhöhe‘ / Euer Gnaden/sich appelativ bittend)]
 Stellen Sie Fragen. Fragen zeigen [sic! ‚entblößen‘
allerdings auch wechselseitig viel; O.G.J.]
der anderen Person,
dass Sie Interesse an ihr haben und[/oder; O.G.J. beides lieber /
kommunikationstheoretisch auseinanderhaltend] am Thema.
Beobachten Sie auch, ob Ihr Gesprächspartner Ihnen Fragen stellt. Menschen, die
Ihnen keine Fragen stellen, sind nicht
wirklich an Ihnen interessiert. [Manche beansichtigen, bis haben, Ihnen/Euch, äh
mir, ‚Weisung/en zu erteilen‘;
O.G.J. solche/s gerade in bestimmten, bis höflichen, Verpackungen/Formen durchaus argwähnend
– ‚Honi soit qui
mal y pense‘]
Stellen Sie Fragen. Fragen zeigen [sic! ‚entblößen‘
allerdings auch wechselseitig viel; O.G.J.]
der anderen Person,
dass Sie Interesse an ihr haben und[/oder; O.G.J. beides lieber /
kommunikationstheoretisch auseinanderhaltend] am Thema.
Beobachten Sie auch, ob Ihr Gesprächspartner Ihnen Fragen stellt. Menschen, die
Ihnen keine Fragen stellen, sind nicht
wirklich an Ihnen interessiert. [Manche beansichtigen, bis haben, Ihnen/Euch, äh
mir, ‚Weisung/en zu erteilen‘;
O.G.J. solche/s gerade in bestimmten, bis höflichen, Verpackungen/Formen durchaus argwähnend
– ‚Honi soit qui
mal y pense‘] ![]()
Beobachten Sie, wie
Sie sich nach einem Gespräch fühlen. Vielleicht fühlen Sie sich ausgelaugt, (dann war es kein wirklich
gutes Gespräch), vielleicht auch inspiriert oder dankbar. Versuchen Sie,
Gespräche, die Sie regelmäßig auslaugen, zu vermeiden.
Beobachten Sie auch
das Tempo von Gesprächen. Manche sind einfach stressig, ohne Pausen zum Denken. Sie werden danach
erschöpft sein. Andere Gespräche sind wie ein gemeinsamer Spaziergang durch
eine mentale Landschaft. Ihr/e
Gesprächspartner und
Sie werden solche Gespräche genießen.“
![]() Brettspiele 215
„Manche Brettspiele sind ausgezeichnete
Übungsfelder für die Handhabung des Geistes und der Emotionen, ebenso wie für
die Wahrnehmung und das Urteilsvermögen. Bei solchen Spielen liegt der
Unterschied zwischen gutem und schlechtem Spiel […] in der Qualität der persönlichen und sozialen Kompetenz. [Auch/Gerade
diesbezüglich gibt es nullsummenverteilendes-
bis negativsummenpardigmatisches Vorgehen; O.G-J. strategisch
philosophierend und theologisch taktierend] Wer stolpert, stolpert in der Regel über die eigenen
Füße. Deshalb sind diese Spiele sehr gut, um sich selber besser kennen zu
lernen und die Soft Skills zu üben.“
Z.B. Pente und Mankala.
Brettspiele 215
„Manche Brettspiele sind ausgezeichnete
Übungsfelder für die Handhabung des Geistes und der Emotionen, ebenso wie für
die Wahrnehmung und das Urteilsvermögen. Bei solchen Spielen liegt der
Unterschied zwischen gutem und schlechtem Spiel […] in der Qualität der persönlichen und sozialen Kompetenz. [Auch/Gerade
diesbezüglich gibt es nullsummenverteilendes-
bis negativsummenpardigmatisches Vorgehen; O.G-J. strategisch
philosophierend und theologisch taktierend] Wer stolpert, stolpert in der Regel über die eigenen
Füße. Deshalb sind diese Spiele sehr gut, um sich selber besser kennen zu
lernen und die Soft Skills zu üben.“
Z.B. Pente und Mankala.
![]() Erfolg S. 218 Vielerlei Definitionen
seien bereits versucht worden, doch:
Erfolg S. 218 Vielerlei Definitionen
seien bereits versucht worden, doch:  Vergebung
(/Versöhnung
mit) der
eigenen Existenz ermöglicht ‚dies‘/Ähnliches anderen gegenüber,
bis manchmal sogar wechselseitig, zu können/tun, eben
anstatt es zu erzwingen, zu
ersetzen oder vorauszusetzen. [Ich persönlich
‚zäume das Erfolgspferd von hinten her auf‘] „Wenn wir einmal auf unserem Sterbelager liegen und auf
unser Leben zurückschauen, dann sollte auf unseren Lippen ein
kleines Lächeln sein. Wenn es in Ihrem heutigen Leben etwas gibt, auf das
Sie später nicht mit einem Lächeln zurückschauen können, ändern Sie es. Jetzt.“
Vergebung
(/Versöhnung
mit) der
eigenen Existenz ermöglicht ‚dies‘/Ähnliches anderen gegenüber,
bis manchmal sogar wechselseitig, zu können/tun, eben
anstatt es zu erzwingen, zu
ersetzen oder vorauszusetzen. [Ich persönlich
‚zäume das Erfolgspferd von hinten her auf‘] „Wenn wir einmal auf unserem Sterbelager liegen und auf
unser Leben zurückschauen, dann sollte auf unseren Lippen ein
kleines Lächeln sein. Wenn es in Ihrem heutigen Leben etwas gibt, auf das
Sie später nicht mit einem Lächeln zurückschauen können, ändern Sie es. Jetzt.“ ![]() [Am/Vom Institut für Wesentlichkeit/en könnte … mit G.P. vom
Lebensende her denkend]
[Am/Vom Institut für Wesentlichkeit/en könnte … mit G.P. vom
Lebensende her denkend] 
 [Spätestens altlastenfrei bis qualifizierte versöhnt, gar
Lebebnsbilanz: ‚Hat so (wie erlebt
erinnert) sein dürfen‘]
[Spätestens altlastenfrei bis qualifizierte versöhnt, gar
Lebebnsbilanz: ‚Hat so (wie erlebt
erinnert) sein dürfen‘] 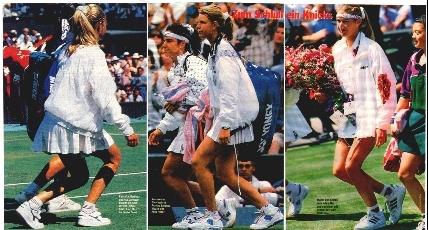
![]() Liebe 220 abschlißend bemerkt Sir George, dass er mit dem Wort
/ אהבה /
Gemeinten
biohraphisch früher wenig anzufangen wußte:, er hatte
„nicht das Gefühl zu wissen, worüber ich sprach. Inzwischen hat das
Wort Liebe in meinem Geist
und in meinem Herzen sehr an Bedeutung und Tiefe gewonnen und gewinnt noch weiter hinzu,
während mein Leben fortschreitet. Die normale [sic!] Bedeutung des Wortes, die Liebe, die wir für einen anderen Menschen empfinden
können, ist zu einer kleinen Facette einer viel umfassenderen inneren Haltung
geworden.“; und der Autor verwendet dialektisch eine der einschlägigen Listen dessn, was
uns ohne [immerhin ‚Gnade‘; O.G.J. bei aller Skepsis/Kälte, weniger Dualistisch verteilend
denkend] fehlt.
Liebe 220 abschlißend bemerkt Sir George, dass er mit dem Wort
/ אהבה /
Gemeinten
biohraphisch früher wenig anzufangen wußte:, er hatte
„nicht das Gefühl zu wissen, worüber ich sprach. Inzwischen hat das
Wort Liebe in meinem Geist
und in meinem Herzen sehr an Bedeutung und Tiefe gewonnen und gewinnt noch weiter hinzu,
während mein Leben fortschreitet. Die normale [sic!] Bedeutung des Wortes, die Liebe, die wir für einen anderen Menschen empfinden
können, ist zu einer kleinen Facette einer viel umfassenderen inneren Haltung
geworden.“; und der Autor verwendet dialektisch eine der einschlägigen Listen dessn, was
uns ohne [immerhin ‚Gnade‘; O.G.J. bei aller Skepsis/Kälte, weniger Dualistisch verteilend
denkend] fehlt.  [Grafensaal: Bereits Fussboden mit allerlei Facetten
an/der … Schöpfung]
[Grafensaal: Bereits Fussboden mit allerlei Facetten
an/der … Schöpfung] 
(G.P. Buch 2014; verlinkende
und andere Hervorhenungen O.G.J.) 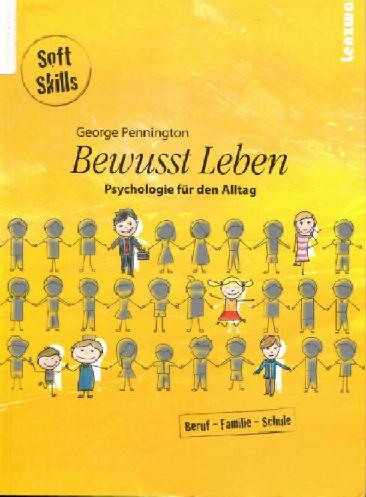 «Über
dieses Buch
«Über
dieses Buch
Orientierung -
Wahrnehmung - Motivation - Emotionen
In diesem Buch geht es um die
[sic!] Grundlagen unserer Lebenstüchtigkeit.
Wir bezeichnen diese Grundlagen als
persönliche und soziale Kompetenzen. Im
Business-Kontext spricht man von Soft Skills bzw. von Selbstmanagement. Es geht
um die Fähigkeit, uns den eigenen Bedürfnissen
und der gegebenen Situation entsprechend [sic!]
zu organisieren
und zu verhalten. Schon Piaton erkannte darin eine praktische Form der Weisheit.
George Pennington
gelingt es, die persönlichen und sozialen Kompetenzen verständlich
und alltagstauglich darzustellen. Dieses Buch
macht sie einem breiteren Publikum als praktische Lebenshilfe zugänglich, für
den privaten Bereich ebenso wie am Arbeitsplatz. Darüber hinaus ist es eine
wertvolle Grundlage für die Vermittlung dieser Kompetenzen an der
[sic!] Schule.
Stress -
Beziehung - Kommunikation - Konflikte – Erfolg»  Zwar gilt manchen, manche ‚nach
Verfügbarkeit aussehen‘-könnende/sollende Bekleidung, als
abschaffbar/verwerflich. [Denkhandelnde auf allen ‚Stockwerken‘, zumal des Selbsteturmes eigenständig bleibend
verbunden]
Zwar gilt manchen, manche ‚nach
Verfügbarkeit aussehen‘-könnende/sollende Bekleidung, als
abschaffbar/verwerflich. [Denkhandelnde auf allen ‚Stockwerken‘, zumal des Selbsteturmes eigenständig bleibend
verbunden]
|
[Bemühungen, zumal ‚innere‘,
‚Schweinehunde‘ bekämpfend abzuschaffen /
leugnen, jedenfalls ein- bis weg- äh auszusperren – erweisen sich meist als ebenso omnipräsent wie dumm, bis erfolglos
/ verheerend] Nicht genug damit, äh verdächtig verständlich, dass / falls / warum
und wozu: Aufgaben /
Begabungen / Bosheiten
/ Hoheiten / Kräfte-Personifikationen / Leidenschaften /
Menschen / Symbole
/ Verfehlungen verachtet werden; verachten jedenfalls ‚innere‘ Schweinehunde |
In durchaus
journalistischer Komprimierung befragt,
fasste Doktor Freiherr Marco von
Münchhausen für das FOCUS-Magazin zusammen,
was er als ‚einzigen‘
/ entscheidend umgebenden Hinweis /remes/ רמז entdeckte: „Der innere Schweinehund ist ein Persönlichkeitsanteil in
uns, der uns immer wieder im Weg zu stehen scheint. Dieser kleine
[[sic!] Saboteur verfolgt jedoch in vielen Fällen einen positiven Zweck für uns, den es zu entdecken gilt. Er warnt uns vor
Überforderungen und ungesunden Grenzüberschreitungen. Darum ist es wichtig,
ihn ernst zu nehmen: Akzeptieren Sie ihn, versuchen
Sie zu verstehen, was er Ihnen sagen will, und
richten Sie ihm eine (begrenzte) Nische in
Ihrem Leben ein. So wird aus einem ehemaligen Feind ein Freund fürs
Leben.“ (M.v.M. in ‚Die Erfolgsmacher‘, S.
108-136; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) |
[Unter/Als רמז wird hier bekanntlich bemerkt, dass Worte, so
‚(innerer) Schweinehund‘, bis gar Aussagen / Gesten, zumindest immer ups mehrdeutige,
soweit nicht sogar wandelbare, Bedeutungsumgebungen (aus zu balancieren) aufgeben] |
Dazu,
und darüber hinaus lernbar, steht dort in der Verdichtung auf/an Zitaten nach- bis vorzulesen: »Lassen
Sie Ihren Schweinehund ruhig ab und zu gewinnen,
dann wird auch er Sie gewinnen lassen.« »Überforderung
und Unterforderung sind die größten Motivationskiller in unserem Leben!« »Was
auch immer Sie dauerhaft tun
wollen, tun Sie es möglichst stets zur selben Zeit, am selben Ort und in der
gleichen Art und Weise!«
[‘Keep it simple and stupid‘ (gleich gar ‚die Rechtslage/n‘) – steht nicht
unaufhebbar notwendig im Widerspruch zu wichtigen Komplexitäten-Einsichten] »Um
eine neue/andere Gewohnheit
zu schaffen, bedarf es der ständigen, rhythmischen
Wiederholung.« |
|
[illustriert durch
Gisela Aulfes erschienen im 21.
Jahrhundert, zusammen mit Dr. Michael Despeghel erweitert um ‚Abnehmen
mit dem …‘; mit Cay von Fourier um ‚Führen mit dem …‘; mit Sabine Hübner um
‚Service mit dem …‘: und mit Iris & Johannes von Stosch um ‚Liebe und
Partnerschaft‘ (jeweils, anstatt: ‚wider cden‘)
‚mit dem inneren Schweinehund‘] |
Strukturell handeln seine, meist
mit weiteren Fachleuten auf den einzelnen Gebieten zusammen verfasste, Werke |
Angereichert um die
wohl am ein- bis nachdrücklichsten erzählten Erfahrungsaustauschtreffen
der Schweinehunde selbst, exemplarisch aus der Rede von Uli: „War ja alles logisch, aber
Leute, ihr kennt mich! Was soll die Vernunft, wenn die Unvernunft mehr Spaß
macht!“
|
O.G.J.: Derart viele, wesentliche Lebensbereiche
betreffend, dass von ‚Totalität‘ auszugehen ist – zumindest was das
Verhindern von beabsichtigten Verhaltensänderungen
angeht; der indoeuropäisch singularisierte ‚Totalitarismus‘ liegt / droht
allerdings darin – zumal anderen Leuten – sagen zu s/wollen, wie sie
sich zu ändern hätten: ‚Da/Wo dies
das einzig alternativlos Richtige /wahre
Gute, es also moralisch skandalös, unvernünftig bis böse sei, auch nur
eine abweichende, gar andere oder veränderliche, Meinung
zu haben‘, geschweige denn zu leben.
|
 [Außer mit seinem Hauptzugang dem Wehrturm der hochedlen Töchter der
Freiheit ist bei einer Hervorhebung aller vier mit durchsehbaren Fenstern
versehenen Stockwerke des Selbstturmes nur der Kaiserturm des Werdens ins
unmittelbare Blickfeld der wesentlichsten Fragen geraten]
[Außer mit seinem Hauptzugang dem Wehrturm der hochedlen Töchter der
Freiheit ist bei einer Hervorhebung aller vier mit durchsehbaren Fenstern
versehenen Stockwerke des Selbstturmes nur der Kaiserturm des Werdens ins
unmittelbare Blickfeld der wesentlichsten Fragen geraten]
Zwei, alte, basale
Fragen von drüben im Grundlagenkonflikt zwischen/von SEIN
und\aber/oder WERDEN
beschäftigen allerdings gerade auch Schweinehundeforschung, bis sich‘ ihrer
inneren Schweinehunde‘ bewusste/gewahre
Menschen überhaupt: 
 Wo sind Änderungen
zu vermeiden? – ‚Tummelplätze‘ /
Lieblingsorte der/für innere Schweinehunde:
Wo sind Änderungen
zu vermeiden? – ‚Tummelplätze‘ /
Lieblingsorte der/für innere Schweinehunde:  [Doch unausweichlich bleit einem der
innere Schweinehund, auch sonst, immer und überall treu
zu Seite]
[Doch unausweichlich bleit einem der
innere Schweinehund, auch sonst, immer und überall treu
zu Seite] 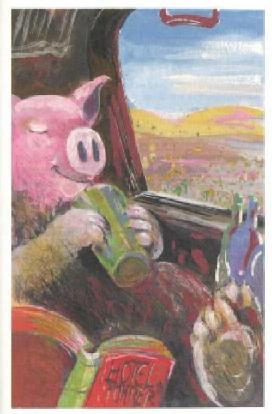
-
Spiel oder stirb 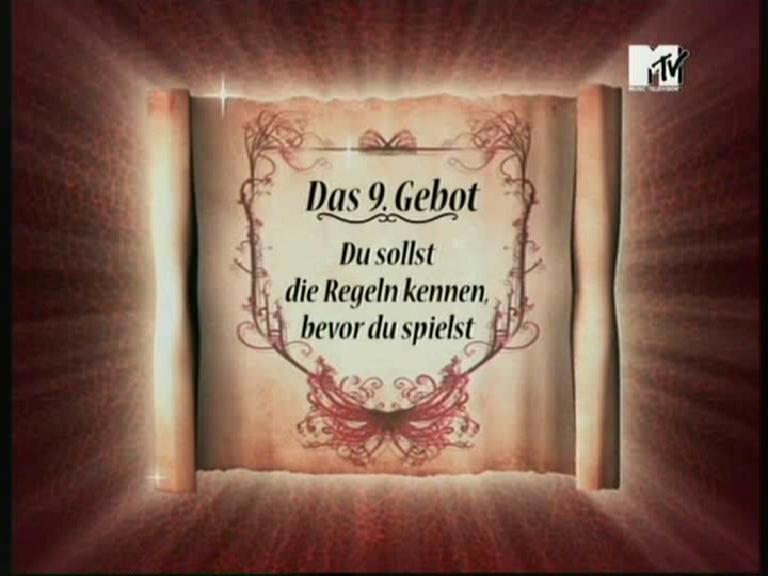
- Wursteln statt Wirken
- Führen ohne Befugnis
- Fürstentümer
- Bürokratie
- Schnittstellen-Probleme
- … auf die krumme Tour
-
Service by Zufall 
-
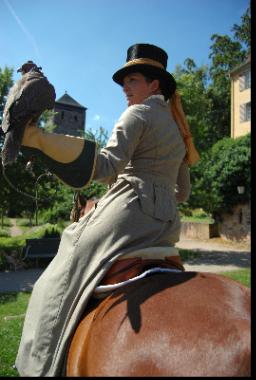 Wie sind Änderungen zu
vermeiden? – ‚Tricks und Taktiken‘ innerer Schweinehunde mit
zwanzig Merk-Sätzen
Wie sind Änderungen zu
vermeiden? – ‚Tricks und Taktiken‘ innerer Schweinehunde mit
zwanzig Merk-Sätzen
 [Heureka-Sprung
des Aha-Erlebnisses, äh erheblicher
Satz], verraten
bei/von Baron Marco:
[Heureka-Sprung
des Aha-Erlebnisses, äh erheblicher
Satz], verraten
bei/von Baron Marco: 
[Die Trickkiste jedes
inneren Schweinehundes ist stets gut gefüllt verfügbar, Mylady] 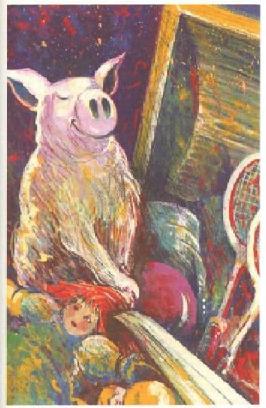
Verhinderungen des Entschlusses das/etwas zu
ändern
-
 [Der berüchtigte Strappado
‚IKS-Hacken-Hofknicks‘ also: ‚Ich sollte respektive will
zwar eigentlich etwas, bis
gerade dieses Verhalten, ändern
– kann – und/oder darf – aber nicht …‘]
[Der berüchtigte Strappado
‚IKS-Hacken-Hofknicks‘ also: ‚Ich sollte respektive will
zwar eigentlich etwas, bis
gerade dieses Verhalten, ändern
– kann – und/oder darf – aber nicht …‘]
-
![]() Taktik der Unmöglichkeit/en gleich mit „Merksatz
Taktik der Unmöglichkeit/en gleich mit „Merksatz ![]() Nr. 1 Der Glaube an die Unmöslichkeit des Vorhabens schützt die
Berge vor dem Versetztwerden!“
Zusätzlich und stets beliebig absicherbar ist diese wichtige
Verhinderungtaktik durch/mit/weil: „»Keine Zeit!«“ sei (vgl. ursprüngliches
Buch M.v.M.’s alleine 2004; dazu ab S. 37).
Nr. 1 Der Glaube an die Unmöslichkeit des Vorhabens schützt die
Berge vor dem Versetztwerden!“
Zusätzlich und stets beliebig absicherbar ist diese wichtige
Verhinderungtaktik durch/mit/weil: „»Keine Zeit!«“ sei (vgl. ursprüngliches
Buch M.v.M.’s alleine 2004; dazu ab S. 37).
-
![]() Tarnkappenspiel
Tarnkappenspiel![]() -Taktik mit gleich
zwei Merksätzen:
-Taktik mit gleich
zwei Merksätzen: ![]() „Nr. 2 Wenn die Pflicht ruft, geht so mancher Vorsatz baden.“ auch alle anderen (ethisch) heeren Prinzipien und Gründe eigenen sich hervorragend um ‚nicht wollen‘
dahinter zu tarnen. Und ganz speziell hochwirksam
tückisch: „Nr. 3 Aus
Gründen der Rücksichtnahme entfällt die
Übernahme der Selbstverantwortung“
vorgeblich zugunsten … Euer Gnaden wissen schon.
„Nr. 2 Wenn die Pflicht ruft, geht so mancher Vorsatz baden.“ auch alle anderen (ethisch) heeren Prinzipien und Gründe eigenen sich hervorragend um ‚nicht wollen‘
dahinter zu tarnen. Und ganz speziell hochwirksam
tückisch: „Nr. 3 Aus
Gründen der Rücksichtnahme entfällt die
Übernahme der Selbstverantwortung“
vorgeblich zugunsten … Euer Gnaden wissen schon.
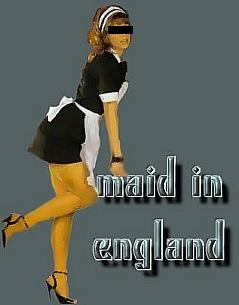 [Was Wir von
Gottes Gnaden (so trefflichst inspiriert) als
die Bedürfnisse Unserer Dienerschaft und Untertanen, eben des Volkes,
erkannt, geht Uns Herrschenden ja stets vor und über alles
sonst]
[Was Wir von
Gottes Gnaden (so trefflichst inspiriert) als
die Bedürfnisse Unserer Dienerschaft und Untertanen, eben des Volkes,
erkannt, geht Uns Herrschenden ja stets vor und über alles
sonst]
-
![]() Taktik ausdrücklicher
Unverbindlichkeit/en,
nach dem sehr erprobten Motto (es ewig versuchender):
Taktik ausdrücklicher
Unverbindlichkeit/en,
nach dem sehr erprobten Motto (es ewig versuchender): ![]() „Nr 4 Im Konjunktlv formulierte Vorsätze werden
selten realisiert.“
„Nr 4 Im Konjunktlv formulierte Vorsätze werden
selten realisiert.“
- Schweinehund/e-Bingo eine kleine Bingoblock-Tabelle um den inneren Schweinehund beim Unverbindlichkeitstrick zu entlarfen: Indem, gar wechselseitig auch in Partnerschaften aller Arten, ‚mitgezählt‘ / beachtet werden kann, welche der folgender Formulierungen
-
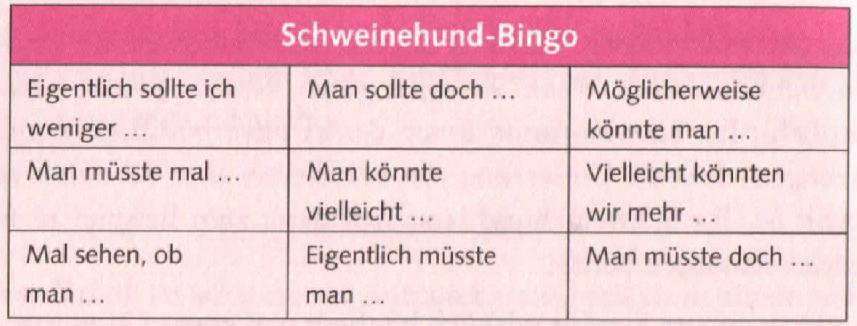
- ‚im/beim Nachdenken, Planungsarbeiten, Alltagsgesprächen etc.‘ wann hinter- bzw. untereinander zustande kommen, und damit einen inneren Schweinehund (von, wie vor, wem auch immer) enttarnen (Vgl. 3009; S. 45 f.).
-
![]() Taktik der Verzögerung/en „Merksatz
Taktik der Verzögerung/en „Merksatz ![]() Nr. 5
Nr. 5
- Die lange Bank ist der Schweinehunde liebste Werkzeugbank.“
-
![]() Taktik der Verharmlosung/en (des Fehlverhaltens)
„Merksatz
Taktik der Verharmlosung/en (des Fehlverhaltens)
„Merksatz ![]() Nr. 6 Beschwichtigung ist ein Betäubungsmittel
mit den lähmendsten Nebenwirkungen.“
Nr. 6 Beschwichtigung ist ein Betäubungsmittel
mit den lähmendsten Nebenwirkungen.“
-
![]() Nicht-zuständig-sein-Taktik „Merksatz
Nicht-zuständig-sein-Taktik „Merksatz ![]() Nr. 7“ ist/wird schnell klar; und dieser
schweinehündische Trick verschlimmbesserungsfähig überhöhbar: Durch
‚Allzuständigkeiten‘, bis gefällige Kompetenz respektive Verantwortlichkeiten
Zu- wie Abweisungen; zumal an/von andere/n respektive abwesende/n. Behörden pp.
vgl. auchTypologiekonsequenzen).
Nr. 7“ ist/wird schnell klar; und dieser
schweinehündische Trick verschlimmbesserungsfähig überhöhbar: Durch
‚Allzuständigkeiten‘, bis gefällige Kompetenz respektive Verantwortlichkeiten
Zu- wie Abweisungen; zumal an/von andere/n respektive abwesende/n. Behörden pp.
vgl. auchTypologiekonsequenzen).
-
![]() Eine der häufig, leicht erkennbaren Traditions-Formulierungen wird zwar im/am nächsten Mnemosatz
Eine der häufig, leicht erkennbaren Traditions-Formulierungen wird zwar im/am nächsten Mnemosatz ![]() deutlich,
Nr. 8 lautet nämlich doppelt scharf: „Bitte nichts ändern! Es könnte anders werden ...“ Leicht wider einen bestimmten, typischen Denkstil, bis
traditionsfeindlich oder ‚weltanschaulich‘
derart ‚ progressiv-versus-konservativ-überzogen‘ missdeutbar – dessen/deren gar
wertschätzende Anerkennung / Berücksichtigung auch M.v.M. unten teilt –, dass spätere/komprimiertere
Listen bzw. Bücher diese (eventuell teils auch genderspezifisch
veränderungsfeindlich korrelierte) eben sicherheitsorientierte
Grundhaltung vieler, doch eben nicht aller, Schweinehundtypen
anderweitig/anderwo verbessert enthalten.
deutlich,
Nr. 8 lautet nämlich doppelt scharf: „Bitte nichts ändern! Es könnte anders werden ...“ Leicht wider einen bestimmten, typischen Denkstil, bis
traditionsfeindlich oder ‚weltanschaulich‘
derart ‚ progressiv-versus-konservativ-überzogen‘ missdeutbar – dessen/deren gar
wertschätzende Anerkennung / Berücksichtigung auch M.v.M. unten teilt –, dass spätere/komprimiertere
Listen bzw. Bücher diese (eventuell teils auch genderspezifisch
veränderungsfeindlich korrelierte) eben sicherheitsorientierte
Grundhaltung vieler, doch eben nicht aller, Schweinehundtypen
anderweitig/anderwo verbessert enthalten.
![]() Wobei also, bis so dass gar weniger ihr ‚Sicherheitsdenken
(inklusive Risikoscheu und Blamage-Ängsten;
vgl. Satz neun)‘ als Trägheiten / rituelle Gewohnheit sich, des
jeweiligen Menschen, Verhalten – das eben auch ein spontanes sein kann, bis darf, und dadurch zumal anders orientierte
Leute empörende Probleme machen kann – zu ändern, gemeinsames
‚charakterliches Merkmal‘ aller inneren Schweinehunde. Wie insbesondere im 10.
Merksatz
Wobei also, bis so dass gar weniger ihr ‚Sicherheitsdenken
(inklusive Risikoscheu und Blamage-Ängsten;
vgl. Satz neun)‘ als Trägheiten / rituelle Gewohnheit sich, des
jeweiligen Menschen, Verhalten – das eben auch ein spontanes sein kann, bis darf, und dadurch zumal anders orientierte
Leute empörende Probleme machen kann – zu ändern, gemeinsames
‚charakterliches Merkmal‘ aller inneren Schweinehunde. Wie insbesondere im 10.
Merksatz ![]() so trefflich
ausgedrückt: „Wer morgen
träge sein will, übe sich heute schon in Bequemlichkeit!“
so trefflich
ausgedrückt: „Wer morgen
träge sein will, übe sich heute schon in Bequemlichkeit!“  [‚Der Zug (gar des Fortschritts – übern ‚Geist‘/Wind)‘, bis jedwedes Geschehen braucht ja gar ‚nicht aufgehalten
zu werden‘ – dem/zum Verhängnis genüge
es: ‚keine Weichen / Segel zu stellen‘ respektive ‚sich brav mitschleppen zu
lassen‘]
[‚Der Zug (gar des Fortschritts – übern ‚Geist‘/Wind)‘, bis jedwedes Geschehen braucht ja gar ‚nicht aufgehalten
zu werden‘ – dem/zum Verhängnis genüge
es: ‚keine Weichen / Segel zu stellen‘ respektive ‚sich brav mitschleppen zu
lassen‘]
- Der Wurm in / Das gar Sollbruchstellenhafte der Entscheidung
-
 [Bloßgestellt/Verborgen: ‚…
bis/außer (Über-)Mächtige kommen / retten / tragen / bezwingen …‘]
[Bloßgestellt/Verborgen: ‚…
bis/außer (Über-)Mächtige kommen / retten / tragen / bezwingen …‘]
-
![]() Der ewigen Versucher
Laboratorium „Merksatz
Der ewigen Versucher
Laboratorium „Merksatz ![]() Nr. 11 »Versuchen wollen« kostet nichts - und bringt auch nichts“,
außer sozialen und gesamtwirtschaftlichen Folgekosten nicht umgesetzter
Entscheidungen.
Nr. 11 »Versuchen wollen« kostet nichts - und bringt auch nichts“,
außer sozialen und gesamtwirtschaftlichen Folgekosten nicht umgesetzter
Entscheidungen.
-
![]() Nebeltaktik „Merksatz
Nebeltaktik „Merksatz ![]() Nr. 12
Befehle im Komparativ sind nicht ausführbar!“
Nr. 12
Befehle im Komparativ sind nicht ausführbar!“
-
![]() Der Freigeister sich stets unverbindlich alle
Optionen
Der Freigeister sich stets unverbindlich alle
Optionen ![]() Offenhaltenssatz
Offenhaltenssatz ![]() „Nr. 13 kein Termin - keine Tat!“
„Nr. 13 kein Termin - keine Tat!“
-
![]() Herkulesiaden-Taktik des
sich/andere Überforderns „Merksatz
Herkulesiaden-Taktik des
sich/andere Überforderns „Merksatz
![]() Nr. 14 Wer sich übernimmt, unternimmt nicht viel!“ Wobei
bekanntlich schweinehunde-definitionsgemäß
prompt auch das Gegenteil, ‚Unterforderungen‘ demotivierend funktionieren.
Nr. 14 Wer sich übernimmt, unternimmt nicht viel!“ Wobei
bekanntlich schweinehunde-definitionsgemäß
prompt auch das Gegenteil, ‚Unterforderungen‘ demotivierend funktionieren. 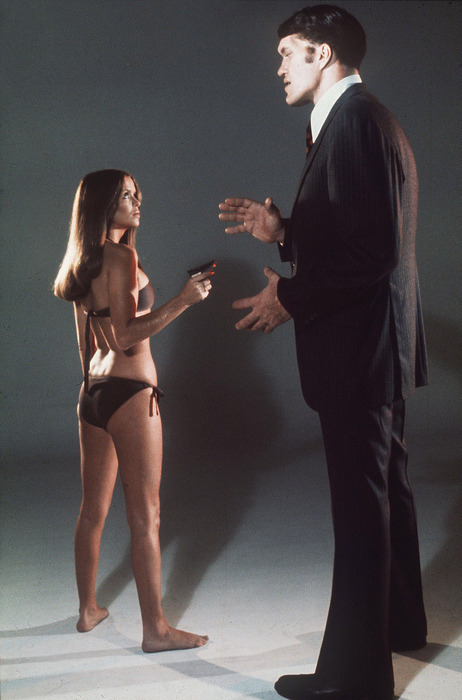 [Nicht alle wirkungsarmen Entscheidungen sind/werden
falsch formuliert – doch verrät die Semiotik bereits viel]
[Nicht alle wirkungsarmen Entscheidungen sind/werden
falsch formuliert – doch verrät die Semiotik bereits viel]
-
Sabotagen der
Ausführung / Die stets/alle ‚Gewalttaten-fürchtende, äh
kraftscheu scheinbare Durchsetzung‘
(![]() ‚Klein Plan
/ Entschluss übersteht die erste Berührung mit dem Feind / den Realitäten
unverändert‘; vgl. C.v.C.)
‚Klein Plan
/ Entschluss übersteht die erste Berührung mit dem Feind / den Realitäten
unverändert‘; vgl. C.v.C.)
-
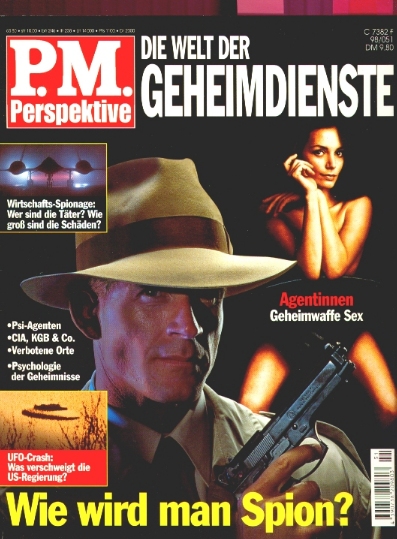 [Hintermächtige durchschauend:‚…
denn versuchte ich es selbst
/ blasphemischerweise – bleiben Alle und Alles schicksalhaft
dagegen …‘]
[Hintermächtige durchschauend:‚…
denn versuchte ich es selbst
/ blasphemischerweise – bleiben Alle und Alles schicksalhaft
dagegen …‘]
-
![]() Ablenkungsmanöver: „Merksatz
Ablenkungsmanöver: „Merksatz ![]() Nr. 15: Die Ablenkung ist der erste Schritt,
auf dem Weg zur Zielverfehlung.“ Doch
existieren mehr nützliche, als der mehr des punktförmig fokusierte/n
Konzentrationsprozess/‘-zustand‘. Und die Vita activa
sowie Vita contemplativa schließen einander keineswegs notwendigerweise
wechselseitig völlig aus. Gar noch wichtigerer allerdings die Warnung
Nr. 15: Die Ablenkung ist der erste Schritt,
auf dem Weg zur Zielverfehlung.“ Doch
existieren mehr nützliche, als der mehr des punktförmig fokusierte/n
Konzentrationsprozess/‘-zustand‘. Und die Vita activa
sowie Vita contemplativa schließen einander keineswegs notwendigerweise
wechselseitig völlig aus. Gar noch wichtigerer allerdings die Warnung ![]() vor dem „Märchen von der richtigen Stimmung“ (die nämlich nie
kommt; 2004,S. 71) und was
vor dem „Märchen von der richtigen Stimmung“ (die nämlich nie
kommt; 2004,S. 71) und was ![]() „Die betrügerische Verführung“ (2004, S. 74) angeht.
„Die betrügerische Verführung“ (2004, S. 74) angeht.
![]() Ausnahmefallen(taktik) „Merksatz
Ausnahmefallen(taktik) „Merksatz ![]() Nr. 16 Schweinehund-Dreisatz: ausfallen lassen
- schleifen lassen - sein lassen.“
Nr. 16 Schweinehund-Dreisatz: ausfallen lassen
- schleifen lassen - sein lassen.“
![]() Abbruchtaktik – zu deren Krönung / adelnder,
äh edler,
Bestätigung: „Der
verhängnisvolle Blick“ der Irrgartenbastei des
Vergleichens „auf andere“ (die es auch abgebrochen haben / so zahlreichen,
besseren als ich, die auch nicht durchhielten; 2004, S. 81) gehöre von
Münchhausens Schweinehundeschule-„Merksatz
Abbruchtaktik – zu deren Krönung / adelnder,
äh edler,
Bestätigung: „Der
verhängnisvolle Blick“ der Irrgartenbastei des
Vergleichens „auf andere“ (die es auch abgebrochen haben / so zahlreichen,
besseren als ich, die auch nicht durchhielten; 2004, S. 81) gehöre von
Münchhausens Schweinehundeschule-„Merksatz ![]() Nr. 18 Gemeinsam nichts zu tun ist sozialer als einsam zu schuften.“
Nr. 18 Gemeinsam nichts zu tun ist sozialer als einsam zu schuften.“  [Diese Fallen warten – gar erstaunlich –
unabhängig von der Qulität (und Sprachform) einer Entscheidung auf jede]
[Diese Fallen warten – gar erstaunlich –
unabhängig von der Qulität (und Sprachform) einer Entscheidung auf jede]
-
Nach dem (Phyros-
bis ‚Damokles‘-)Sieg des
Schweinehundes  [Hat doch schon alles versucht: ‚Ich kann ja nichts
dafür / dagegen machen: schuldlos schuldiges
Opfer trügerischer Spiegel / unerlöst erlösungsbedürftig armselig kreatürlich-materielle Existenz
geworden zu sein!‘]
[Hat doch schon alles versucht: ‚Ich kann ja nichts
dafür / dagegen machen: schuldlos schuldiges
Opfer trügerischer Spiegel / unerlöst erlösungsbedürftig armselig kreatürlich-materielle Existenz
geworden zu sein!‘]
![]() Tröstende Opferbilder produzieren, gemäß den beiden finalen
Merksätzen
Tröstende Opferbilder produzieren, gemäß den beiden finalen
Merksätzen ![]() „Nr. 19: Suchet, dann werdet Ihr einen Sündenbock finden!“ und zwar
Dich/mich „Nr. 20: Immer -
alles - nix: der typische Versagermix,“ da hilft nicht
a‘mal a richtger Knix!
„Nr. 19: Suchet, dann werdet Ihr einen Sündenbock finden!“ und zwar
Dich/mich „Nr. 20: Immer -
alles - nix: der typische Versagermix,“ da hilft nicht
a‘mal a richtger Knix! 
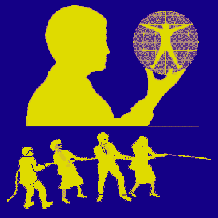 [Sozio-logischerweise ist/bleibt niemand nur
innermenschlich / mit ihrem/seinem inneren Schweinehund alleine auf Erden]
[Sozio-logischerweise ist/bleibt niemand nur
innermenschlich / mit ihrem/seinem inneren Schweinehund alleine auf Erden] 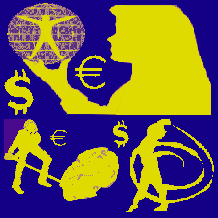 Inwiefern agieren mindestens vier ‚Wesen‘ mit-
und gegeneinander, dass eins plus eines gar zwölf an einer
zwischenmenschlich-dyadischen / zweier Beziehung Beteiligte ergäbe?
Inwiefern agieren mindestens vier ‚Wesen‘ mit-
und gegeneinander, dass eins plus eines gar zwölf an einer
zwischenmenschlich-dyadischen / zweier Beziehung Beteiligte ergäbe?
Emotionen als ‚energetische
Phänomene‘ und unser Umgang damit, äh mit/nach George Pennington:
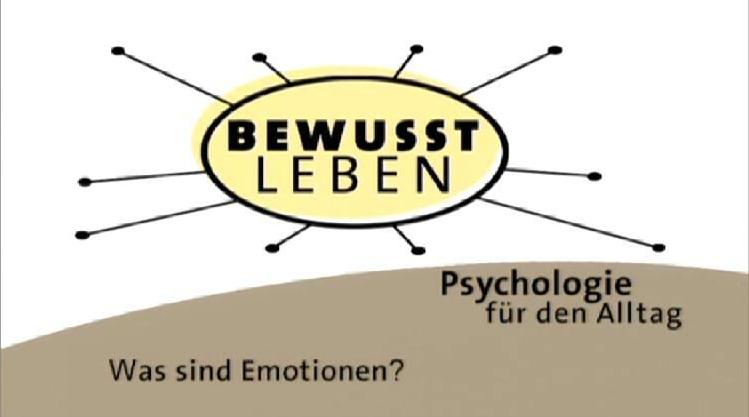 Emotionen seien [so die psycho-logische
Grundthese, nicht allein G.P.‘s 2005 bis 2014] energetische Phänomene.
Emotionen seien [so die psycho-logische
Grundthese, nicht allein G.P.‘s 2005 bis 2014] energetische Phänomene.  [Inzwischen in/von ‚der Forschung‘ /
Philosoühie durchaus anerkannt, dass auch und herade gefühlte
Emotionen beeinfluss- bis handhabbar – wenn. und gerade, auch nicht grenzenlos
/ vollständig / beliebig] Erfahrung/Erlebnis: ‚Nachts in der dunklen Wohnung den nakten Fuss angestossen – emowere
(lat.) – ‚sich herausbewegen‘
[Inzwischen in/von ‚der Forschung‘ /
Philosoühie durchaus anerkannt, dass auch und herade gefühlte
Emotionen beeinfluss- bis handhabbar – wenn. und gerade, auch nicht grenzenlos
/ vollständig / beliebig] Erfahrung/Erlebnis: ‚Nachts in der dunklen Wohnung den nakten Fuss angestossen – emowere
(lat.) – ‚sich herausbewegen‘  [Kennen Sie, Euer
Gnaden, das?]
[Kennen Sie, Euer
Gnaden, das?]
![]() zuerst wisse der betroffene Mensch
„es im“ ‚Markgrafenzimmer der Bewusstheiten‘.
[Vgl.
allerdings bereits Ludwig Wittgensteins,
im doppelten Sinne, ‚merkwürdige‘,
berechtigte Warnung vor, indes wissenschaftlich
angesehenen Arten einer Vorstellung
‚das Denken finde im Kopf
verortet (gar [nur] mit Hilfels des, bis durchs, Gehirns) statt‘; O.G.J.]
zuerst wisse der betroffene Mensch
„es im“ ‚Markgrafenzimmer der Bewusstheiten‘.
[Vgl.
allerdings bereits Ludwig Wittgensteins,
im doppelten Sinne, ‚merkwürdige‘,
berechtigte Warnung vor, indes wissenschaftlich
angesehenen Arten einer Vorstellung
‚das Denken finde im Kopf
verortet (gar [nur] mit Hilfels des, bis durchs, Gehirns) statt‘; O.G.J.]
„Auh ja, das war jetzt blöd, das wird gleich
fürchterlich weh tun.“
![]() und dann kommt dieser
Schwall hoch, (Energie die ausgedrückt werden will)
und dann kommt dieser
Schwall hoch, (Energie die ausgedrückt werden will)
![]() dann tut's weh und Sie beginnen zu hüpfen und vieleicht
zu schreinen, wenn's schlimm wird.
dann tut's weh und Sie beginnen zu hüpfen und vieleicht
zu schreinen, wenn's schlimm wird.
Ein geswundes [sic!] Kind wird schreien wenn es sich angehauen hat. Das ist der natürliche Weg der Emotion, dass sie sich herausbewegt, dass sie Ausdruck findet.
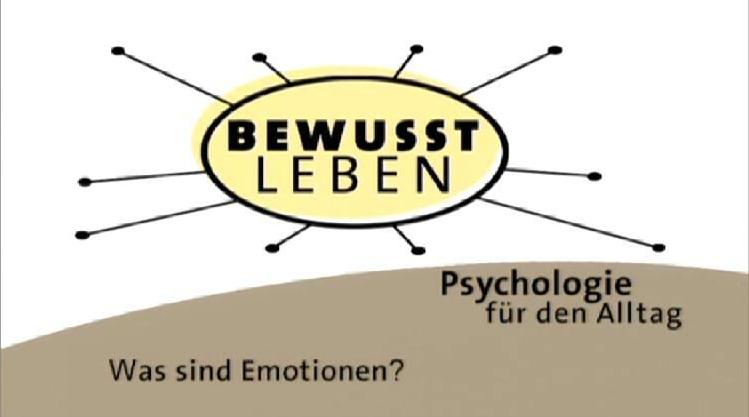 Energie will fließen (vgl. Physik) Haue man
sich den Fuss an, könne man dem Schmerzschwall der hochkomme
eine Größenordnung z.B. 20 kp zuweisen, wenn's nicht all zu schwer war.
Vielleicht auch 40 falls wirklich stark angehauen. Energie die eben fließen
wolle.
Energie will fließen (vgl. Physik) Haue man
sich den Fuss an, könne man dem Schmerzschwall der hochkomme
eine Größenordnung z.B. 20 kp zuweisen, wenn's nicht all zu schwer war.
Vielleicht auch 40 falls wirklich stark angehauen. Energie die eben fließen
wolle. 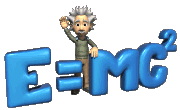 [Zwar wissen
wir / Physiker nicht was Materie und Energie
sind, doch manche
[Zwar wissen
wir / Physiker nicht was Materie und Energie
sind, doch manche ihrer äquivalenten
Eigenschaften lassen sich in/an/unter realen Objekten von Ja bis Nein zählen, messen, wiegen]
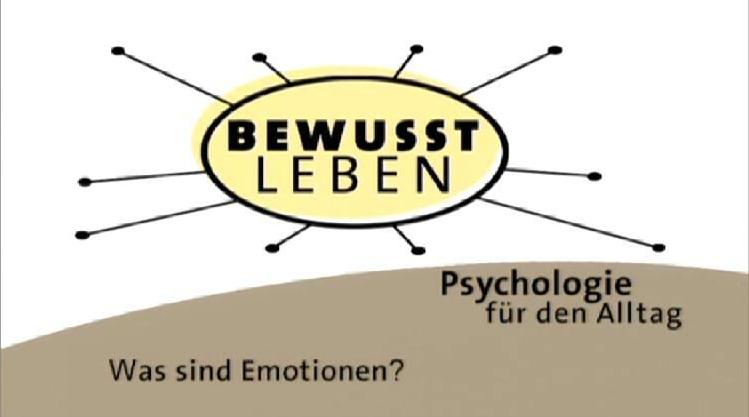 100% Lebensenergie Baby strahlt grundlos,
100% Lebensenergie Baby strahlt grundlos,
eine ganz unglaubliche Lebensfreude "Für die Psychologie gehen wir einmal davon aus, dass es einen Zustand gibt, in dem Sie einfach strahlen."
![]() billiger als Extase mach ich's nicht G.P. möchte sein
Leben möglichst in der Gegend verbringen.
billiger als Extase mach ich's nicht G.P. möchte sein
Leben möglichst in der Gegend verbringen.
Der amerikanische Künstler Abdul Manti Klarwain, entwarf die ersten Santana-Alben, der von sich sagte von sich:
![]() my frame of refernce is extasy "Für uns
Normalsterbliche genügt es" von der Existsnz eines 100% Levels auszugehen,
Dem wir uns möglichst nähern wollen würden.
my frame of refernce is extasy "Für uns
Normalsterbliche genügt es" von der Existsnz eines 100% Levels auszugehen,
Dem wir uns möglichst nähern wollen würden.
![]() eingeschränkt durch Fuss anhhauen oder Luft
in Baby-Bauch
eingeschränkt durch Fuss anhhauen oder Luft
in Baby-Bauch
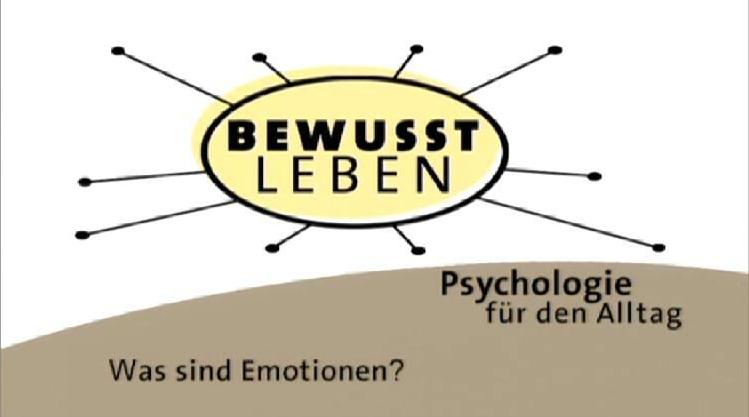 Das Baby liegt falsch, der Arm ist eingeklemmt
sie haben irgendeinen kleinen Schmerz und den drücken sie dann vollkommen
unbeeinträchtigt aus, ,bis der Schmerz[impuls] weg ist Das heißt sie brüllen. bis der Schmerz
sich[sic!] ausgebrüllt hat; die Energie dieses Schmerzes erschöpft ist. G.P.
erinnert exemplarisch seine 4-jährige Tochter auf deren Geburtagsfest.
Das Baby liegt falsch, der Arm ist eingeklemmt
sie haben irgendeinen kleinen Schmerz und den drücken sie dann vollkommen
unbeeinträchtigt aus, ,bis der Schmerz[impuls] weg ist Das heißt sie brüllen. bis der Schmerz
sich[sic!] ausgebrüllt hat; die Energie dieses Schmerzes erschöpft ist. G.P.
erinnert exemplarisch seine 4-jährige Tochter auf deren Geburtagsfest.
![]() der natürliche Weg - wo noch nicht so
der natürliche Weg - wo noch nicht so
erzogen ist dass Ausdruck unterdrückt wird Wo ein Kind noch nicht so erzogen ist, dass es sich dieses Äußerungen apart, werde die Energie so Ausgedrückt.
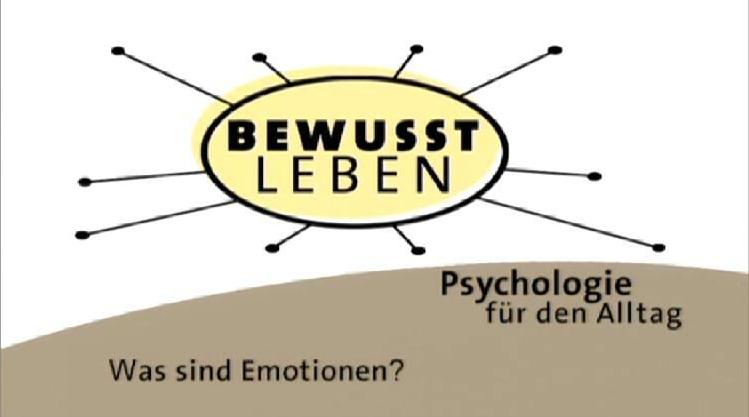 Jetzt lernen wird aber: auf Schulhof kommt's
nicht so gut, Indiuaner kennt keinen Sxchmerz/Heulsuse -- unmittelbarer
Schmerzausdruch wird beeinträchtigt -
Jetzt lernen wird aber: auf Schulhof kommt's
nicht so gut, Indiuaner kennt keinen Sxchmerz/Heulsuse -- unmittelbarer
Schmerzausdruch wird beeinträchtigt -
![]() aber die Energie ist noch da! Illustration
mit Erlebnis G.P.'s
aber die Energie ist noch da! Illustration
mit Erlebnis G.P.'s
![]() 60 kp die Frau mit Stiletto vor ihm auf
60 kp die Frau mit Stiletto vor ihm auf
seinen Fuss ausübte drängen heraus es/ich
bräuchte weitere 60 gibt 120 kp
negativ dagegen um nicht zu brüllen Frau im dichtgedrängtenLlondoner Bus in/mit
Stilettoabsatz trat ihn und G.P. brüllte wie kaum je einer zuvor.
"Aber als
die Frau sich umdrehte, war ich schon wieder am Grinsen, weil der Ausdruck
dieses Schmerzes war so berfreiend gewesen ... die Energie war erschöpft und
ich hab ihr gesagt: Machen Sie sich keine Sorgen, das passiert."
Wäre er aber so erzogen, dass er in der Öffentlichkeit nicht schreit, diese Energie nicht fließen lässt - sie hemmt.
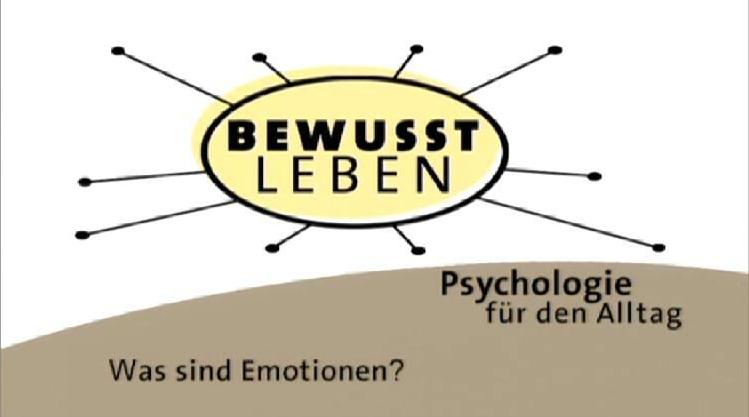 Nächste Option mit der Energie dieses
Nächste Option mit der Energie dieses
Schmerzes umzugehen: Wut/Zorn - weil
nicht unmittelbar ausdrückbar, tue ich
anderen zurück weh [Naxime]: böse Worte
oder Zurückrempeln findet oft statt [O.G.J: Doch ist – etwa mit P.S. wider die
weniger geglückten Folgen S. Freuds etal (Ähnliches
gilt gerade mit M.S. für des großen Siegismuds zu ‚elektrische‘ Vorstellung der Movens-Energien) – zu ergänzen
bzw. zu differenzieren, dass Wut und Zorn weder dasselbe noch, dass zumindest der thymotische Grundantrieb des Selbsts dahinter, der gerne
(auch nicht nur
gelungenerweise) ‚Stolz‘ genannt wird (und nicht selten ‚Selbstbewusstsein‘ bis
Selbstrespeckt meint / befeindet), nur
negativ, gar zerstörerisch ist bzw. sein müsste:
Sondern auch (bis gerade ausgerechnet) diese Emotion (des GiMMeLs) eine/die unternehmerische anderen Leuten etwas
denen Mehrwert nützliches anbietend, bis spendende / vertragstreue (respektive in Wettbewerb mit ihnen/darum zu
treten bereite) Komponenten hat.
G.P. hätte ja auch die Alternative gehabt der Frau auch mit Worten weh zu tun, ihr auch auf den Fuss zu steigen etc. um die Energie so fließen zu lassen. „Und das findet oft genug statt, ‚tust Du mir weh, tue ich Dir auch weh.‘“
![]() ein Teil der Energieflßt in Audruck und man kann irgendwann zu den
[sic!] 100% Strahlen zurückkehren
ein Teil der Energieflßt in Audruck und man kann irgendwann zu den
[sic!] 100% Strahlen zurückkehren
![]() wenn ich mir auch das verkneiffe ist die
Energie immer noch da.
wenn ich mir auch das verkneiffe ist die
Energie immer noch da.
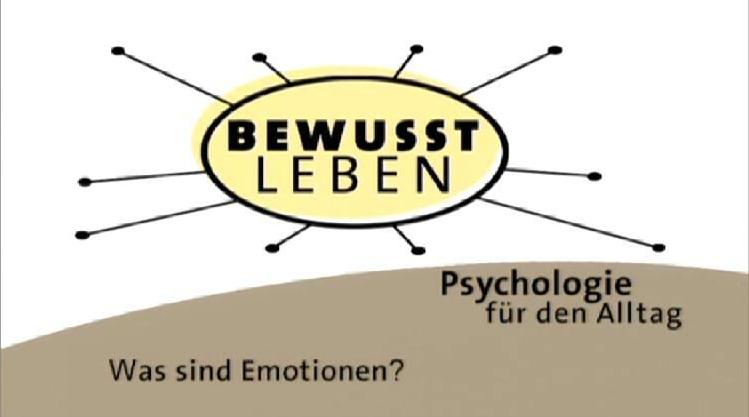 nächste (noch beherrschtere) Option - ich
nächste (noch beherrschtere) Option - ich
bilde mir eine Meinung, werde rational
(über Pöbel in Verkehrsmitteln im
Allgemeinen und über dicke Frauen mit
Stilettos im Besonderen) und es ist keine schmeichelhafte Meinung, das
weiss ich.
Ich werde meine
Meinung jedem der sie hören will zum Besten geben.
![]() werde jemand suchen der die Meinung teilt und
mit ihm eine Fahrgemeinschaft bilden Und wir werden uns immer wieder unsere
Meinung bestätigen. Dass es einfach unzumutbar ist in den öffentlichen
Verkehrsmitteln, diem Volkt ausgeliefert zu sein.
werde jemand suchen der die Meinung teilt und
mit ihm eine Fahrgemeinschaft bilden Und wir werden uns immer wieder unsere
Meinung bestätigen. Dass es einfach unzumutbar ist in den öffentlichen
Verkehrsmitteln, diem Volkt ausgeliefert zu sein.
![]() hierher gehöre auch der Hass ist
kaltgewordene Wut/Zorn kondensierrt in schlecher Meinung über jemand/etwas
hierher gehöre auch der Hass ist
kaltgewordene Wut/Zorn kondensierrt in schlecher Meinung über jemand/etwas
![]() hier geht es dann ums: recht-haben
hier geht es dann ums: recht-haben
![]() Ausdruck ist ein ganz kleiner leicht grinsendes
Gesicht
Ausdruck ist ein ganz kleiner leicht grinsendes
Gesicht
"Ich verarbeite die Energie nicht mehr durch herausfließen lassen, emovere ...
![]() Energie landet unter Schädeldecke,
Energie landet unter Schädeldecke,
Emotion kommt als bla-bla heraus nur
Dampfablassen Schallplatenartig wiederholend. Stammtische hätten diese
Ventilfunktion.
"Die Menschen leben mit solcher Energoe in sich, es will eigentlich was raus aber sie beherrschen sich. Aber gelegntlich müssen sie Damof ablassen und da dient der Stammtisch dazu."
![]() Dazu kann auch durch Sport dienen "wenn
Menschen innerlich unter Spannung stehen wenn die Energie nicht fließt. Köbbeb sie
in den Sport gehen und diese Energie verbrennen. Das Prch ist, dass der
Zusammenhang nicht klar wird und, dass man diese Energie jeden Tag neu
verbrennen muss. Und das hilft nicht wahnsinnig."
Dazu kann auch durch Sport dienen "wenn
Menschen innerlich unter Spannung stehen wenn die Energie nicht fließt. Köbbeb sie
in den Sport gehen und diese Energie verbrennen. Das Prch ist, dass der
Zusammenhang nicht klar wird und, dass man diese Energie jeden Tag neu
verbrennen muss. Und das hilft nicht wahnsinnig."
![]() diese
Rationalisten sind beliebt - bewahren
diese
Rationalisten sind beliebt - bewahren
immer einen kühlen Kopf, kaltes Blut - sind
als Ratgeber beliebt stehen aber meist unter hohem (innerem) Druck. Und haben gelernt damit zu leben. [O.G.K.: Gar durchaus produktiv damit umzugehen, die Energie auszunutzen nicht ausgeschlossen. Insofern mag auch Zorn, sich ärgern ein wirksamer Motivator (immerhin für die eher kleine Gruppe der meist einzelnen Intellektuellen i.e.S.) sein.]
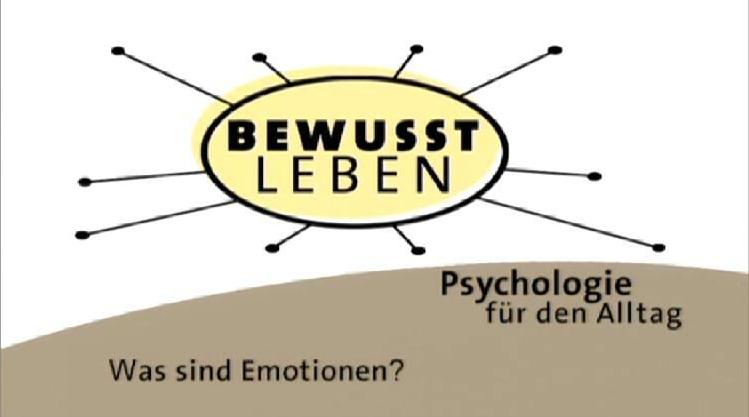 Interessant sei, dass Schmerz, Wut/Zorn und
Interessant sei, dass Schmerz, Wut/Zorn und
Hass/Ratio sich gegenseitig bedingend
zusammenhängen.
![]() und wenn es gut geht, dass man sich auf
und wenn es gut geht, dass man sich auf
dieser Ebene installiert, kann man damit
leben
![]() wo es nicht gut geht - mich selbst zerfrisst wenn der innere
Sruck zuviel wird und der Spannungszustand frisst dann kann ich (gar
persönlichkeitsverändernden; O.G.J.) Schaden nehmen daran.
wo es nicht gut geht - mich selbst zerfrisst wenn der innere
Sruck zuviel wird und der Spannungszustand frisst dann kann ich (gar
persönlichkeitsverändernden; O.G.J.) Schaden nehmen daran.
"Hier geht es noch weiter, das wird Gegenstand unserer nächsten Sendung sein. Wichtig ist mir im Moment, dass Sie sich überlegen,:
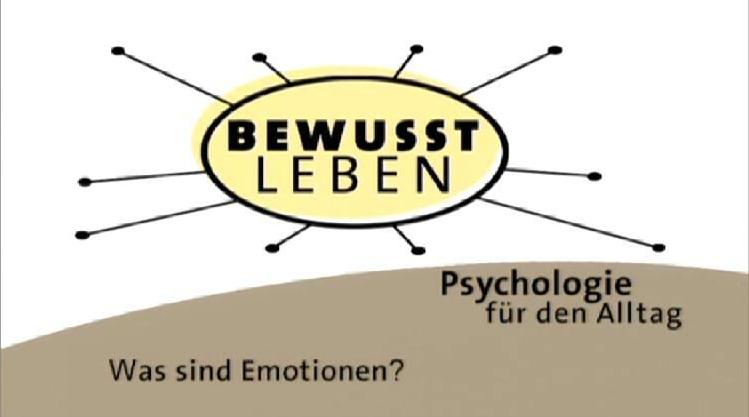 Gefühle sind energetische Phänomene
Gefühle sind energetische Phänomene
-Energie will fliessen
![]() es ist natürlich
gut sich beherrschen zu
es ist natürlich
gut sich beherrschen zu
Können manchmasl muss man das - einfach zum Selbstschutz.
![]() wenn Polizist ums Eck ist kann ich vielleicht
wenn Polizist ums Eck ist kann ich vielleicht
Brüller loslassen - oder so was tue gut dem Poölizist der Strafzettel gibt kann ich keine knallen, das kostet zu viel - aber abreagieren wenn er gegangen sei. [O.G.J. wobei jüngere Forschung - im Widerspruch zu S. Freud - zeigt, dass es auch hier sehr darauf ankommt wie das Abreagieren erfolgt, dass etwa das Einprügeln auf Gegenstände, das Rache bzw. 'Ausgleich nehmen' an Sich (selbst)/Anderen (Untergebenen) die Potenziale eher verstärkt, den vermindert.]
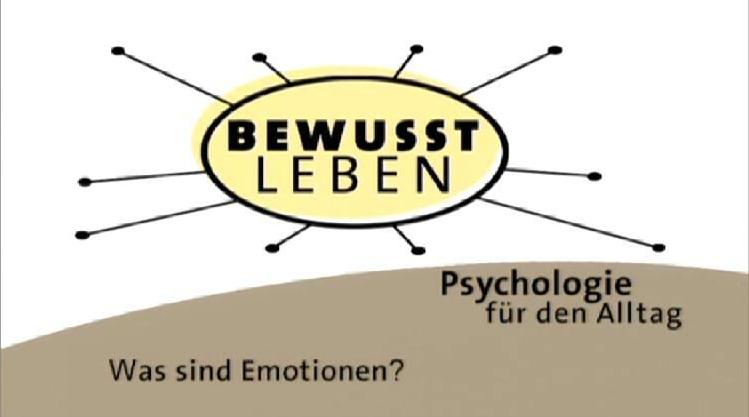 ZEICHNUNG zu 6. + 7. O.G.J. sucht noch
besser passende Analogie/Sprache für 100% Lebensenergie bzw. Lebensfreude und
deren Einschränkung bzw, den Energie-(rück?)-Fluss.
ZEICHNUNG zu 6. + 7. O.G.J. sucht noch
besser passende Analogie/Sprache für 100% Lebensenergie bzw. Lebensfreude und
deren Einschränkung bzw, den Energie-(rück?)-Fluss.
![]() Strahlender Zustand des Menschen - 100%
verfügbare Lebensenergie, etwa bei Babys (Sonnenscheinchen)
Strahlender Zustand des Menschen - 100%
verfügbare Lebensenergie, etwa bei Babys (Sonnenscheinchen)
![]() Einschränkungen durch
Einschränkungen durch
"SCHMERZ-Ereignisse
![]() AUSDRUCK: Baby brüllt/blärrt sich
AUSDRUCK: Baby brüllt/blärrt sich
uneingeschränkt aus/zurück nach oben
100%
![]() Einschränkung des Unmittelbaren Ausdrucks
Einschränkung des Unmittelbaren Ausdrucks
durch Interessen und Erziehung
![]() WUT / ZORN
WUT / ZORN
![]() auch so fließt ein Teil der Energie in den
auch so fließt ein Teil der Energie in den
Ausdruck
![]() HASS/RATIO
HASS/RATIO
![]() geht um recht-haben, Meinungen
geht um recht-haben, Meinungen
![]() leicht grinsender kleiner Ausdruck in
leicht grinsender kleiner Ausdruck in
Sprechblasen
![]()
![]()
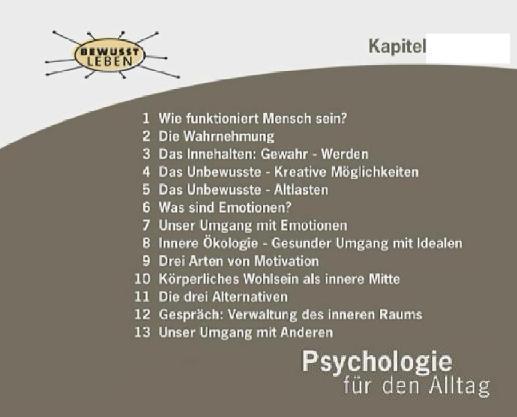 7././13
Unser Umgang mit Emotionen
7././13
Unser Umgang mit Emotionen
![]()
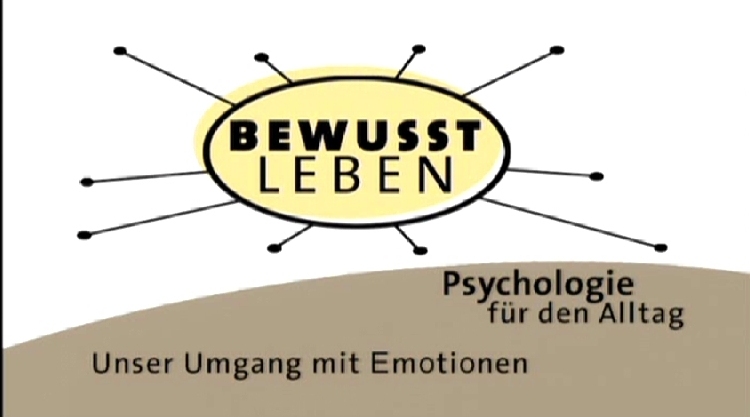
![]()
 [Der Baron und seine, bis Eure,
Helfer haben schon ganze Arbeit geleistet]
[Der Baron und seine, bis Eure,
Helfer haben schon ganze Arbeit geleistet]
Denn allein mit ‚Trainings‘ sind/werden
‚inneren ArchivarInnen‘eben nicht zufrieden, nicht einmal das immerhin hinreichend erreichte Ergebnis allein würde, oder
sollte, genügen (denn sonst / dabei / dazu käme es nicht
hinreichend auf das [weitere] Ergehen / Befinden des und er einzelnen Menschen
an. – Kennformel: Vor dem Ankommen wird gewarnz; P.W.):
Das, gar nicht so selten – bis durchaus (gut
erklärlich) als ‚Blasphemie‘ – verschriene Kernkonzept bewussten, bis ups vernünftig,
und auch noch ups-ups (selbst-)verwalteten Lebens חיים – ‚reduziert‘
respektive – auf/um mehr als ‚richtig oder falsch‘-Logiken – erweitert ‚sich‘ (hier) nämlich auf oh Schreck dreierlei: ‘love it‘, ‘change it‘ or ‚‘leave it‘ nennbare Optionen.
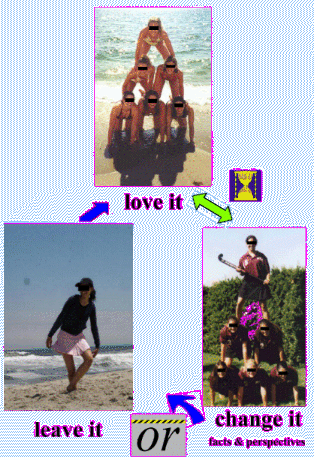 [Wie auch immer – ob also per
‘change or leave‘ – Euer Gnaden aus der ‚(mehr oder minder)
hass-geliebten (gar, zu gerne /
durchschaubar, sogenannten)
Komfort-Zone‘ aktuellen Daseins ‚geraten/d‘ …
bleibt der Kaiserturm des Werdens, näher am, ja
Bestandteil des, qualifiziert durchaus ups
erlaubten ‘love it‘]
[Wie auch immer – ob also per
‘change or leave‘ – Euer Gnaden aus der ‚(mehr oder minder)
hass-geliebten (gar, zu gerne /
durchschaubar, sogenannten)
Komfort-Zone‘ aktuellen Daseins ‚geraten/d‘ …
bleibt der Kaiserturm des Werdens, näher am, ja
Bestandteil des, qualifiziert durchaus ups
erlaubten ‘love it‘]
[Vera F. Birkenbiel]  8./22: Emotionales Management - Sprachgefühl
entwickeln (Kopfspiele 12.11.2004
8./22: Emotionales Management - Sprachgefühl
entwickeln (Kopfspiele 12.11.2004 ![]() )
)
![]() Geschichte
vom Morseoperatoer (Stellenbewerbern)
Geschichte
vom Morseoperatoer (Stellenbewerbern) 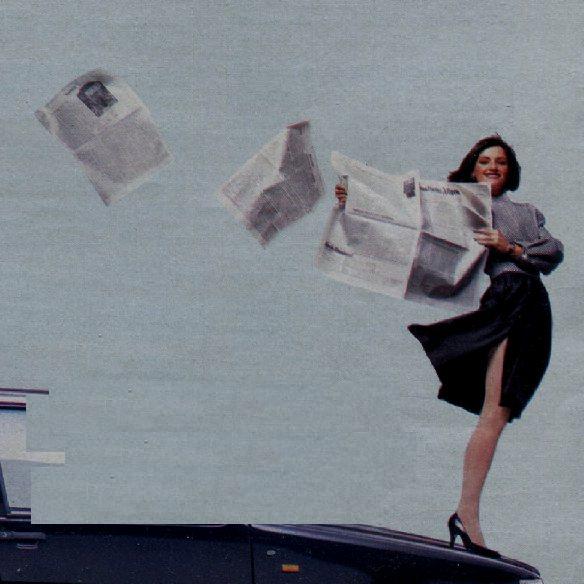 Zu Beginn der 1920er Jahre in New York mit
großer Arbeitslosigkeit. Es meldeten sich ca. 300 Leute auf ausgeschriebene
Stelle als Morse-Operator. Die Firma hatte auf der einen Seite der Halle einige
kleine Interviewräume eingerichtet. Die ankommenden erhielten laufende Nummern,
natürlich gab es nicht genügend Stühle. Viele setzten sich gottergeben auf den
Boden um zu warten. Es war heiß im Hintergrund wurde gehämmert. Da erscheint
ein junger Mann der die Nummer 254 erhielt. Auch er setzt sich auf den Boden.
Doch nach ungefähr zwei Minuten, steht er plötzlich auf und geht zielstrebig
zur anderen Seite der Halle zu einem kleinen Raum. Kopft an, wartet nicht und
geht einfach hinein. Nach einigen Minzten kommt er wieder heraus aus dem Raum
begleitet von einem älteren Mann. Der den anderen mitteilt, sie könnten jetzt
nach hause gehen. Der Job sei gerade vergeben worden, an jenen jungen Mann.
Zu Beginn der 1920er Jahre in New York mit
großer Arbeitslosigkeit. Es meldeten sich ca. 300 Leute auf ausgeschriebene
Stelle als Morse-Operator. Die Firma hatte auf der einen Seite der Halle einige
kleine Interviewräume eingerichtet. Die ankommenden erhielten laufende Nummern,
natürlich gab es nicht genügend Stühle. Viele setzten sich gottergeben auf den
Boden um zu warten. Es war heiß im Hintergrund wurde gehämmert. Da erscheint
ein junger Mann der die Nummer 254 erhielt. Auch er setzt sich auf den Boden.
Doch nach ungefähr zwei Minuten, steht er plötzlich auf und geht zielstrebig
zur anderen Seite der Halle zu einem kleinen Raum. Kopft an, wartet nicht und
geht einfach hinein. Nach einigen Minzten kommt er wieder heraus aus dem Raum
begleitet von einem älteren Mann. Der den anderen mitteilt, sie könnten jetzt
nach hause gehen. Der Job sei gerade vergeben worden, an jenen jungen Mann.
![]() Drei Fragen ‚dazu‘:
Drei Fragen ‚dazu‘:
![]() Frage 1: wären Sie unter den Wartenden
gewesen, was hätten Sie jetzt empfinden (nicht denken - gefühlt)
Frage 1: wären Sie unter den Wartenden
gewesen, was hätten Sie jetzt empfinden (nicht denken - gefühlt)
![]() Frage 2: Denken Sie an Person Ihrer Wahl,
schlagen Sie in Buch beliebige Stelle auf und lesen Sie einen Abschnitt. Passt
er zu der Person? -
Frage 2: Denken Sie an Person Ihrer Wahl,
schlagen Sie in Buch beliebige Stelle auf und lesen Sie einen Abschnitt. Passt
er zu der Person? - ![]() Nur als Ablenkungsfrage fungierend.
Nur als Ablenkungsfrage fungierend.
![]() Frage 3: Es geht um Assoziationen. Satzanfang
mit ersten Wort das einfällt beenden: Die Welt ist voller ......
Frage 3: Es geht um Assoziationen. Satzanfang
mit ersten Wort das einfällt beenden: Die Welt ist voller ......
![]() Es fragt sich: Wo ist Ihre emotionale
Heimat?
Es fragt sich: Wo ist Ihre emotionale
Heimat? 
![]() Stehaufnännchen haben ein Gewicht eingebaut, eine Methapher für Ihre
emotionale Haltung.
Stehaufnännchen haben ein Gewicht eingebaut, eine Methapher für Ihre
emotionale Haltung.
![]() Behauptung:
Morsegeschichte war sehr negativ emotional,
Behauptung:
Morsegeschichte war sehr negativ emotional,
![]() aber dann
wurden Sie abgelent - Sie hätten die Möglichkeit gehabt, sich wieder
aufzurichten.
aber dann
wurden Sie abgelent - Sie hätten die Möglichkeit gehabt, sich wieder
aufzurichten.
![]() und Leute, die
relativ häufig in solch negativer Position sind, befinden suich auch jetzt noch
darin - diese brauchen länger um sich wieder freuen
zu können.
und Leute, die
relativ häufig in solch negativer Position sind, befinden suich auch jetzt noch
darin - diese brauchen länger um sich wieder freuen
zu können.
![]() Menschen, die
‚positiver‘ (auf die dritte der Fragen) antworten, sind hier günstiger
gelagert.
Menschen, die
‚positiver‘ (auf die dritte der Fragen) antworten, sind hier günstiger
gelagert.
![]() Zweitens: Wir sehen diese Geschichte ziemlich ‚negativ‘ -
aber
Zweitens: Wir sehen diese Geschichte ziemlich ‚negativ‘ -
aber
![]() zwar wurde
dauernd, in Mosesprache. Gehämmert: ‚wenn du den Job wilklst geh zur anderen
Seite in das kleine Zimmer und du hasst ihn.‘
zwar wurde
dauernd, in Mosesprache. Gehämmert: ‚wenn du den Job wilklst geh zur anderen
Seite in das kleine Zimmer und du hasst ihn.‘
![]() doch alle
hätten einen Job bekommen können. - Da sassen lauter Morseprofis. Warum hörte
es nur einer?
doch alle
hätten einen Job bekommen können. - Da sassen lauter Morseprofis. Warum hörte
es nur einer?
![]() Weil die anderen da sassen und sich geärgert
haben über die vielen, die ihnen Job wegnehmen. Wie unfair die Welt doch ist; statt
Weil die anderen da sassen und sich geärgert
haben über die vielen, die ihnen Job wegnehmen. Wie unfair die Welt doch ist; statt  Service-Gedanken (etwa, was sie der firma zu
bieten hätten) zu hegen.
Service-Gedanken (etwa, was sie der firma zu
bieten hätten) zu hegen.
![]() Viele Leute
haben keine ‚klaren Ziele‘ im Leben.
Viele Leute
haben keine ‚klaren Ziele‘ im Leben. 
Wenn wir wissen, wo wir eigentlich hinwollen (bis: ‚und gar dürfen/können‘; O.g.j.), dann hören und sehen wir viel mehr.
Geschichte von Trainerkollegen, der Filme machen wollte und Tv-Leute am Nebentisch bemerkte.
![]() Wir hatten 95% schlechte Resultate bei
Firmen, die ihre Mitarbeiter nötigten zu V.F.B.-Seminar zu gehen.
Wir hatten 95% schlechte Resultate bei
Firmen, die ihre Mitarbeiter nötigten zu V.F.B.-Seminar zu gehen.
![]() in/von den
mieisten Gruppen liegen Negativantworten bei 75%.
in/von den
mieisten Gruppen liegen Negativantworten bei 75%.
![]() Angelsachsen,
Holländer etc. geben weitaus positivere Antworten, als Deutsche.
Angelsachsen,
Holländer etc. geben weitaus positivere Antworten, als Deutsche.
![]() Selbst bei
den besten Gruppen, die sie je hatte, gab es nicht mehr als 60-65% positive
Ergebnisse.
Selbst bei
den besten Gruppen, die sie je hatte, gab es nicht mehr als 60-65% positive
Ergebnisse.
![]() These: Genetische [sic!] Programmierung [sic!] darauf
Negatives stärker wahrzunehmen, da es eine Gefahr bedeuten kann!
These: Genetische [sic!] Programmierung [sic!] darauf
Negatives stärker wahrzunehmen, da es eine Gefahr bedeuten kann!
![]() Wie kommen wir raus, wenn wir sehen:
‚ich hänge (im Stimmungstief) drin‘?
Wie kommen wir raus, wenn wir sehen:
‚ich hänge (im Stimmungstief) drin‘?  [Ups m/ein ‚Achtsamkeiten-Ding‘:
Stimmungswandel beflügelnde
Wörter / ‚Stadt-Land-Fluss‘-ABCs bis Denkweisen daran/damit]
[Ups m/ein ‚Achtsamkeiten-Ding‘:
Stimmungswandel beflügelnde
Wörter / ‚Stadt-Land-Fluss‘-ABCs bis Denkweisen daran/damit]
![]() Dankbarkeits ABC-Listen
Dankbarkeits ABC-Listen
![]() nach der bedingungslosen liebe [sic!] zu der [sic!] wir meist nur sekundenlang (bis gar eher Tieren [‚oder Pflanzen‘; etwa A.K.] gegnüber) ‚fähig‘, sei DANK
die imunsystemstärkendste ‚Sache‘/דבר.
nach der bedingungslosen liebe [sic!] zu der [sic!] wir meist nur sekundenlang (bis gar eher Tieren [‚oder Pflanzen‘; etwa A.K.] gegnüber) ‚fähig‘, sei DANK
die imunsystemstärkendste ‚Sache‘/דבר.
![]() Es ist eine Frage des (aktuell
verfügbaren; O.G.J.) Repertuars - jeder hat mal negative Gefühle - aber wir
können ‚schneller‘ herauspringen (respektive ups ‚autentisch hineingeraten‘; P.W.).
Es ist eine Frage des (aktuell
verfügbaren; O.G.J.) Repertuars - jeder hat mal negative Gefühle - aber wir
können ‚schneller‘ herauspringen (respektive ups ‚autentisch hineingeraten‘; P.W.).
![]() 30% höher
kommen als jemand vor Dankbarkeitsentschluss war ist realistisch.
30% höher
kommen als jemand vor Dankbarkeitsentschluss war ist realistisch.
![]() Jetzt/Dann
intellektuell arbeiten und uns ablenken (beste Strategie) fünf ABC-Listen zu
Kompetenzthema (je eine Minte lang) und ‚wir sind ganz anders drauf‘.
Jetzt/Dann
intellektuell arbeiten und uns ablenken (beste Strategie) fünf ABC-Listen zu
Kompetenzthema (je eine Minte lang) und ‚wir sind ganz anders drauf‘.
![]() „Wenn wir Wurzelziehen nicht können, können
wir Taschenrechner oder Freund zu hilfe nehmen. –
Aber wenn wir unsere Gefühle nicht managen können, kann uns unser Freund dann
auch nicht mehr helfen.“
„Wenn wir Wurzelziehen nicht können, können
wir Taschenrechner oder Freund zu hilfe nehmen. –
Aber wenn wir unsere Gefühle nicht managen können, kann uns unser Freund dann
auch nicht mehr helfen.“
 [Protokollauszugsende Sendungsmitschrift; verlinkende und andere
Hervorhebungen O.G.J.]
[Protokollauszugsende Sendungsmitschrift; verlinkende und andere
Hervorhebungen O.G.J.]  Dem, vielleicht (gar/zumal daher/vorstehend) bereits nicht mehr ganz so
brav, verammelt( vorkommend)en Stockwerken
dieses Markgrafenturms Eures Hochschlosses
zuge ...
Dem, vielleicht (gar/zumal daher/vorstehend) bereits nicht mehr ganz so
brav, verammelt( vorkommend)en Stockwerken
dieses Markgrafenturms Eures Hochschlosses
zuge ...
 Da sich/einander Muster
ähneln. [Wesen – jedenfalls
belebte/lebendige – sind und\aber werden; – ‚Überzeugtheiten‘ bemerken selbst allerdings oft auch
überwigend/gar konflikthaft/überwältigt ‚eines‘
davon berichtigend/fälschend
an/bei/für/gegen/in/mit/über sich/Anderheiten]
Da sich/einander Muster
ähneln. [Wesen – jedenfalls
belebte/lebendige – sind und\aber werden; – ‚Überzeugtheiten‘ bemerken selbst allerdings oft auch
überwigend/gar konflikthaft/überwältigt ‚eines‘
davon berichtigend/fälschend
an/bei/für/gegen/in/mit/über sich/Anderheiten]
‚Institutionell
wesentlich‘ sind/werden dabei also/eben: Dass
sämtliche, zumal Ermuterungen, bis
Ermächtigungen
(zu/durch mehr
Kompetenz/en im Umgang, gleich gar mit sich selbst), nicht alleine/erst/immer zu Überziehungen neigende/geneigte (oder gar nicht allein solche ‚ohne angemessen
nyphagoische/andragogische bis
therapeutische Begleitung/Absicherung‘ – gleich gar von ‚Warn-orientierungs-‚nahmens-‚Angst‘-Handhabungsänderungen),
gelegentlich – doch dann, (verteilungsrechnerisch) eher etwas lebensgefährlicher als der übrigen
Lebensrisiken Betroffener mehrend – (ob etwa‚erwartungs-
äh befürchtungsgemäß‘‚‘vernunftengemäß versus verliebt/liebend virtualisiert‘
oder ‚völlig unerwartbar/unwahrscheinlich, bis unverschuldet‘ – gar manchmal
immerhin/mindestens didaktisch notwendigerweisen) schiefgehen kömmem/scheitern.
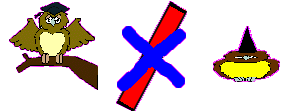 Für seriös
oder beispielsweuse (weniger) dumm/klug, halten einen entscheidender die
andern! [Nicht einmal ein
Dualismus/das Entweder-Oder welcher/s – der/des einen, äh falsches Wissen
los-werde, vermag von jenem anderer (zumal abweichend bis gegenteilig überzegt verbleibender Leute) abzutrennen]
Für seriös
oder beispielsweuse (weniger) dumm/klug, halten einen entscheidender die
andern! [Nicht einmal ein
Dualismus/das Entweder-Oder welcher/s – der/des einen, äh falsches Wissen
los-werde, vermag von jenem anderer (zumal abweichend bis gegenteilig überzegt verbleibender Leute) abzutrennen] ![]()
Jene ‚andere‘,
damit/daunten/davon allerdings
nicht ganz abtrennbare, Antwort lautet nämlich/bekanntlich – zwar in ‚modern‘
erscheinender Formulierung: ‚Auch/Gerade jene die
die ‚Lottozahlen‘/Börsenkurse der kommenden Woche mit höheren
Trefferwahrscheinlichkeiten als ‚eins zu meheren Millionen‘ vorherdokumentierten/berechneten
– kannten gerade diese Daten damals nicht!‘  [Na klar] Spätestens mehr/verbesserte
Zielereuchungen – ob etwa durch/gegen: Achtsamkeiten/Sorgfalt, Alchemie/Chemie, Algebra, Analyse, Arbeiten, Aufgabe,
…, Belieben/Willkür, Datenquantitäten/Anwendungsqualitäten, Disziplin, Erfahrungen,
Formeln, Fortune/Heil, Gerechtigkeit/Unrecht, Gnade, Humor/Hunger,
Ideen/Idiologien, Illusionen, Irrtum,
Können, Lehren, Lücken,
Mitgefühl/Liebe, Offenbahrung/überaumzeitliche Erschließungen, Opfer/Hingabe,
Pflichten/Zwänge, Raten, Rechenkapazitäten/Reduktion, Täuschung/Truig,
Überzeugththeiten/Gewissheit,
Versehen/Vorsehen, Verstehen,
Verteilen, Wählen, Widerstand/Kampf, Wollen/Sollen bis was auch immer sonst noch, #aus-,
äh# #zugefallen
–
[Na klar] Spätestens mehr/verbesserte
Zielereuchungen – ob etwa durch/gegen: Achtsamkeiten/Sorgfalt, Alchemie/Chemie, Algebra, Analyse, Arbeiten, Aufgabe,
…, Belieben/Willkür, Datenquantitäten/Anwendungsqualitäten, Disziplin, Erfahrungen,
Formeln, Fortune/Heil, Gerechtigkeit/Unrecht, Gnade, Humor/Hunger,
Ideen/Idiologien, Illusionen, Irrtum,
Können, Lehren, Lücken,
Mitgefühl/Liebe, Offenbahrung/überaumzeitliche Erschließungen, Opfer/Hingabe,
Pflichten/Zwänge, Raten, Rechenkapazitäten/Reduktion, Täuschung/Truig,
Überzeugththeiten/Gewissheit,
Versehen/Vorsehen, Verstehen,
Verteilen, Wählen, Widerstand/Kampf, Wollen/Sollen bis was auch immer sonst noch, #aus-,
äh# #zugefallen
–  [Deterministen würfeln zwar ungerne – Laplace(wahrscheinlichkeit), und Naturwissenschaften
inzwischen (mindestens aktuell, abweichende Emperie
erklären/ertragen könnend), schon]
[Deterministen würfeln zwar ungerne – Laplace(wahrscheinlichkeit), und Naturwissenschaften
inzwischen (mindestens aktuell, abweichende Emperie
erklären/ertragen könnend), schon]
überzeugen (einen/uns
selbst – von Wiederholungszuversichten bis Ansürüchen) / beeindrucken (uns/manche
Leute) /
befeinden (andere, bis eigene Leute Begehrlichkeiten) – Ereignisse/Ergebnisse heben aber das (ja-doch ‚nur‘ / jedoch ‚immerhin‘ unabwendlich ups ‚[gegenwärtig] gedeutete‘ – folglich gerne, namentlich ‚deterministisch
[opjektivierend]‘ respektive ‚für-hassend/liebend-gehalten [subjektivierend/persönlich-nehmend]‘, zu
bestreiten/ignorieren versuchte – mindestens ‚vorher‘/innerraumzeitlich) Nichtwissens-Prinzip nicht einmal höher, lösen/löschen sie schon
gar nicht auf, oder (ersetzend) ab: 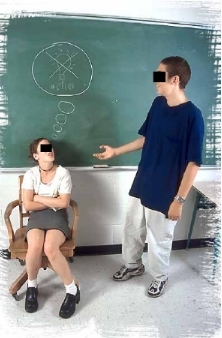 [Dürfen Tatsachen zur Theorie passen?
Wieviel sicherer/mächtiger/besser sie, er, oder es / wasEinfluss hat, fühle, äh weiss/mess/kontrolliere, ich da (nicht, wo) mein Bekenntnis / Eure Überzeugtheit (wem) besser gefällt]
[Dürfen Tatsachen zur Theorie passen?
Wieviel sicherer/mächtiger/besser sie, er, oder es / wasEinfluss hat, fühle, äh weiss/mess/kontrolliere, ich da (nicht, wo) mein Bekenntnis / Eure Überzeugtheit (wem) besser gefällt]
Das Phänomen/Problem (der ‚An- und Vorzeichen‘ glch gar was ‚beratende Berufe‘ angeht) ist jedoch, mindestens schon seit der Antike
dokumentiert, als/wo/wann immer ‚der Orakel- äh Vorhersagenvogel (selbst) abgeschossen/suiziedverdächtig wird‘. Auch ohne Hofschuhe und
Vorschlagshammer, peinlich/provokannt genog? [Wer heilt/rettet/unterlässt
hat Verantwortungen – deswegen weder recht noch unrecht, kann vielmehr beides
gar zugleich tun]
Auch ohne Hofschuhe und
Vorschlagshammer, peinlich/provokannt genog? [Wer heilt/rettet/unterlässt
hat Verantwortungen – deswegen weder recht noch unrecht, kann vielmehr beides
gar zugleich tun]
Der Werdens-, äh Kaiserturm ist noch/doch leichter mit den Selbste- äh
dem Markgrafenturm zu verwechseln, ‚als‘ gleichzusetzen.

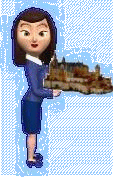 [Dazu /
Darum / Daran / Dabei nicht notwendigerweise (so. gar /
zumal ‚kausalistisch‘, auch) bemerkter Wirkungen Raum, bis Erinnerungen]
[Dazu /
Darum / Daran / Dabei nicht notwendigerweise (so. gar /
zumal ‚kausalistisch‘, auch) bemerkter Wirkungen Raum, bis Erinnerungen]
‚Im‘ Archivo nicht allein (vielmehr geradezu ‚individuell‘
angeeigneten, cis ‚erlebnisweltlich teilnehmend‘
angereicherten), doch eben auch sogenannter ‚Archetypen‘,  [Die ‚sprachliche‘ Entdeckung des Singulars, im/vom indoeuropäoschen Denken, als/zu ‚Unus mundus‘ – ‚eine/r Welt‘ repräsentiert so kaum intersubjektiv durchhaltbar]
[Die ‚sprachliche‘ Entdeckung des Singulars, im/vom indoeuropäoschen Denken, als/zu ‚Unus mundus‘ – ‚eine/r Welt‘ repräsentiert so kaum intersubjektiv durchhaltbar]
![]()
finden sich / Wir Euer Gnaden so manche Sphären,  [Seifeblasem, äh Ballonhüllen, (gleich gar des
Denkens / Empfindens) als ‚nur‘ oder / da
‚vergänglich‘ zu diffamieren bis zu verstehen
/ verwenden
– verkennt, oder verbirgt, so manche Wirkung / Wichtigkeit, zumal von Globen]
[Seifeblasem, äh Ballonhüllen, (gleich gar des
Denkens / Empfindens) als ‚nur‘ oder / da
‚vergänglich‘ zu diffamieren bis zu verstehen
/ verwenden
– verkennt, oder verbirgt, so manche Wirkung / Wichtigkeit, zumal von Globen] 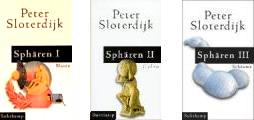
bis,
zumal / jedenfalls narrativ / ‚erzählend berichten‘, auch ![]() Sir Williams und Gothes
Sir Williams und Gothes ![]() sowie weitaus
mehr, bis recht andere, Werke – gar nicht immer nur kanonischer, oder gar bemerkter,
Gemeinsamkeiten (eines Bildungskanons – zumal
quichotesk wirkend).
sowie weitaus
mehr, bis recht andere, Werke – gar nicht immer nur kanonischer, oder gar bemerkter,
Gemeinsamkeiten (eines Bildungskanons – zumal
quichotesk wirkend). 
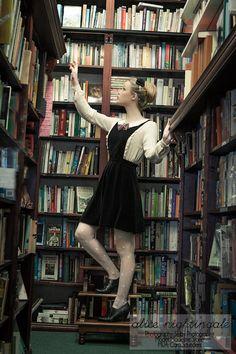

[‚Lass Dich warnen meine Tochter,
des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren ist Ermüdung des Leibes‘, bemerkte
bereits/immerhin ein König – als diese noch alle ‚von Hamd‘ … Sie wissen schon] 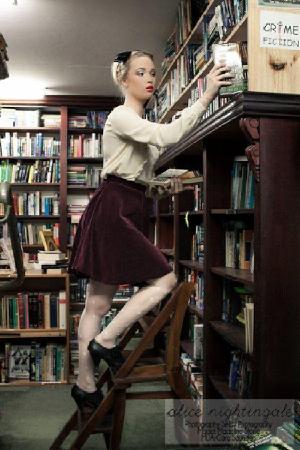
Eben
zumindest beide Seiten des bekannten ‚Faustzitates‘ kennend, als/wo ‚Mephistofeles‘ selbst bemerkte,
bis sich bekannte
– wo nicht sogar erkennend/spiegelnd:
Hier (‚hohenzollerisch‘zwar) unterhalb .![]() ‚der‘ Ungleichheitenlinie
‚der‘ Ungleichheitenlinie ![]() ‚gegenüber des‘
Burghofes allegorisiert. [Doch drei/zwei(erlei) Globen auch in/des gräflichen
Bücherbüro/s]
‚gegenüber des‘
Burghofes allegorisiert. [Doch drei/zwei(erlei) Globen auch in/des gräflichen
Bücherbüro/s]  Innen jedoch, und\aber außen –
geradezu anderswo, auf unterschiedlicher Augenhöhe?
Innen jedoch, und\aber außen –
geradezu anderswo, auf unterschiedlicher Augenhöhe? 
|
|
„Teil
jener Kraft,
die stets das Böse will, und doch das Gute schafft …“ (jedenfalls nicht
[vollständig] zu verhindern vermag) |
|
während Menschen, respektive deren innere Schweinehunde (so immrtjom
zumindest Marco von Müchhausen). „Teil jener Kraft, die
zwar stets das Gute will,
und doch das Böse (dabei nicht verhindert, bis) schafft.“ |
|
|
Zu den Auslegungsspektern des Originalzitates geheören bekanntlich
solche wie; [Abb. Yoster Büchersortierung] |
Neben der
‚Ehrenrettung‘ des Sehr-Gut-Verses
der Genesis, gar auch angesichts von deren berüchtigtem dritten Kapitel –
respektive trotz der Existens von (jedenfalls Möglichleinten zum) Bösen (tun/unterlassen). |
In die, auch im
Werk des Herrn Geheimrates ja nicht weniger zu findenden ‚Gegenteils‘ gar
komplementärer Formulierungen, Deutunghorizonte
passen auch: |
Das, wo und wie ‚gut gemeint‘ häufig, bis zumeist, das
Gegenteil von gut wird. Die verfolgte Absicht eher für das Strafmass, als für das
Hamdungsergebnis zählt. |
[Abb. Yoster Böchersorteierung] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
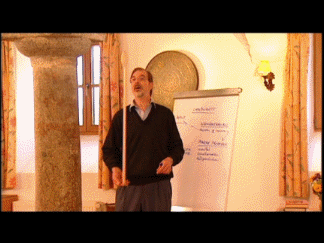 Balance-Akte. [BW – ‚Bewusstheiten‘
in mehr oder minder ‚frohen‘ Erwartungen – von ‚Hervorbringungen‘ / הבא \ ‚Kommenden Geschehens (Besuchs)‘] Gerade nicht-Intendiertes
CHßeTs stets inklusive.
Balance-Akte. [BW – ‚Bewusstheiten‘
in mehr oder minder ‚frohen‘ Erwartungen – von ‚Hervorbringungen‘ / הבא \ ‚Kommenden Geschehens (Besuchs)‘] Gerade nicht-Intendiertes
CHßeTs stets inklusive. 
Manche haben,
gar eher ‚erlebnisweltenlich‘,
teilnehmend Gemeinsamkeiten dessen bemerkt, was gar
mit / als (manch oft misslingende/r) Revernz wenigstens an/von ![]() Siegmund
Freud
brav, äh scheints
unvermeidlich, doch
deswegen nicht notwendigerweise besonders geglückt, sondern nur – da es / dieser Bildungsreflex einen einem bekannten
Namen trage – zu weitgehend für verstanden Gehalten, ‚unterbewusst‘, ‚vorbewusst‘ oder ‚unbewusst‘
zu heißen – habe (wer grammatikalisch gelten
will / müsse).
Siegmund
Freud
brav, äh scheints
unvermeidlich, doch
deswegen nicht notwendigerweise besonders geglückt, sondern nur – da es / dieser Bildungsreflex einen einem bekannten
Namen trage – zu weitgehend für verstanden Gehalten, ‚unterbewusst‘, ‚vorbewusst‘ oder ‚unbewusst‘
zu heißen – habe (wer grammatikalisch gelten
will / müsse).  Dass/Falls Sie
etwas empfinden, ob
Sie. Euer Gnaden was / wann wie
denken / nennen / sehen / tun / wünschen – ‚bekommt‘
beeinflussbare, anstatt
Dass/Falls Sie
etwas empfinden, ob
Sie. Euer Gnaden was / wann wie
denken / nennen / sehen / tun / wünschen – ‚bekommt‘
beeinflussbare, anstatt vollständig
dual bestimmte, Wirkungen. [Philosophisch/Theologisch durchaus bemerkenswert,
dass/wie die Existenz, zumal deterministisch (namentlich ‚biologistisch‘ oder ‚erbsünderisch‘) damit Gemeintens
weitaus weniger bestritten wird, als jene
diesbezüglich ernst zu nehmender Bewusstheiten,
dass sie/wir verantwortungsfähig bedingt frei]
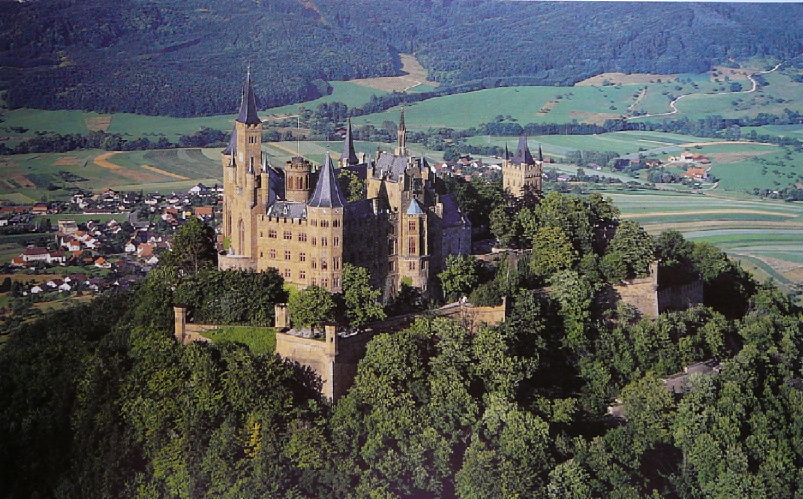 Basal
unten im/vom südwestspitzlichen, grenzenhandhaben Markgrafenturm – archivierend.
Basal
unten im/vom südwestspitzlichen, grenzenhandhaben Markgrafenturm – archivierend.
[Scharfeckbastei meines/Eures faktischen Verhaltens – als hier/sogesehen vorderstem Festungspunkt, der Wahl-Entscheidung/en unter/aus: ‚Gut , Böse/Schlecht WaW װ dazwischen-nicht-entschieden‘ urteilend, aus dem Wald / Fels / Berg aufsteigend – aber unter dem hier recht zentral ‚vordersten‘, eben zumindest auch ‚äußeren‘, Selbstturm Ihres/Eures ganzen Hochschlosses]
#hierfoto Mindestens eine der Opionen-Wände sieht manchmal, bis zu häufig,
geschlossen(er) wirkend aus, als/wie sie es (als-)srukturell wirksam (unvollständig
determiniert) werdend ist!
Mindestens eine der Opionen-Wände sieht manchmal, bis zu häufig,
geschlossen(er) wirkend aus, als/wie sie es (als-)srukturell wirksam (unvollständig
determiniert) werdend ist!
#George Pennington
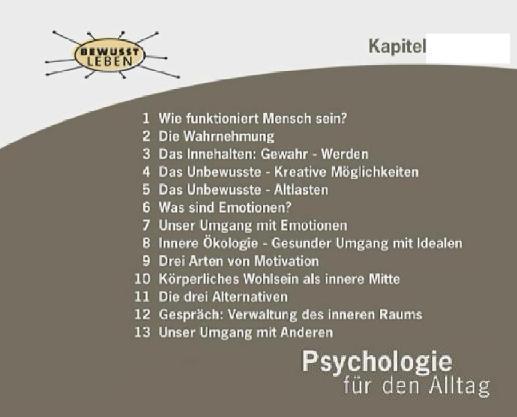 4./13 Das Unbewusste [sic!] 1/2 - Kreative Möglichkeiten unseres ‚Inneren Archivars‘: Was jeder Mensch, gar zum Teil
in persönlicher/individueller Weise, undװaber des Weiteren ‚soziokulturell
figuriert‘ bis geradezu menschenheitlich ‚gemeinsam‘ habe/hat!
4./13 Das Unbewusste [sic!] 1/2 - Kreative Möglichkeiten unseres ‚Inneren Archivars‘: Was jeder Mensch, gar zum Teil
in persönlicher/individueller Weise, undװaber des Weiteren ‚soziokulturell
figuriert‘ bis geradezu menschenheitlich ‚gemeinsam‘ habe/hat!

![]()
![]()
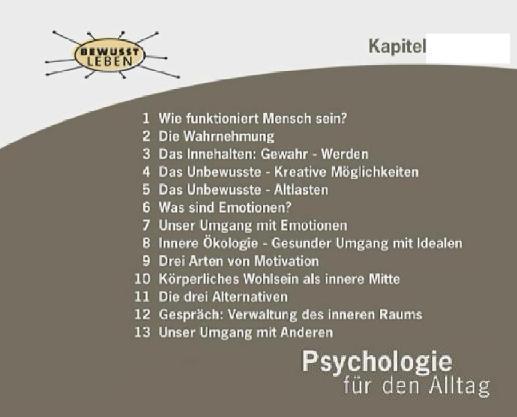 5./13 Das Unbewusste [sic!] 2/2 – Altlasten: Behinderung kreativer, bis auch anderer,
Möglichkeiten des ‚Inneren Archivars‘ mancher – gar nicht notwendigerweise
aller – Menschen, mit/von 'Altlasten' auf dem Tisch alarmiert (was einen so
beeinträchtigen kann, dass sich Nachforschungen zu deren Erledigung / Ablage
lohnen).
5./13 Das Unbewusste [sic!] 2/2 – Altlasten: Behinderung kreativer, bis auch anderer,
Möglichkeiten des ‚Inneren Archivars‘ mancher – gar nicht notwendigerweise
aller – Menschen, mit/von 'Altlasten' auf dem Tisch alarmiert (was einen so
beeinträchtigen kann, dass sich Nachforschungen zu deren Erledigung / Ablage
lohnen).
![]()
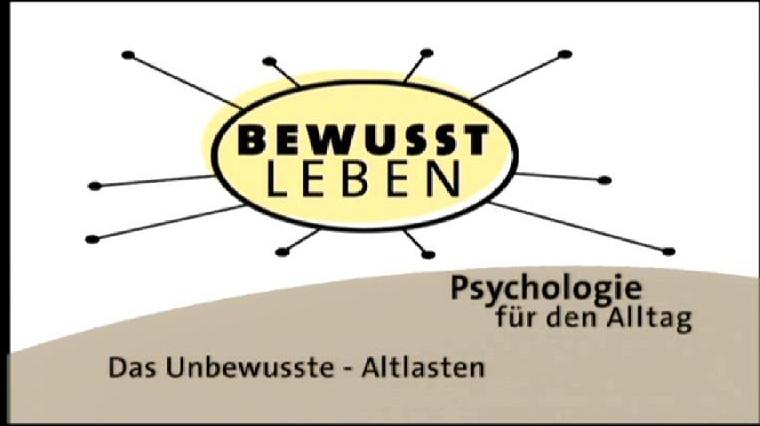
![]()
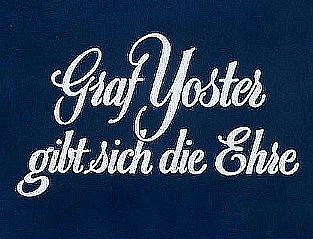
 Strategische
Ausrüstung bis ups Aufrüstzeug,
gar/auch/immerhin/wenigstens zur Handhabung
des ‚inneren Schweinehundes‘, mit M.v.M. & Co.:
Strategische
Ausrüstung bis ups Aufrüstzeug,
gar/auch/immerhin/wenigstens zur Handhabung
des ‚inneren Schweinehundes‘, mit M.v.M. & Co.:  [Hier bellt der innere Schweinehund:
[Hier bellt der innere Schweinehund: ![]() „Zumindest (so manche) Gefühle haben mich, so
wie es eben deren Art, emotionalst gebeten und beauftragt, sie alle variabel
bei/für Dero Gnaden / Ihnen / Sie schuldig
‚zu vertreten‘ / repräsentieren“]
„Zumindest (so manche) Gefühle haben mich, so
wie es eben deren Art, emotionalst gebeten und beauftragt, sie alle variabel
bei/für Dero Gnaden / Ihnen / Sie schuldig
‚zu vertreten‘ / repräsentieren“]
![]() „Den Schweinehund
akzeptieren“ (2004, S. 104) fällt oft, und viel zu lange, so schwer,
da/ss dagegen die heftigsten und meisten Disziplinen aufgeboten sind/werden.
„Den Schweinehund
akzeptieren“ (2004, S. 104) fällt oft, und viel zu lange, so schwer,
da/ss dagegen die heftigsten und meisten Disziplinen aufgeboten sind/werden.
 [Ups – blendend überraschendes, gar Aha-Erlebnis-Licht, beim Öffnen des,
bis Eintritt ins, jedenfalls /
wenigstens ‚hohenzollerische Markgrafenzimmer‘,
hier Euer Gnaden Bewussheitensalon]
[Ups – blendend überraschendes, gar Aha-Erlebnis-Licht, beim Öffnen des,
bis Eintritt ins, jedenfalls /
wenigstens ‚hohenzollerische Markgrafenzimmer‘,
hier Euer Gnaden Bewussheitensalon]

„Je mehr man den inneren Schweinehund
bekämpft, umso häufiger wird man es mit ihm zu tun haben.“ Und: „Je größer der Druck,desto bissiger der Schweinehund.“
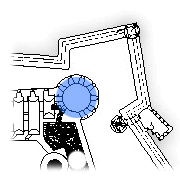 [Dualistische
Einfachheit / Zweiwertige Kontrastmaximierung
verführt zu Ausfällen wider sich selbst / Anderheiten / Ungeheuerlichkeiten]
Denn so diese wissenschaftliche,
bis philosophische, Kernthese:
„Solange wir einen Teil von
uns bekämpfen, bekämpfen wir uns
selber. Erst wenn wir es schaffen, diesen Teil anzunehmen
und zu integrieren, kommen wir weiter!“ Zumal auf Wegen zur
/ von der Erkenntnis: „Ich
habe wohl einen inneren Schweinehund, aber ich bin nicht mit diesem identisch.“ So wenig wie mit sonst irgend einer meiner (gleich gar ob – wozu/wogegen – namentlich
drunten ‚guten‘ oder ‚schlechten‘) Eigenschaften, Handlung(sweis)en, oder etwa einem Körperteil, bis dem ganzen Leib, oder ‚Hirn‘.
[Dualistische
Einfachheit / Zweiwertige Kontrastmaximierung
verführt zu Ausfällen wider sich selbst / Anderheiten / Ungeheuerlichkeiten]
Denn so diese wissenschaftliche,
bis philosophische, Kernthese:
„Solange wir einen Teil von
uns bekämpfen, bekämpfen wir uns
selber. Erst wenn wir es schaffen, diesen Teil anzunehmen
und zu integrieren, kommen wir weiter!“ Zumal auf Wegen zur
/ von der Erkenntnis: „Ich
habe wohl einen inneren Schweinehund, aber ich bin nicht mit diesem identisch.“ So wenig wie mit sonst irgend einer meiner (gleich gar ob – wozu/wogegen – namentlich
drunten ‚guten‘ oder ‚schlechten‘) Eigenschaften, Handlung(sweis)en, oder etwa einem Körperteil, bis dem ganzen Leib, oder ‚Hirn‘.
 [Ein kleiner, enger Zwischenraum, von der Bibliothek des Erfahrungenflügels
her, ermöglicht, bis erlaubt,
manchen/m, manchmal Zutritt zur
Audienz, droben im Bewusstheiten-Salon]
[Ein kleiner, enger Zwischenraum, von der Bibliothek des Erfahrungenflügels
her, ermöglicht, bis erlaubt,
manchen/m, manchmal Zutritt zur
Audienz, droben im Bewusstheiten-Salon]
![]() „Die Macht [sic!] der Sprache“ (2004,
S. 114) sollte die Wahlentscheidungen welche Formulierungs-
bzw. Denk-Weisen
jemand verwendet, weder verharmlosen noch tarnen dürfen. Doch be- und
anerkannt:
„Die Macht [sic!] der Sprache“ (2004,
S. 114) sollte die Wahlentscheidungen welche Formulierungs-
bzw. Denk-Weisen
jemand verwendet, weder verharmlosen noch tarnen dürfen. Doch be- und
anerkannt:  Wess das ‚Herz‘ /lew/
voll ist, des geht der Mund /peh/ über.
Wess das ‚Herz‘ /lew/
voll ist, des geht der Mund /peh/ über.
 [Der basale /remez/ רמז dass Menschen ‚nichts lieber tun‘, als von
‚N/Wichtigkeiten ihrer eigenen ups
Insel‘ zu erzählen, ist nämlich,
weder als unvermeidliche Notwendigkeit (dafür die Zustimmung aller zu finden/bekommen), noch (bei/trotz allen forensisch erkennbaren Charakteristika) als
Automatismus (dafür die einzig richtigen Worte/Zeichen zu
verwenden) zu
missdeuten]
[Der basale /remez/ רמז dass Menschen ‚nichts lieber tun‘, als von
‚N/Wichtigkeiten ihrer eigenen ups
Insel‘ zu erzählen, ist nämlich,
weder als unvermeidliche Notwendigkeit (dafür die Zustimmung aller zu finden/bekommen), noch (bei/trotz allen forensisch erkennbaren Charakteristika) als
Automatismus (dafür die einzig richtigen Worte/Zeichen zu
verwenden) zu
missdeuten] 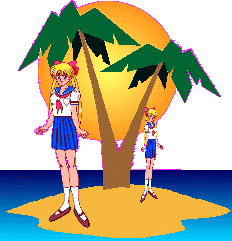
![]() „Von der hohen Kunst der Selbstmotivation“ (2004, S. 122)
„Von der hohen Kunst der Selbstmotivation“ (2004, S. 122)  [‚Fremdmotivation‘
scheitert, streng genommen,
bereits/spätestens daran, dass/wo die-motivieren -S/Wollenden nicht (beliebig) für einen handeln (können – gerade ‚restriktive
Gewaltanwendungen‘ und ‚Unterlassungen‘, wie ‚Stellvertretungen‘, bis gar Bedienstete
/ ‚Nachkommen‘, erhebliche Grenzen haben/‚finden‘):
[‚Fremdmotivation‘
scheitert, streng genommen,
bereits/spätestens daran, dass/wo die-motivieren -S/Wollenden nicht (beliebig) für einen handeln (können – gerade ‚restriktive
Gewaltanwendungen‘ und ‚Unterlassungen‘, wie ‚Stellvertretungen‘, bis gar Bedienstete
/ ‚Nachkommen‘, erhebliche Grenzen haben/‚finden‘): 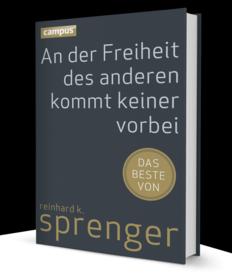 Motive, (auch
übernommene, geteilte, gemeinsame An- und Einsichten) nicht einmal eigene/überzeugende zur/als/anstatt der/für die Tat ‚springen‘. – Nicht einmal wie ‚des
archivierenden Grafen Zofen‘ manchmal überall ‚altlastend hinterher rennen‘]
Motive, (auch
übernommene, geteilte, gemeinsame An- und Einsichten) nicht einmal eigene/überzeugende zur/als/anstatt der/für die Tat ‚springen‘. – Nicht einmal wie ‚des
archivierenden Grafen Zofen‘ manchmal überall ‚altlastend hinterher rennen‘]  Motivationspsychologisch seien ‚Selbstmotivation‘ und ‚Selbstkontrolle‘ die wesentlichsten Faktoren [unabhängig angenommen Variablen; O.G.J. nicht nur
solche Forschungsansätze ‚zulassend‘] ‚emotionaler Intelligenz‘,
die als
entscheidender
für Erfolgsaussichten
gälten als ‚analytisch-akademische‘-IQs / חכמה :„Wie kann ich meinen kleinen inneren Schweinehund, der
keine Zeitvorstellung hat und alle Bedürfnisse sofort
befreidigen möchte, so im Zaum halten, dass ich meine langfristigen Ziele
und die dami t verbundenen [sic! jedenfalls ‚erwarteten / versprochenen‘:
O.G.J. vorsichtiger / entzaubernd] größeren Gewinne
doch erreichen
kann?“
Motivationspsychologisch seien ‚Selbstmotivation‘ und ‚Selbstkontrolle‘ die wesentlichsten Faktoren [unabhängig angenommen Variablen; O.G.J. nicht nur
solche Forschungsansätze ‚zulassend‘] ‚emotionaler Intelligenz‘,
die als
entscheidender
für Erfolgsaussichten
gälten als ‚analytisch-akademische‘-IQs / חכמה :„Wie kann ich meinen kleinen inneren Schweinehund, der
keine Zeitvorstellung hat und alle Bedürfnisse sofort
befreidigen möchte, so im Zaum halten, dass ich meine langfristigen Ziele
und die dami t verbundenen [sic! jedenfalls ‚erwarteten / versprochenen‘:
O.G.J. vorsichtiger / entzaubernd] größeren Gewinne
doch erreichen
kann?“  [Gleichwohl, bis zudem, stets von
‚peinlich/‚schicksalhaft‘
ins Rutschen geraten könnenden Szenarien‘ – gar des (Vertrauens-)/der Gefangenen- und anderer Dilemmas /
Tri- bis Multilemmatas, teils immerhin wahrscheinlich( erreichbarer, bis kaum
erreichbar)er – doch nie garantierter größerer/besserer Zukunftserwartungen
bedrohbar, und zumindest wiederholt nachjustierungsbedürftig;
Jede(r) Belohnung(sbegriff) – zumal quantitativ
größere, doch auch qualitativ andere (hier
etwa ‚innere Stimmigkeit‘, ‚intrinsischer flow‘ pp.) – Ihrer/Eurer Ernteaussichten
steht/bleibt unter den Vorwürfen eines äußeren Reizes, doch werden ‚innere‘ Antriebe davon/so nicht etwa weniger
affizierbar/immun wider heteronomistische ‚Fremd‘-Einflüsse zur Manipulation der ‚Arbeitsmoral‘]
[Gleichwohl, bis zudem, stets von
‚peinlich/‚schicksalhaft‘
ins Rutschen geraten könnenden Szenarien‘ – gar des (Vertrauens-)/der Gefangenen- und anderer Dilemmas /
Tri- bis Multilemmatas, teils immerhin wahrscheinlich( erreichbarer, bis kaum
erreichbar)er – doch nie garantierter größerer/besserer Zukunftserwartungen
bedrohbar, und zumindest wiederholt nachjustierungsbedürftig;
Jede(r) Belohnung(sbegriff) – zumal quantitativ
größere, doch auch qualitativ andere (hier
etwa ‚innere Stimmigkeit‘, ‚intrinsischer flow‘ pp.) – Ihrer/Eurer Ernteaussichten
steht/bleibt unter den Vorwürfen eines äußeren Reizes, doch werden ‚innere‘ Antriebe davon/so nicht etwa weniger
affizierbar/immun wider heteronomistische ‚Fremd‘-Einflüsse zur Manipulation der ‚Arbeitsmoral‘]
 [‚Zuckerpuppe‘ äh Zucker-Fett-Brot und\aber
Peitsche – in/aus der Manege:
Gerade V.F.B. wiest darauf hin, dass bei
zu wenig (Änderungs-/Übungs-)Zeit ‚Durchpauken‘ zumutbar / verantwortlich,
statt ständige, ausschließliche Empfehlung; vgl. bereits
[‚Zuckerpuppe‘ äh Zucker-Fett-Brot und\aber
Peitsche – in/aus der Manege:
Gerade V.F.B. wiest darauf hin, dass bei
zu wenig (Änderungs-/Übungs-)Zeit ‚Durchpauken‘ zumutbar / verantwortlich,
statt ständige, ausschließliche Empfehlung; vgl. bereits ![]() Niel Postman]
Niel Postman]
![]() Herzbergs-Modell
der »kick in the ass«-Strategie (K.I.T.A. der vielmals erprobten Motivationsmethode mittels Druck,
Drohungen, Strafen, Sanktionen, Anbrüllen, Vorhaltungen,
Schlechtes-Gewissen-Bereiten ...) bis gesetzlichem/sonstigem
restriktivem Zwang; O.G.J. stätestens
‚pandemisch‘
Herzbergs-Modell
der »kick in the ass«-Strategie (K.I.T.A. der vielmals erprobten Motivationsmethode mittels Druck,
Drohungen, Strafen, Sanktionen, Anbrüllen, Vorhaltungen,
Schlechtes-Gewissen-Bereiten ...) bis gesetzlichem/sonstigem
restriktivem Zwang; O.G.J. stätestens
‚pandemisch‘
![]() [Ups,
sollten hier Anreize durch positive
und negative Sanktionen, sowohl als
unzureichend wie als ‚uneinzig(e Möglichkeit)‘, kritisiert … immerhin des
Aufwandes / der Unbequemlichkeiten
Mehrung ist (wehrkraftzersetzend)
garantiert gewiss]
[Ups,
sollten hier Anreize durch positive
und negative Sanktionen, sowohl als
unzureichend wie als ‚uneinzig(e Möglichkeit)‘, kritisiert … immerhin des
Aufwandes / der Unbequemlichkeiten
Mehrung ist (wehrkraftzersetzend)
garantiert gewiss] ![]()
und der ‚Karotten(-dem-Esel-Vorhalte)‘-Strategie („Hier handelt es sich um die Motivationsmethode mittels Belohnungen, Prämien, Tantiemen, Beförderung, Lob,
Anerkennung, Schmeichel- und Streicheleinheiten ... Auch sie wird mit
Erfolg eingesetzt von Vorgesetzten, von Partnern,
von Eltern und von uns selbst.“) zeige die beiden gängigsten, nicht
nur Esel betreffenden, Motivationsmethoden
auf; die jedoch unzureichend, da der Druck nie nachlassen dürfe, während – zumal getretene, auf Rache sinnende – innere
Schweinehunde alle Sabotagetricks einsetzten; und sich Belohnungen
abnutzen. So dass etwa ‚nur des Geldes wegen‘ arbeitende
[sic! Verachtungsgefahren von Notwendigkeiten / Unangenehmen, äh vertragstreuen
Tauschhandels ligen
(‚motivational‘ askese-libertinistisch verdächtig) reflexhaft nahe;
O.G.J. aspektisch demotivationsorientiert bis vernutzungsskeptisch] Menschen keine ‚Erfüllung‘ dabei finden,
solche anderswo
suchen etc. (vgl. zumal sinkende Grenznutzeneffekte der
Ökonomie, bis der Süchte; O.G.J. mit E.G.B./‚Klassikern‘ etal.). 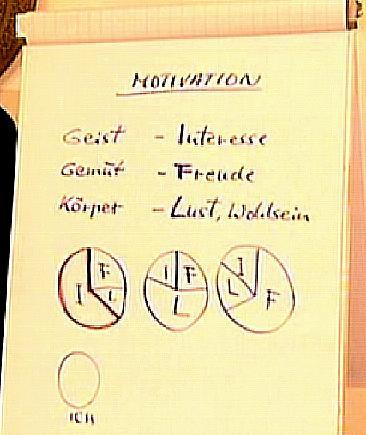 Da, äh
falls bis wo, D/m/eine
Ausstattung / Begabung / Eignung / Neigung in der Minderheit … Sie wissen schon. [An (gar als ‚echt/eigentlich‘ bezeichnet, bis diffamierend – da sich Menschen
auch, bis gerade/letztlich stets, selbst
[zumal trotz/wegen/wider Andere/n]
‚unter Druck bringen‘ bzw. ‚anreizen‘) ‚intrinsischen‘ Motivationskategorien/Faktoren
finden sich (jedenfalls mit/bei G.P. respektive Ne.He.) ohnehin und eher ‚nur‘, doch
dreierlei/viererlei ‘flow‘-ermöglichende: ‚Interesse/n‘/Orientierungen (ups
‚Wert/Ideale‘ nicht mal ausschließend, statt perfektionistisch vergottend), ‚Freu(n)de‘ (ups gar ‚Thymotisches‘ inbegriffen) und/oder ‚Lust‘ (ups
gar ‚hedonistisch‘ pp. beschimpfte ‚Neigung‘; vgl. bis Heinrich Heine wider
Immanuel Kant / Pflicht-Ethiken) daran/dazu/damit was
einem jeweils talentegemäß, begabt liegt]
Da, äh
falls bis wo, D/m/eine
Ausstattung / Begabung / Eignung / Neigung in der Minderheit … Sie wissen schon. [An (gar als ‚echt/eigentlich‘ bezeichnet, bis diffamierend – da sich Menschen
auch, bis gerade/letztlich stets, selbst
[zumal trotz/wegen/wider Andere/n]
‚unter Druck bringen‘ bzw. ‚anreizen‘) ‚intrinsischen‘ Motivationskategorien/Faktoren
finden sich (jedenfalls mit/bei G.P. respektive Ne.He.) ohnehin und eher ‚nur‘, doch
dreierlei/viererlei ‘flow‘-ermöglichende: ‚Interesse/n‘/Orientierungen (ups
‚Wert/Ideale‘ nicht mal ausschließend, statt perfektionistisch vergottend), ‚Freu(n)de‘ (ups gar ‚Thymotisches‘ inbegriffen) und/oder ‚Lust‘ (ups
gar ‚hedonistisch‘ pp. beschimpfte ‚Neigung‘; vgl. bis Heinrich Heine wider
Immanuel Kant / Pflicht-Ethiken) daran/dazu/damit was
einem jeweils talentegemäß, begabt liegt] 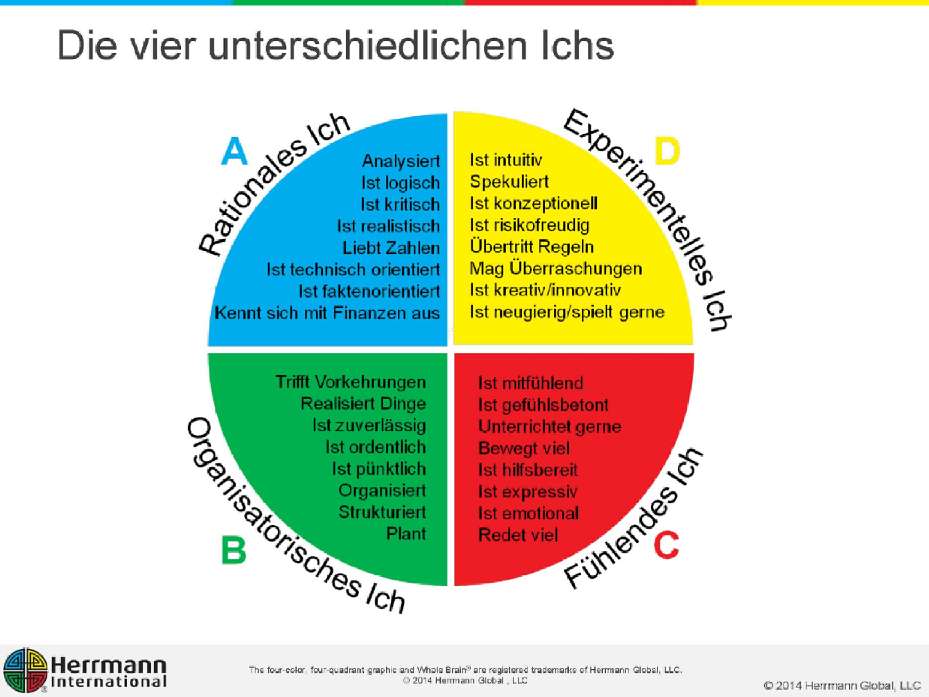
 Politisch aufgeladene Begrifflichkeiten
aufgeben / finden / provozieren / reklamieeren / retten / verbieten /
verweigern-!/? [‚Querdenken‘ ein, bis das, Rezept gegen/bei
‚mehr des Selben‘-Überbietungen, äh Überziehungen/Überzeugtheit] Sichtweisenwechsel weder immer
Politisch aufgeladene Begrifflichkeiten
aufgeben / finden / provozieren / reklamieeren / retten / verbieten /
verweigern-!/? [‚Querdenken‘ ein, bis das, Rezept gegen/bei
‚mehr des Selben‘-Überbietungen, äh Überziehungen/Überzeugtheit] Sichtweisenwechsel weder immer schwächend/untreu,
noch Sympatie/n für Falsches bis Unbeliebte/s erzwingend.
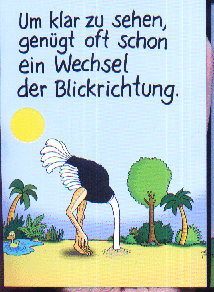
![]() Strategisches Rüstzeug in
fünf Schritten (2004, S. 137)
Strategisches Rüstzeug in
fünf Schritten (2004, S. 137) 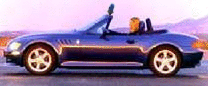 [Welche/Die sich, gar nicht so selten, als wesentlich gewaltigere Sprünge erweisen, als dies (bei/an/in/mit so
‚infantristisch‘ kleinen Schritten) scheinen mag –
bereitstehendes ‚Einsatzfahrzeug‘ keineswegs ausgeschlossen]
[Welche/Die sich, gar nicht so selten, als wesentlich gewaltigere Sprünge erweisen, als dies (bei/an/in/mit so
‚infantristisch‘ kleinen Schritten) scheinen mag –
bereitstehendes ‚Einsatzfahrzeug‘ keineswegs ausgeschlossen]
![]() [‚Misstraue/t
dem Offensichtlichen!‘] Schritt 1: Eindeutige [sic!] Entscheidung, ‚wirklich [sic! also ‚wirksam überzeugt‘;
O.G.J.] wissend warum, was geschehen soll‘. Alles andere als einfach, da
es die Aspekte/Komplexitäten auf (zumal ups dafür, derzeit,
hier/lokal/situativ) Wesentliches
reduzieren soll, bis
kann.
[‚Misstraue/t
dem Offensichtlichen!‘] Schritt 1: Eindeutige [sic!] Entscheidung, ‚wirklich [sic! also ‚wirksam überzeugt‘;
O.G.J.] wissend warum, was geschehen soll‘. Alles andere als einfach, da
es die Aspekte/Komplexitäten auf (zumal ups dafür, derzeit,
hier/lokal/situativ) Wesentliches
reduzieren soll, bis
kann. _returning_wheelchair_ladies%20doubles_final_Wimbledon2017-Getty815331984.jpg) [Ist dieses Ziel
/ dieser Weg / soviel dieses Mittels überhaupt meiner/s (gleich gar eigenes/r oder wem/was
‚zuliebe‘ wie akzeptabel/tragfähig)? (vgl. B.B. bis Bo.Gr.:
Unterwegs doch „gut für andere“ plus „gut für mich“-Fragen
beantwortend)]
[Ist dieses Ziel
/ dieser Weg / soviel dieses Mittels überhaupt meiner/s (gleich gar eigenes/r oder wem/was
‚zuliebe‘ wie akzeptabel/tragfähig)? (vgl. B.B. bis Bo.Gr.:
Unterwegs doch „gut für andere“ plus „gut für mich“-Fragen
beantwortend)]
![]() [] Schritt
2: Klare, realistische und machbare,
Zielplanung – „Wir brauchen
schon im Vorfeld das Gefühl der Machbarkeit.“ Namentlich um sich überwinden
zu können. „Teilen Sie ein größeres Projekt (wie man eine Salami in feine
Scheiben schneidet [wissenschaftsfachsprachlich: ‚inkrementalistisch‘]) in
kleine, überschaubare und zeitlich begrenzte Einheiten, die Sie dann in kleinen
Schritten etappenweise angehen.“ Und zwar stets:
[] Schritt
2: Klare, realistische und machbare,
Zielplanung – „Wir brauchen
schon im Vorfeld das Gefühl der Machbarkeit.“ Namentlich um sich überwinden
zu können. „Teilen Sie ein größeres Projekt (wie man eine Salami in feine
Scheiben schneidet [wissenschaftsfachsprachlich: ‚inkrementalistisch‘]) in
kleine, überschaubare und zeitlich begrenzte Einheiten, die Sie dann in kleinen
Schritten etappenweise angehen.“ Und zwar stets: ![]() positiv und exakt formuliert (Hinweisschilder
nicht beachten gelingt nämlich nicht!
Etwa sagen was - statt das-zu-Lassende zu betonen – getan wird);
positiv und exakt formuliert (Hinweisschilder
nicht beachten gelingt nämlich nicht!
Etwa sagen was - statt das-zu-Lassende zu betonen – getan wird); ![]() konkret
messbare Ziele;
konkret
messbare Ziele; ![]() schriftlich und fest terminiert;
schriftlich und fest terminiert; ![]() mit
leuchtendem ‚innerem Zielbild (zur Widerstandsminderung) und (beschleunigendem)
Film‘ [‚virtueller Realität‘ sich in verwendend/angekommen sehend; V.F.B.] vorgehen.
mit
leuchtendem ‚innerem Zielbild (zur Widerstandsminderung) und (beschleunigendem)
Film‘ [‚virtueller Realität‘ sich in verwendend/angekommen sehend; V.F.B.] vorgehen.
![]() [‚Notfalls‘ wenigstens/immerhin, anstatt
‚nur‘-denkend/sagend, virtualita anfangen]
Schritt 3: Mit der Ausführung möglichst sofort beginnen,
[weder planlos, noch nur mit vollem Eifer (zu Lasten von allem/n übrigen)]
lieber zu 80% gut machen, als 100%tig unterlassen: Durchhalten und Weitermachen.
[‚Notfalls‘ wenigstens/immerhin, anstatt
‚nur‘-denkend/sagend, virtualita anfangen]
Schritt 3: Mit der Ausführung möglichst sofort beginnen,
[weder planlos, noch nur mit vollem Eifer (zu Lasten von allem/n übrigen)]
lieber zu 80% gut machen, als 100%tig unterlassen: Durchhalten und Weitermachen. ![]() nsbesondere Letzteres ist, scheint jedenfalls,
zeitweilig durch ‚Disziplin‘ ersetzbar – bereits was sogenannte
‘work-life-balance‘, bis
‚Lebenswertes erlebt zu haben‘, angeht drohen die(se
durchaus) Er-Folgen schnell/häufig
prekär zu wirken.
nsbesondere Letzteres ist, scheint jedenfalls,
zeitweilig durch ‚Disziplin‘ ersetzbar – bereits was sogenannte
‘work-life-balance‘, bis
‚Lebenswertes erlebt zu haben‘, angeht drohen die(se
durchaus) Er-Folgen schnell/häufig
prekär zu wirken.
![]() [Vertrauensschädlicher Prüfungsverzicht] Schritt
4: ups Kontrolle der Zwischenergebnisse.
[Vertrauensschädlicher Prüfungsverzicht] Schritt
4: ups Kontrolle der Zwischenergebnisse. ![]() Zumal weil/wenn ich es selbst gemacht habe, muss
es weder stimmen (gibt es dennoch keine richtige Reaktion; G.P.), noch
fehlerhaft/unzureichend sein. ‚Politisch‘ das heißt was auch andere Beteiligte,
bzw. sich dafür haltende, zumal da davon Betroffene, angeht, bleibt (David ben
Gurion’s) Regel/Empfehlung: ‚Erfolge sind immer und nur gemeinsam( erreicht)e.
– Niederlagen benenne ich ausschließlich und alleine als die meinigen.
Zumal weil/wenn ich es selbst gemacht habe, muss
es weder stimmen (gibt es dennoch keine richtige Reaktion; G.P.), noch
fehlerhaft/unzureichend sein. ‚Politisch‘ das heißt was auch andere Beteiligte,
bzw. sich dafür haltende, zumal da davon Betroffene, angeht, bleibt (David ben
Gurion’s) Regel/Empfehlung: ‚Erfolge sind immer und nur gemeinsam( erreicht)e.
– Niederlagen benenne ich ausschließlich und alleine als die meinigen.
![]() [Asketische
Vergehen plus/ohne
libertinistische
Überhöhungen] Schritt 5: Belohnung
nicht vergessen[/zumal die ‚weniger-davon‘s einsparen]!
[Asketische
Vergehen plus/ohne
libertinistische
Überhöhungen] Schritt 5: Belohnung
nicht vergessen[/zumal die ‚weniger-davon‘s einsparen]! ![]() Zumindest
haben die anderen, die Umstände etc. (und/also ich) es nicht geschaft mein
‚soweit‘-/hierher-Kommen zu verhindern, dies/mich gar
eher/mindestens geduldet, bis (trotz/wegen allem, oder gar unabhängig davon also
respekt-qualifiziert) anerkannt.
Zumindest
haben die anderen, die Umstände etc. (und/also ich) es nicht geschaft mein
‚soweit‘-/hierher-Kommen zu verhindern, dies/mich gar
eher/mindestens geduldet, bis (trotz/wegen allem, oder gar unabhängig davon also
respekt-qualifiziert) anerkannt.
![]() Spezialtipps für dauerhafte Verhaltensänderungen (2004, 173)
Spezialtipps für dauerhafte Verhaltensänderungen (2004, 173) 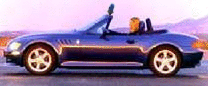 [Einsatzbereite Besatzung/Hundehalter]
[Einsatzbereite Besatzung/Hundehalter]
![]() Warum so mühsam? Änderungen fallen häufig schwer denn: „In der Phase des
Schweinehund-Rückens mag die Rendite
geringer sein als das Investment. Ab
dem »Point of no Return« steigt der »Return on Investment« jedoch an.”
Warum so mühsam? Änderungen fallen häufig schwer denn: „In der Phase des
Schweinehund-Rückens mag die Rendite
geringer sein als das Investment. Ab
dem »Point of no Return« steigt der »Return on Investment« jedoch an.” 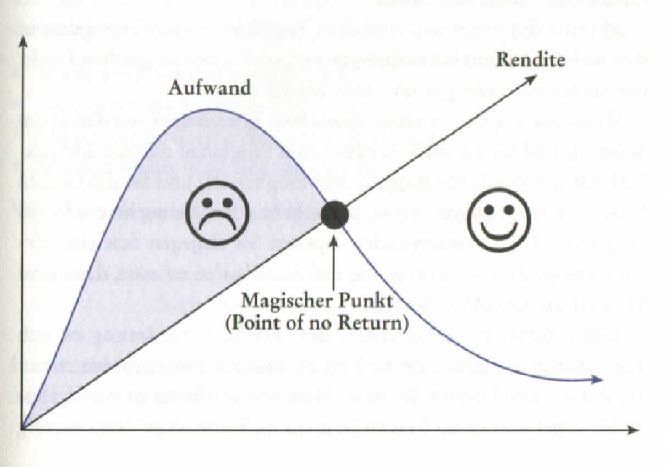 [Überwindungsprozess des Schweinehundrückens:
Den Aufwand, gegen den Strom bisheriger
Gewohnheiten,
Gewissheiten (bis gar
manches Gemurmels und Widerstreben auch
andere Leuze / Frende / Publikum) zu schwimmen, hat jede (Verhaltensänderung)
immer und sofort – ihre Nutzen (gleich gar
jene/r, irgendwann vom/im neuen Strom [Bezugsgruppen] mit- bis weitergetragen
zu werden) lassen dagegen auf sich warten;
[Überwindungsprozess des Schweinehundrückens:
Den Aufwand, gegen den Strom bisheriger
Gewohnheiten,
Gewissheiten (bis gar
manches Gemurmels und Widerstreben auch
andere Leuze / Frende / Publikum) zu schwimmen, hat jede (Verhaltensänderung)
immer und sofort – ihre Nutzen (gleich gar
jene/r, irgendwann vom/im neuen Strom [Bezugsgruppen] mit- bis weitergetragen
zu werden) lassen dagegen auf sich warten;  vgl. daher und dazu auch V.F.B.s und anderer ‚Ball im
Tor‘-Konzepte der/zur (erntenden Zwischen-)Erfolgsgetaltung, bis Pausen-Planung]
vgl. daher und dazu auch V.F.B.s und anderer ‚Ball im
Tor‘-Konzepte der/zur (erntenden Zwischen-)Erfolgsgetaltung, bis Pausen-Planung] 
![]() Wie Sie den Schweinehund-Rücken
überwinden:
Wie Sie den Schweinehund-Rücken
überwinden:
![]() Sich
den Anfang leicht machen: Fangen Sie lieber klein an - das bringt
am schnellsten Erfolgserlebnisse - und steigern Sie Ihr Pensum dann nach
und nach.
Sich
den Anfang leicht machen: Fangen Sie lieber klein an - das bringt
am schnellsten Erfolgserlebnisse - und steigern Sie Ihr Pensum dann nach
und nach.
![]() Die Kraft des Rhythmus
nutzen: Was auch immer Sie dauerhaft tun wollen, tun Sie es möglichst stets zur
selben Zeit, am selben Ort und in der gleichen Art und Weise! [Inklusive Bekleidung
und Ausrösten; O.G..J.mit V.F.B. etal. auch Prüfungsübungsrelevant] Um eine
neue Gewohnheit zu schaffen, bedarf es
der ständigen, rhythmischen Wiederholung.
Die Kraft des Rhythmus
nutzen: Was auch immer Sie dauerhaft tun wollen, tun Sie es möglichst stets zur
selben Zeit, am selben Ort und in der gleichen Art und Weise! [Inklusive Bekleidung
und Ausrösten; O.G..J.mit V.F.B. etal. auch Prüfungsübungsrelevant] Um eine
neue Gewohnheit zu schaffen, bedarf es
der ständigen, rhythmischen Wiederholung.  Disziplinenfragen-!/?_/. [Zumal. gar vertakten(d-rituell überzogenwe/überzeugt)er,
militärischer Drill baut strategisch
Komplexes aus ‘keep it simple and stupied‘-Fähigkeitenabrufbarkeiten
auf] Drillinstrukteurin gefällig?
Disziplinenfragen-!/?_/. [Zumal. gar vertakten(d-rituell überzogenwe/überzeugt)er,
militärischer Drill baut strategisch
Komplexes aus ‘keep it simple and stupied‘-Fähigkeitenabrufbarkeiten
auf] Drillinstrukteurin gefällig? 
![]() Trotz Ausnahmen am Ball bleiben! (M.v.M.m
Leherinnen, Trainer etal.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) Abwürfe,
Änderungen, Behinderungen, Enttäuschungen,
Grenzenränder, Hoheiten, Knappheitenallokation, Lernen, Lückenmanagement, Pausen, Tod,
Widerstände und andere/r
Zieleverfehlungen
kommen durchaus strittig bis
häufig, auch/sogar unabwendliche und
vorübergehende/änderbare, vor:
Trotz Ausnahmen am Ball bleiben! (M.v.M.m
Leherinnen, Trainer etal.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) Abwürfe,
Änderungen, Behinderungen, Enttäuschungen,
Grenzenränder, Hoheiten, Knappheitenallokation, Lernen, Lückenmanagement, Pausen, Tod,
Widerstände und andere/r
Zieleverfehlungen
kommen durchaus strittig bis
häufig, auch/sogar unabwendliche und
vorübergehende/änderbare, vor: 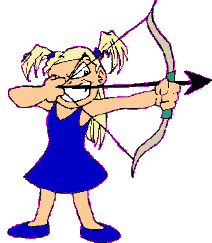 ‘Kontra-&Profaktisch‘-Erscheienendes zu
hyperrealisieren pflegen so einige mit- bis widereinander! Dass, oder ob, die Schuhe zu den Anforderungen (etwa am Amlass,
Aussehem, Funktionen, Gelände, Halt, Passform, Vorgaben, Witterung) und
Befindlichkeiten (anderer,
eigenen, gemeinsamen. … ) passen?
‘Kontra-&Profaktisch‘-Erscheienendes zu
hyperrealisieren pflegen so einige mit- bis widereinander! Dass, oder ob, die Schuhe zu den Anforderungen (etwa am Amlass,
Aussehem, Funktionen, Gelände, Halt, Passform, Vorgaben, Witterung) und
Befindlichkeiten (anderer,
eigenen, gemeinsamen. … ) passen?  [Das/Die
Askese-versus-Libertinismus-Problemsyndrom/e
handhabend/überwinden – eben/immerhin
um-zu verbimdslich
qualifiziert hinreichend zuverlässigen Verzichten auf einige fortbestehend
mögliche Affekt-Reflex-Ausfallschritte / Komplexitäten / Verhaltensoptionen / Willkürakte zu gelangen: immerhin Verbotenes möglichst
unterlassend und Vereinbahrtes anstrebend/einhaltend, bis etwa ‚Spielzüge‘, äh Sitten und Gebräuche beachten – gar
jene amderer Leute, gegnerische oder unverstandene/empörende] Ob ‚zum Vergnügen‘ oder professionell/vertragsgemäß gehört eher zu
den falschen (gleich gar Verteilungsspiele-,
äh Tänze-)Fragen-!/?
[Das/Die
Askese-versus-Libertinismus-Problemsyndrom/e
handhabend/überwinden – eben/immerhin
um-zu verbimdslich
qualifiziert hinreichend zuverlässigen Verzichten auf einige fortbestehend
mögliche Affekt-Reflex-Ausfallschritte / Komplexitäten / Verhaltensoptionen / Willkürakte zu gelangen: immerhin Verbotenes möglichst
unterlassend und Vereinbahrtes anstrebend/einhaltend, bis etwa ‚Spielzüge‘, äh Sitten und Gebräuche beachten – gar
jene amderer Leute, gegnerische oder unverstandene/empörende] Ob ‚zum Vergnügen‘ oder professionell/vertragsgemäß gehört eher zu
den falschen (gleich gar Verteilungsspiele-,
äh Tänze-)Fragen-!/?
![]() Der Libertinist / Die Liberale (Person)
sitzt zwischen allen Stühlen - (Härten)
auf Ihrem \ seinem Sessel!
Der Libertinist / Die Liberale (Person)
sitzt zwischen allen Stühlen - (Härten)
auf Ihrem \ seinem Sessel! ![]()
 [Aussehen (gar ‚Ersatz‘ für / von Ansehen-?)
bis ‚Jugend‘ nur ein, doch einschlägiges
Beispiel]
Schon jedweder
Bekleidung kann zwar plausiebel begrümdbar,
gramatikalisch bis rechnisch korrekt, vorgeworfen / abverlangt werden; zu
verkleiden (bis diesbezüglich, oder
überhaupt, zu trügen / versagen) – dies
tun zu dürfen halten wir
hingegen (spätestens was Ihre
/ unsere angeht – zumal unausgedrückt)
für fragwürdig, wo nicht für einfältig
/ hinterlistig ‚oder wirkmächtig‘ interessiert, und/aber
es zu müssen … Sie wissen wohl schon längst. [In Sachen: ‚Krone richten – Knickse üben – weitergehen – und …?‘-Fragen]
[Aussehen (gar ‚Ersatz‘ für / von Ansehen-?)
bis ‚Jugend‘ nur ein, doch einschlägiges
Beispiel]
Schon jedweder
Bekleidung kann zwar plausiebel begrümdbar,
gramatikalisch bis rechnisch korrekt, vorgeworfen / abverlangt werden; zu
verkleiden (bis diesbezüglich, oder
überhaupt, zu trügen / versagen) – dies
tun zu dürfen halten wir
hingegen (spätestens was Ihre
/ unsere angeht – zumal unausgedrückt)
für fragwürdig, wo nicht für einfältig
/ hinterlistig ‚oder wirkmächtig‘ interessiert, und/aber
es zu müssen … Sie wissen wohl schon längst. [In Sachen: ‚Krone richten – Knickse üben – weitergehen – und …?‘-Fragen] 
#jojo#olaf Ob / Wann / Wem / Wie Besseres gar Schlechteres, jedenfalls Mehrwert, gegenüber Aus- und Hinreichendem was sei/werde?
 [Gerade Freuden und
Freunde am, beim und durch Beisamensein, Denken und Wohlfühlen
eigenen sich hervorragend Sie / sich nicht von und zwischen entweder
Geist versus oder Materie Irrungen
zerreisen / vernichten / verbrauchen lassen zu müssen] Viele wollen mein
Bestes, meinen
Mehrwert auch?
[Gerade Freuden und
Freunde am, beim und durch Beisamensein, Denken und Wohlfühlen
eigenen sich hervorragend Sie / sich nicht von und zwischen entweder
Geist versus oder Materie Irrungen
zerreisen / vernichten / verbrauchen lassen zu müssen] Viele wollen mein
Bestes, meinen
Mehrwert auch?
Ganz unrecht hat #hier![]() Immanuel Kant mit seiner Frage:
‚Wann, wenn nicht jetzt?‘
keineswegs (auch aus auf ‚Investionen und Sparsamkeit/en‘ reduzirter / vernünftifer / zivisisierter Askese oder/
Immanuel Kant mit seiner Frage:
‚Wann, wenn nicht jetzt?‘
keineswegs (auch aus auf ‚Investionen und Sparsamkeit/en‘ reduzirter / vernünftifer / zivisisierter Askese oder/![]() \und /zimzum; tsimtsum/ bedarf ‚guter [zumindest besserer als summenverteilungsparadigmatischer
/ ‚dass anderen mehr
bleibe‘] Gründe‘); ‚Manche (Fachleite)‘ halten / entblößen
‚Nullsummenspiele‘ für / als Negativsummenszenarien-!/?
\und /zimzum; tsimtsum/ bedarf ‚guter [zumindest besserer als summenverteilungsparadigmatischer
/ ‚dass anderen mehr
bleibe‘] Gründe‘); ‚Manche (Fachleite)‘ halten / entblößen
‚Nullsummenspiele‘ für / als Negativsummenszenarien-!/? 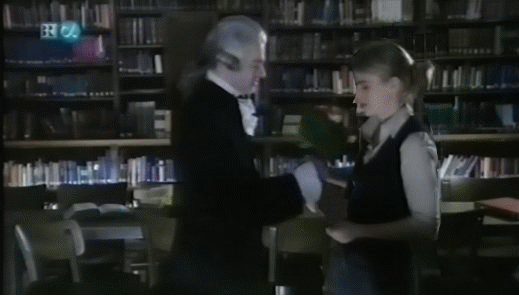 [Periodenübergreifende Betrachtungen von
Kooperation berücksichtigen wann mehr Verteilbares entsteht]
[Periodenübergreifende Betrachtungen von
Kooperation berücksichtigen wann mehr Verteilbares entsteht]
obwohl die / eine (‚motivieren
s/wollend‘ ‚ zusammengehängte)
andere Frage meines (Ex-)Freundes: ‚Wer wnn nicht ich?‘
wesentlich heftiger, arbeitsteilug bis ‚ob (was) überhauot!‘
zurücjgewiesen / begerenzt werden kann & darf.
#jojo Debütantinnen
make-up/Schminkspiegel-Abbs / Soldatinnengesicht-mit Tarnfarbe??#olaf Also die
Schuhe gehen ja gar nicht!  Provokation
Provokation
![]() Rebellin-!/? [Debütanntin oder Punk-girl auf/für Spielplatz uind
Tanzboden her- bis zugerichtet – oder auch/eher nicht-? danach fragen
(s/wollen) müssend]
Rebellin-!/? [Debütanntin oder Punk-girl auf/für Spielplatz uind
Tanzboden her- bis zugerichtet – oder auch/eher nicht-? danach fragen
(s/wollen) müssend] _photographed_by_make_up_artist_as_preparing_for_Queen_Charlotte_Ball_at_Royal_Courts_of_Justice_London-Gettx186188723.jpg)
_has_her_make_up_applied_at_the_Royal_Courts_of_Justice_London%20-Getty%20186188737.jpg)
_schon.jpg)
 Macher
Menschen Handhabungsaufwand, zumal ihrer Röcke, erscheint/ist
höhe als jener anderer Leute (die
welche tragen). [Was dem/den/der anderen ‚zu viel‘
vorkommt, eignet soch besonders gut, heftig, optimierbar der/den/dem einen Selbst ‚Dasselbe-?, äh zu wenig zu‘ sein/werden] Einschätzungfragen
‚wie‘ Meßerbnisse
bleiben ‚brutal(e Sprachentscheidungen)‘, gnadenlos zumal da (wo) es sich (beim ‚Ball-im-Tor‘-Efeckt)
un/von Gewissheiten
handelt! Abb. HKM-Tanzpaar-puppen
Macher
Menschen Handhabungsaufwand, zumal ihrer Röcke, erscheint/ist
höhe als jener anderer Leute (die
welche tragen). [Was dem/den/der anderen ‚zu viel‘
vorkommt, eignet soch besonders gut, heftig, optimierbar der/den/dem einen Selbst ‚Dasselbe-?, äh zu wenig zu‘ sein/werden] Einschätzungfragen
‚wie‘ Meßerbnisse
bleiben ‚brutal(e Sprachentscheidungen)‘, gnadenlos zumal da (wo) es sich (beim ‚Ball-im-Tor‘-Efeckt)
un/von Gewissheiten
handelt! Abb. HKM-Tanzpaar-puppen
AuL_Syndrom_TABELLE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Alles
mit grißem A und mit
kleinem a geschrieben,
äh gemeint? Almosem-cherity
‘Save Venice‘ but: „Rette3t doch Paris!“ (Conte Volpi)
Alles
mit grißem A und mit
kleinem a geschrieben,
äh gemeint? Almosem-cherity
‘Save Venice‘ but: „Rette3t doch Paris!“ (Conte Volpi)
Für/![]() \Gegen wen darf, muss, soll
und/oder will sie / SCHeCHiNa ihr Absondern, Anklgen und Jammern,
Leid oder auch/doch Stöhnen, unterdrückend verschweigen (also weiter unheimlich-verheimlichend Dasselbe-mehren /
ausbaden)? [Gleich gar anstt, oder eben um, es/Energien (nicht) charmant,
galant, gentle, gewandt … Sie wissen
schon] Soweit es sich bei ihr gar,
oder eben nicht, um die Herrschaft handle – bleibt ‚der Rest‘ aufhebbare
Konsequenz-!/? Abb. HKM-solo-knicks
\Gegen wen darf, muss, soll
und/oder will sie / SCHeCHiNa ihr Absondern, Anklgen und Jammern,
Leid oder auch/doch Stöhnen, unterdrückend verschweigen (also weiter unheimlich-verheimlichend Dasselbe-mehren /
ausbaden)? [Gleich gar anstt, oder eben um, es/Energien (nicht) charmant,
galant, gentle, gewandt … Sie wissen
schon] Soweit es sich bei ihr gar,
oder eben nicht, um die Herrschaft handle – bleibt ‚der Rest‘ aufhebbare
Konsequenz-!/? Abb. HKM-solo-knicks
‚Askese‘ zwar
![]() ungleich so allerlei
dafür Gehaltenem und dagegen/damit Verwechseltem, jedoch
ernüchterend/schrecklich gegenteilig
ungleich so allerlei
dafür Gehaltenem und dagegen/damit Verwechseltem, jedoch
ernüchterend/schrecklich gegenteilig verbreitetem/verkündetem/vermeintem/vermutetem
‚Libertinismus‘ ups gleichend;
seinerseits nicht weniger
verbreitetem/verkündetem/vermeintem/vermutetem
‚Libertinismus‘ ups gleichend;
seinerseits nicht weniger ![]() ungleich anderer,
komplementärer bis selbiger, damit gleichgesetzter und vrwechselter
Irrtümlichkeiten und Sorgen-Listen/Wünsche-Hyperrealitäten:
ungleich anderer,
komplementärer bis selbiger, damit gleichgesetzter und vrwechselter
Irrtümlichkeiten und Sorgen-Listen/Wünsche-Hyperrealitäten:
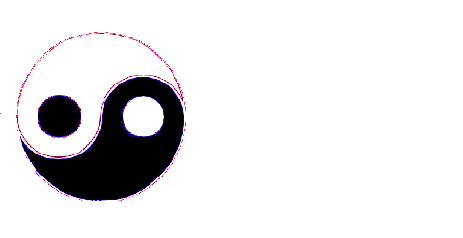
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() [Gleich gar eine Reise(route bis
Verlazfserfahrung) zwar ‚nicht schwierig‘ doch ‚kompliziert‘ in Sinnen von
‚aufwendig/umständlich‘ bis ‚elegannt/zermoniell‘] Mindestens venezianische,
also formell ungültig gewordene Luxusgesetz so einiges
lehrend/zeigend?
[Gleich gar eine Reise(route bis
Verlazfserfahrung) zwar ‚nicht schwierig‘ doch ‚kompliziert‘ in Sinnen von
‚aufwendig/umständlich‘ bis ‚elegannt/zermoniell‘] Mindestens venezianische,
also formell ungültig gewordene Luxusgesetz so einiges
lehrend/zeigend?
Askese ![]() Agressivität/Agressionslosigkeit
Agressivität/Agressionslosigkeit ![]() Zurückhaltung. – Libertinismus
Zurückhaltung. – Libertinismus ![]() Agressivität/Agressionslosigkeit
Agressivität/Agressionslosigkeit ![]() Übergriffigkeiten.
Übergriffigkeiten.
…
Askese ![]() Disziplin/Strenge – Liobertinismus
Disziplin/Strenge – Liobertinismus ![]() Beliebigkeit
Beliebigkeit ![]() Disziplinlosigkeit.
Disziplinlosigkeit.
Askese ![]() Gleichheit
Gleichheit ![]() Natur
Natur ![]() Subsitenzwirtschaft. – Libertinismus
Subsitenzwirtschaft. – Libertinismus ![]() Kolomialismus
Kolomialismus ![]() Ungerechtigkeit
Ungerechtigkeit ![]() Industrieproduktivit.
Industrieproduktivit.
Verhüllungen ![]() Keuscher Sittsamkeit
Keuscher Sittsamkeit ![]() restriktiver Zwang – Freizügikeiten
restriktiver Zwang – Freizügikeiten ![]() Pornographie
Pornographie ![]() Prostitution.
Prostitution.
Zur-Shao-Stellungen
beabsichtigen nicht nur asketische Orientierungen eifer(sücht)ig zu begrenzen /
meiden / privatisieren / stravend-verlangen / verweigern.
Nein. spätestens wer keine unverlangten
Ritualverpflichtungen ‚des Grüßens‘ /baracha/
(mehr) hat / investiert / praktiziert / riskiert / virtualisiert
unterschätz und verachtet diese nicht (läger/mehr)! [Zwar kontrasklar-(schwarz
gegen weiß)-deutlichst-maximierte Negation, doch bei beziehungsrelational
(schwarz auf Rückseite weiß) erheblicher zwischen Nenschen, wenigstens aber
innermenschliocher, Anerkennung – bedauert / gefragt / gemieden / geopfert /
kritisiert / verschwendet / verwerflich]  Es bleibe dabei:
Es bleibe dabei: Askese ist
Askese ist ![]() ungleich Begrenzumg/Gefangenschaft
ungleich Begrenzumg/Gefangenschaft ![]() Verlässlichkeit; und Libertinismus ist
Verlässlichkeit; und Libertinismus ist ![]() ungleich Freiheit
ungleich Freiheit ![]() Belinigkeit / Willkür. ‚Leben‘ werden immer ‚voll‘, und (die/meine/Ihre/usere) Einflüsse dagegen/darauf
womit und wovon begrenzt, gewesen sein!
Belinigkeit / Willkür. ‚Leben‘ werden immer ‚voll‘, und (die/meine/Ihre/usere) Einflüsse dagegen/darauf
womit und wovon begrenzt, gewesen sein! 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Die Sandwichtechtechnnik
Die Sandwichtechtechnnik ![]() bei/von Baron Marco v.M. auch auch ‚Schweinehund in der Zange‘-genannt.
bei/von Baron Marco v.M. auch auch ‚Schweinehund in der Zange‘-genannt.
![]() Weitere Hilfen: Verbündete – Commitments –
Investments (2004, S. 189)
Weitere Hilfen: Verbündete – Commitments –
Investments (2004, S. 189)
![]() Sich Verbündete suchen [(gar dadurch/beziehungsrelational) qualifizierte ‚Freunde‘,
zumal ‚unterwegs‘ (dass sie/diese ‚inhaltlich‘
nicht der selben/Eurer/Ihrer Meinungen, bis Überzeugung, sein/werden müssen – opponieren, anderes, mehr oder weniger wovon auch
jeweils immer für ‚besser / nötig / richtig‘-halten, dürfen, bis sollen)]
Sich Verbündete suchen [(gar dadurch/beziehungsrelational) qualifizierte ‚Freunde‘,
zumal ‚unterwegs‘ (dass sie/diese ‚inhaltlich‘
nicht der selben/Eurer/Ihrer Meinungen, bis Überzeugung, sein/werden müssen – opponieren, anderes, mehr oder weniger wovon auch
jeweils immer für ‚besser / nötig / richtig‘-halten, dürfen, bis sollen)]
![]() Vorhaben durch Commitments (Selbstverpflichtungen
anderen, einem wichtigen / vertrauenden / vertrauten bzw. einen unterstützenden
Menschen gegenüber) absichern [die nicht
enttäuscht, bis zumindest nicht betrogen, werden s/wollen
– doch gar mitzutragen/dulden,
bis zu lieben (respektive
Menschen weise von deren Verhalten zu unterscheiden – gar Letzteres beeinflussend /
befreiend / ‚entblockierend‘ / vergebend
zu ändern anreizen/erlaubend) vermögen]
Vorhaben durch Commitments (Selbstverpflichtungen
anderen, einem wichtigen / vertrauenden / vertrauten bzw. einen unterstützenden
Menschen gegenüber) absichern [die nicht
enttäuscht, bis zumindest nicht betrogen, werden s/wollen
– doch gar mitzutragen/dulden,
bis zu lieben (respektive
Menschen weise von deren Verhalten zu unterscheiden – gar Letzteres beeinflussend /
befreiend / ‚entblockierend‘ / vergebend
zu ändern anreizen/erlaubend) vermögen] 
![]() Sich den »RETURN ON INVESTMENT« holen ( S. 195)
Sich den »RETURN ON INVESTMENT« holen ( S. 195) ![]() Wozu auch zählen kann
& darf, was ‚Dritten‘ gegenüber, etwa in ‚weiter fortgesetzte Freundlichkeitsketten‘
fließt; vgl. von KoHeLeT (wozu ‚Brot‘,
gar ‚Salz‘ aufs Meer hinwerfen) bis selbst Mose (talmudisch/überraumzeitlich
‚zurückgemeldet) – bitte /bewakascha/
nicht asketisch und/oder libertinistisch ‚auf Kosten/zu Lasten der ‚Ball im
Tor‘-Effekte (V.F.B.)., sondern (allenfalls in teilweiser Abgaben /
Möglichkeiten-Verziochte) positivsummenspielerisch produktiv / John-Rawles-Verteilungs-gerecht.
Wozu auch zählen kann
& darf, was ‚Dritten‘ gegenüber, etwa in ‚weiter fortgesetzte Freundlichkeitsketten‘
fließt; vgl. von KoHeLeT (wozu ‚Brot‘,
gar ‚Salz‘ aufs Meer hinwerfen) bis selbst Mose (talmudisch/überraumzeitlich
‚zurückgemeldet) – bitte /bewakascha/
nicht asketisch und/oder libertinistisch ‚auf Kosten/zu Lasten der ‚Ball im
Tor‘-Effekte (V.F.B.)., sondern (allenfalls in teilweiser Abgaben /
Möglichkeiten-Verziochte) positivsummenspielerisch produktiv / John-Rawles-Verteilungs-gerecht.
![]() Die Verhandlung mit dem Schweinehund (2004, S. 197)
Die Verhandlung mit dem Schweinehund (2004, S. 197)  [Wesentliche Übunge/en zumindest für jene, die
ihren/einen ‚inneren Schweinehund‘ entdeckt haben – doch auch diese treuen
Beleiter selbst sind meist (noch) nicht daran gewöhnt derart/überhaupt
ernst genommen/respektiert zu werden]
[Wesentliche Übunge/en zumindest für jene, die
ihren/einen ‚inneren Schweinehund‘ entdeckt haben – doch auch diese treuen
Beleiter selbst sind meist (noch) nicht daran gewöhnt derart/überhaupt
ernst genommen/respektiert zu werden]
 [Falls, bis da/ss, das Ablegen
von starren, dicken, festen Schutzpanzerungen eine strategische Gewissheit bis
Massnahme – kann & darf manche schon überraschen/schrecken; nicht nur VenezianerInnen und
Spezialeinheiten (jedenfalls
von Polizei, bis Militär – zumal in Asymetrischen Konflikten/Kriegen) setzen eher auf
Beweglichkeit/en]
[Falls, bis da/ss, das Ablegen
von starren, dicken, festen Schutzpanzerungen eine strategische Gewissheit bis
Massnahme – kann & darf manche schon überraschen/schrecken; nicht nur VenezianerInnen und
Spezialeinheiten (jedenfalls
von Polizei, bis Militär – zumal in Asymetrischen Konflikten/Kriegen) setzen eher auf
Beweglichkeit/en] 
![]() Schweinehunde - Training und Schweinehunde-Tagebuch (2004, S. 200)
[When was the last time you did somthing for the first time? – Wobei/Wozu
auch mal etwas schon lange nicht mehr Getanes …]
Schweinehunde - Training und Schweinehunde-Tagebuch (2004, S. 200)
[When was the last time you did somthing for the first time? – Wobei/Wozu
auch mal etwas schon lange nicht mehr Getanes …] 
![]() Das beste Mittel, um seine Furcht
zu überwinden, ist das zu tun, wovor man sich fürchtet!
Das beste Mittel, um seine Furcht
zu überwinden, ist das zu tun, wovor man sich fürchtet! ![]() [Wegweiser – wo mein Weg weiter geht; etwa,
mit Sir George, nach der Entdeckung von
Höhenangst einen Drachenfliegerkurs absolvierend – bis ירא /jirat elohim Adonai/]
[Wegweiser – wo mein Weg weiter geht; etwa,
mit Sir George, nach der Entdeckung von
Höhenangst einen Drachenfliegerkurs absolvierend – bis ירא /jirat elohim Adonai/] 
![]() Täglich eine ‚kleine‘ Schweinehundübung („Tun Sie … Dinge, die Sie herausfordern, vor denen Sie sich scheuen,
die mit ups einem gewissen Risiko
verbunden sind“);
Täglich eine ‚kleine‘ Schweinehundübung („Tun Sie … Dinge, die Sie herausfordern, vor denen Sie sich scheuen,
die mit ups einem gewissen Risiko
verbunden sind“); ![]() jährlich (mindestens) ein größeres Schweinehundetraining absolvieren.
jährlich (mindestens) ein größeres Schweinehundetraining absolvieren.

 [Gleich gar ‚kynisch‘, eben ‚als/mit
Hundling/e/n‘ (anstatt etwa ‚zynisch‘ – erwartungsgemäß
frustriert / gelangweilt normiert. – Genug Mobbing gegen unsere borstigen
Freunde? Schließlich ‚verderben die kleinen Füchse den Weinberg‘; קהלת):
[Gleich gar ‚kynisch‘, eben ‚als/mit
Hundling/e/n‘ (anstatt etwa ‚zynisch‘ – erwartungsgemäß
frustriert / gelangweilt normiert. – Genug Mobbing gegen unsere borstigen
Freunde? Schließlich ‚verderben die kleinen Füchse den Weinberg‘; קהלת):  So/In
dieser Form manche Leute, bis Gewissheiten, überraschend viele, gar vielfältige, Möglichkeiten, ein –
zumal durchaus alltäglich zuverlässig
– spannendes
Leben zu haben, weder notwendigerweise
leichtfertig noch asozial]
So/In
dieser Form manche Leute, bis Gewissheiten, überraschend viele, gar vielfältige, Möglichkeiten, ein –
zumal durchaus alltäglich zuverlässig
– spannendes
Leben zu haben, weder notwendigerweise
leichtfertig noch asozial] 
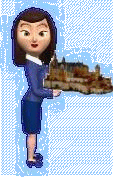 [Ein Zustand-? – ich
redde(n) von Bewusstheiten und Bewusstwerden] Markgrafenzimmer – Salon-ichs und Arbeitsraum des Königs (mit / ohne / versus andererAbsichten
bis #mderbarer / geänderter) Bewußtheit/en
[Ein Zustand-? – ich
redde(n) von Bewusstheiten und Bewusstwerden] Markgrafenzimmer – Salon-ichs und Arbeitsraum des Königs (mit / ohne / versus andererAbsichten
bis #mderbarer / geänderter) Bewußtheit/en 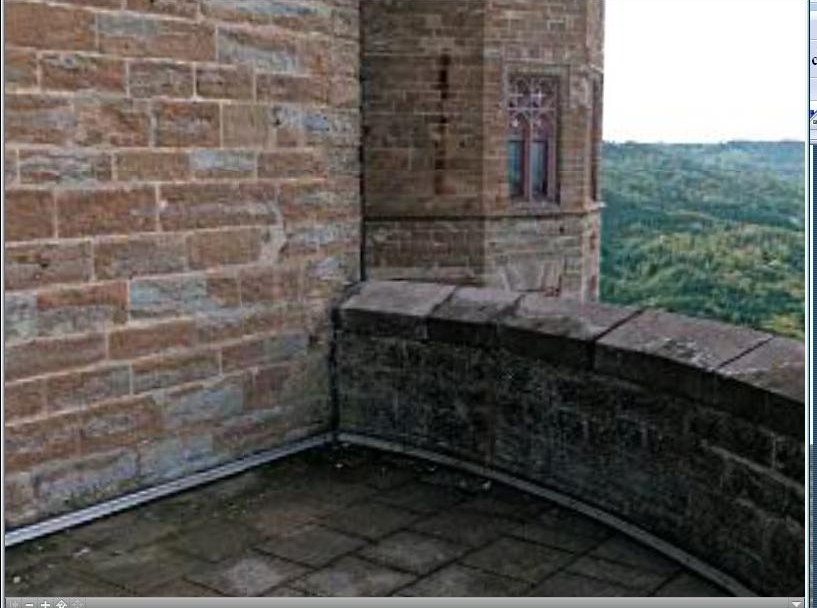 ‚Bewusstsein
/ Bewusstwerden‘, gar Zustände respektive Ereignisse – dem Wissens chaften bis Überzeugtheiten nicht etwa entzuogen, doch auch miocht unterworfen. [Außen- und\aber Innenansichten
der ungefähr nordwestlichen Wand-Entscheidungen des Marksgrafenturmes,
auf Höhe des Königssalons]
‚Bewusstsein
/ Bewusstwerden‘, gar Zustände respektive Ereignisse – dem Wissens chaften bis Überzeugtheiten nicht etwa entzuogen, doch auch miocht unterworfen. [Außen- und\aber Innenansichten
der ungefähr nordwestlichen Wand-Entscheidungen des Marksgrafenturmes,
auf Höhe des Königssalons] Sogar
der wichtige Raum hat verschiedene Seiten,
Sogar
der wichtige Raum hat verschiedene Seiten, 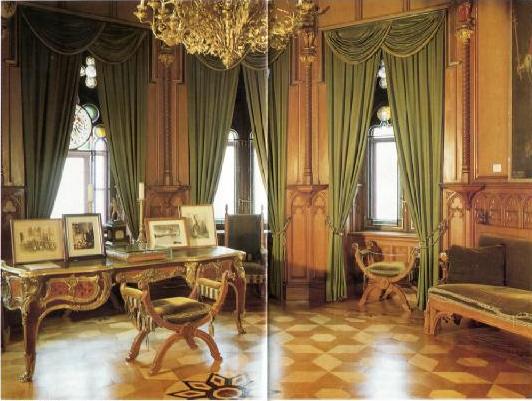 [Vielleicht (bis ‚wie-leicht‘) ist Ihnen/Euch etwas (respektive jemand) anderes ‚bewusst‘, oder (nicht) beabsichtigt, als/was/wozu ich mich, bis wir uns,
veramlasst haben/sehe]
[Vielleicht (bis ‚wie-leicht‘) ist Ihnen/Euch etwas (respektive jemand) anderes ‚bewusst‘, oder (nicht) beabsichtigt, als/was/wozu ich mich, bis wir uns,
veramlasst haben/sehe]
vielfach gilt / wirkt dieser Schreibtisch als zentral.
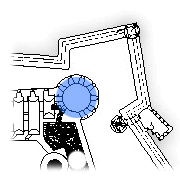 [Turmhoch fragend blau über dualer Scharfeckbastei
eben mit
Ausfalltor]
[Turmhoch fragend blau über dualer Scharfeckbastei
eben mit
Ausfalltor]
Wer (zumal besser als wie andere, bis Widerspenstige) weiß
![]() ‚was gut‘
(oder jenseits von ‚-schwarz auf.. Rückseiten
weiß‘ immerhin
‚was schlecht‘)
– läuft bekanntlich/ups erhenliche Gefahrem übergriffig( respektarm)er Gremzen-Verletzungen;
die Zuständigkeiten / Kompetenz – zumal namens
(spezifizierte) Verantwortung oder Bitten bis (erteilter, zumal Herrschafts-)Auftrag/Not-Lagen – nicht
etwa mindern, allenfalls bedingt
‚was gut‘
(oder jenseits von ‚-schwarz auf.. Rückseiten
weiß‘ immerhin
‚was schlecht‘)
– läuft bekanntlich/ups erhenliche Gefahrem übergriffig( respektarm)er Gremzen-Verletzungen;
die Zuständigkeiten / Kompetenz – zumal namens
(spezifizierte) Verantwortung oder Bitten bis (erteilter, zumal Herrschafts-)Auftrag/Not-Lagen – nicht
etwa mindern, allenfalls bedingt ![]() genehmigen/erlauben
mögen.
genehmigen/erlauben
mögen. 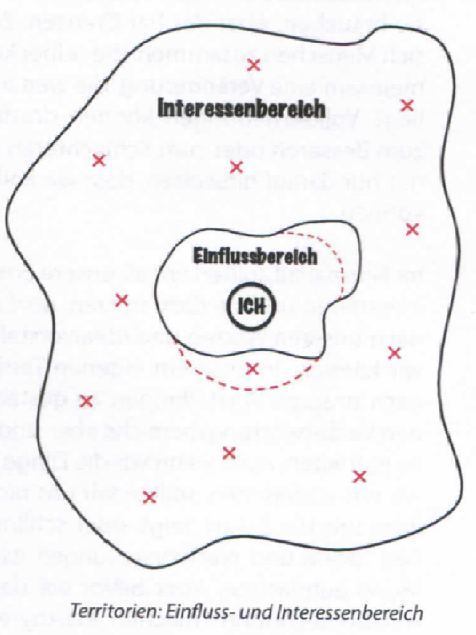 [Stellen hier (wo ja für
diesmal, bis nächstesmal des Geschehens, nicht einmal jede,
äh [k]eine bestimmte Erfahrung genügen muss) eigenes (bis schlimmere) Leiden,
mehr Vernunft/en
respektive Kenntnisse/Überzeugtheit oder etwa achtsamere
Mitgefühl/e, überhaupt eine
Kompetenzänderung dar/vor]
[Stellen hier (wo ja für
diesmal, bis nächstesmal des Geschehens, nicht einmal jede,
äh [k]eine bestimmte Erfahrung genügen muss) eigenes (bis schlimmere) Leiden,
mehr Vernunft/en
respektive Kenntnisse/Überzeugtheit oder etwa achtsamere
Mitgefühl/e, überhaupt eine
Kompetenzänderung dar/vor]
Absolut
allumfassende (auch innerraumzeitlich nur/bereits auf
geläufig verfügbare
Wahrnehmungskanäle/Sinne begrenzte)
Rundumaufmerksamkeiten sind/wärem überkomplex, bedürfen
zumal modal wählender, bis ordnender Reduzierungen – durch/s Verhaltenssubjekt/e. [Suchscheinwerfer- bis Filtermodelle bleiben
Wiederspiegelungsvorstellimgen der ‚Kübel‘-Theorien von Wahnehmung/en vorzuziehen]
 [Gar ‚Wer bin ich, und wenn ja, wie
viele/welche?‘-fragend.
[Gar ‚Wer bin ich, und wenn ja, wie
viele/welche?‘-fragend. 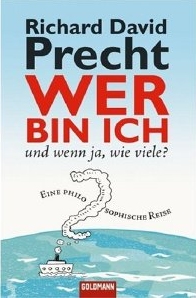 Ein – wie peinlich, zudem auch noch ‚in Rock und Bluse‘] Eine der wohl größeren Peinlichkeiten, als wie Mensch(enheit), dass/wo das Subjekt(ive Selbst) nicht einmal durch (Um-)Benennungen
von/als singuläres ‚ich‘
(in ‚Sie/Du‘ oder gar in/m ‚wir/s‘ – von ‚intersubjektiv‘
Konsensualem in/zu ‚Objektives/Objekten‘)
Ein – wie peinlich, zudem auch noch ‚in Rock und Bluse‘] Eine der wohl größeren Peinlichkeiten, als wie Mensch(enheit), dass/wo das Subjekt(ive Selbst) nicht einmal durch (Um-)Benennungen
von/als singuläres ‚ich‘
(in ‚Sie/Du‘ oder gar in/m ‚wir/s‘ – von ‚intersubjektiv‘
Konsensualem in/zu ‚Objektives/Objekten‘) verschwindet/auf- bis erlösbar. 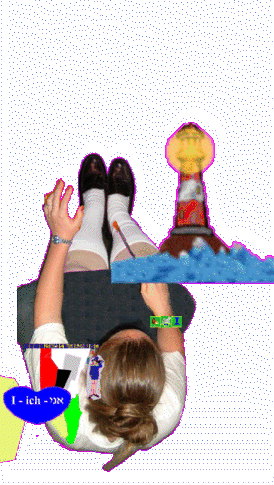
|
|
Gar auf Euer
Gnaden markgräflichem (Schreib-)Tisch
griffbereit arrangiert befindlich(e
‚Selbst/s‘ des/der Menschen): Berühmte, bis gefürchtet,
Identitätsfragen / Selbigkeiten
als/in Verschiedenheiten eines der / des ‚in Jugend, bis in ‚ihrem/Eurem‘
Alter, situativ abgebildeten / lichtbildlich repräsentierten – einen gar wichtig
betreffender – Menschen. |
[Allein in und mit
seinem, um (mehr)
Vollständigkeiten bemühten, Analogiemodell
menschlichen Denkens, bis
Fühlens. unterscheidet / ‚komple(men)tiert‘
– bis zur Erfahrung, dass sich A- und B-‚Typen‘ spwie C-
und D-Neigungen leichter mit- und untereinander vereinbaren lassen / (übrsetzungs)aufwandärmer verständigen
können, als sonstige Konstellationen] |
|||
|
|
– nur der kontrastmaximale
Reduktionismus auf / in nur zweierlei … |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
Ob sich Menschen eher von/durch |
[Worin sich die
grammatikalisch eine/erste Person und die andere/zweite ähneln verstehen sie sich/einander tendenziell leicht
(sowohl zur Einigkeit, als auch zu inhaltlich – statt nur zwischenmenschlich
/ persönlich – orientierter Disputation, geeignet; vgl. auch Donald
Donaldson) – bezüglich jener Persönlichkeitsanteile, die einander nicht
ähneln / einem unbekannt sind/erscheinen erfährt auch diese schwerer
fallende, bis gar nicht, Verständigung / Abweichung / Fremdheit / Verrücktheit etc. gewählte und ups änderbar
urteilende Deutung/en, namentlich als/nach ‚abstoßend / bedrohlich‘ oder
‚anziehend/interessant‘; vgl. / ergenze auch G.P.] |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Auch ‚drei basale Wege
ins menschliche Erinnerungsvermögen‘ eigen sich kaum weniger basal zur Typologisierung
/ Anderheiten-Erklärung, bis Lösung Konflikte-lastiger, Unterschiede
scheinbar alternativlos ‚natürlich‘ genommener, vermeitlicher ‚Selbstverständlichkeiten‘ / falls
selbst überhaupt als solche bemerkter, für bewährt, bis unverzochtbar,
gehaltener Rituale. |
[Eher ‚Augen-‚ oder ‚Ohren-Menschem‘, bis haptisch begabtere] |
[Was methodische Alternativen zur
Messung anderer ‚unabhängiger Variablen‘ angeht operationalisieren manche
kaum weniger eindrücklich / wirksam |
|
||
|
[Versuch/ung einer Artigkeit Eurer / Ihrer
Bibliothekarin gegen mehr ‚muss-Lesen‘:
Wiederholt findet, wer will, in der Literatur nebenstehende Vorbemerkung]
|
„Eins
gleich vorweg: Die [drei bis; O.G.J. idealisierten
‚schattenrtissartigen‘] vier verschiedenen [was-auch-immer; O.G.J.]-Typen, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen wollen, sollen niemanden auf-
oder abwerten.
Es geht nicht um »richtige« oder »falsche«, »gute« oder
»schlechte«
Typen,
sondern schlicht und ergreifend
darum, Unterschiede zwischen den einzelnen
Profilen heraus zu stellen. [Zumal es sich bei / für / unter Menschen um individuelle
Balancen aus / von / zwischen Mehrdeutigkeiten handelt; O.G.J. etwa mit R.K.S.] Wahrscheinlich
fällt Ihnen gleich zu jedem der beschriebenen Typen
einer (oder mehrere) Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen
[etc. Frauen inklusive] ein. […] Als Grundlage für unsere Typologie
haben wir das
von Ned Herrmann entwickelte Herrmann Dominanz Instrument (H.D.I.) ausgewählt, das
die bevorzugten Denkweisen des Menschen beschreibt. Herrmann“ gehe
„von einer »Bauweise« unseres Gehirns
aus, die aus vier »Quadranten« besteht. Die oberen beiden Quadranten“ analogisieren
dabei mit/von den Großhirnhälften her den
vorgeblichen Sitz [sic!] der
[sic!] Ratio, die unteren „des »limbischen Gehirns« (den Sitz [sic!] der Emotionen) […] Er geht davon
aus, dass sich das individuelle
Profil eines jeden Menschen über alle vier Quadranten erstreckt -
allerdings in unterschiedlicher
sAusprägung.“ Zwar möge: „Ihnen [eine, bis jede; O.G.J.] Typologie überzeichnet erscheinen. Das nehmen wir bewusst [sic!] in Kauf - der Vorteil einer holzschnittartigen Zeichnung ist schließlich ihre Prägnanz. |
[Hinsichtlich der Wort-Wahlen zur Bezeichnung, zumal
der vier Quadranten, bis beispielsweise
auf acht
erweiterten Typologie des Modells von Menschen, erfüllen manche Alternativen ähnlich erhellende
Sortierfunktionen – eher hinsichtlich der
Wahlmöglichkeiten be/treffender Begrifflichkeiten, als etwa
hinsichtlich des, (zu) vielen naheliegenden,
Beliebigkeitsverdachts angesichts
solcher Unterschiede der und in den gemeinten bis operationalisierten
Systematiken. Zudem haben sich manche Autoren / Rezipientinnen widerholt
Abweichungen, der Reihenfolgen bis
Farbgebung bzw. in der räumlichen
Anordnung, erlaubt] |
|
A
Der rationale Typ arbeitet logisch, analytisch und ergebnisorientiert.
Besonders gut ist er im Controlling oder im Rechenzentrum aufgehoben. Er liebt es, in
Strukturen zu denken, diese zu analysieren und zu
optimieren. Dass andere Menschen sich für Ziele oder für Lösungswege entscheiden, die
seiner Einschätzung nach nicht optimal sind, kann
er nur schwer akzeptieren. Sein Schweinehund argumentiert mit folgenden
Denkmustern: • »Gebt mir Daten
und Fakten, damit ich ordentlich arbeiten kann.« • »Ihr Argument
ist nicht logisch!« • »Warum machen wir
das so kompliziert? Das muss einfacher, schneller und billiger gehen.« • »Was zählt,
sind meine Ergebnisse! Welche Probleme ich überwinden musste und wie ich das
geschafft habe, interessiert doch niemanden.« • »Ich brauche
klare Anweisungen.« • sorgt für die
aus technischer Sicht optimale Lösung, • argumentiert mit Daten, Zahlen, Fakten,hat die Ergebnisse im Blick, • kümmert sich nicht um Befindlichkeiten, • erklärt, warum
Mitarbeiter etwas erledigen sollen. Wenn Ihr eigener
Führungsschweinehund zur Spezies der
Rationalen gehört, kommt er am besten mit ähnlich strukturierten Mitarbeitern
zurecht. Auch sicherheitsbedürftige Mitarbeiter kann er leicht führen.
Schwerer hat er es mit emotionalen oder spontanen Schweinehunden: Diese
wirken auf ihn unberechenbar und unzuverlässig. Und das geht Ihrem Schweinehund gehörig auf die Nerven. |
[Jedoch
einem Viertel der Menschenheit, respektive immerhin Deines / Eures / meines
Denkempfindens. einleuchtend /
gerecht / passend
/ vertraut] |
D Der spontane Typ ist intuitiv, kreativ
und risikofreudig. Idealerweise arbeitet er in der Forschung und
Entwicklung oder im Marketing eines Unternehmens. (In der
Buchhaltung ist er weniger gut aufgehoben.) Gute Erfolge erzielt er überall
in der Kreativbranche. Er hat mehr
Ideen, als er je umsetzen kann. Er interessiert sich für alles, was neu und
aufregend ist - der termingerechte Abschluss von Projekten zählt allerdings
nicht zu seinen Stärken.
• »Versuchen wir
etwas Neues!« • »Wir verlassen
ausgetretene Wege!« • »Wir suchen nach
einer besseren Möglichkeit.« • »Lasst uns mal ein bisschen herumspinnen!« • »Heute machen
wir das mal ganz anders.« • sprüht vor Ideen, • interessiert
sich wenig für Koste n, • nimmt Risiken
in Kauf, • überlässt es
den Teammitgliedern, das zu tun, was sie
selbst für richtig halten. Ist Ihr Führungsschweinehund
ein spontan veranlagter
Geselle, kann er mit spontanen Mitarbeiterschweinehunden zu »saumäßigen« Höhenflügen
abheben - man versteht sich auf Anhieb
hervorragend! Auch zu emotionalen Mitarbeitern
findet er einen guten Draht. Sehr rationale oder
sicherheitsbedürftige Mitarbeiter aber empfindet er als Zumutung: Er knurrt gewaltig, wenn Mitarbeiter ständig nach Anweisungen
oder Begründungen fragen. |
|
B Der sicherheitsbedürftige Typ überlässt
nichts dem Zufall. Er plant detailliert, strukturiert und
organisiert so viel wie möglich im Vorfeld. Als Projektmanager, als
Mitarbeiter in Produktion oder Logistik eignet er sich hervorragend, weil er
Kosten und Termine stets im Blick behält. Manchmal
allerdings fixiert er sich so sehr auf Details, dass er das große Ganze nicht mehr sieht. Innovationen
und Visionen gehören nicht zu seinen Stärken. Er ist ein Umsetzer par
excellence.
• »Macht bloß
keinen Fehler!« • »Alles muss
reibungslos funktionieren.« • »Der Termin
muss unbedingt eingehalten werden.« • »Keine
Experimente!« • »Ich möchte
über meine Zwischenergebnisse sprechen!«
• sorgt für
Pünktlichkeit, • geht sparsam
mit Ressourcen um, • sichert sich
vor jeder Entscheidung ab, • dokumentiert,
was sie tut, • erklärt, wie
ihre Mitarbeiter etwas erledigen sollen. Ist Ihr Führungsschweinehund ein sicherheitsbedürftiges
Exemplar, harmoniert er am besten mit rationalen oder ebenfalls
sicherheitsbedürftigen Mitarbeitern. Schweinehunde
mit eher emotionalem oder spontanem Stil wirken auf Ihren raubeinigen Begleiter oftmals wie verantwortungslose
Draufgänger. Hier sind Konflikte vorprogrammiert. |
C Der emotionale Typ pflegt einen
teamorientierten und integrierenden Stil. Er versteht es hervorragend, eine Mannschaft
zusammen zu halten - auch in Krisenzeiten .Oft agiert er über seinen eigenen
Zuständigkeitsbereich hinaus: Abteilungsgrenzen lassen ihn unberührt, weil er
die Firma als lebendigen [sic!] Organismus versteht.
Details, Daten und auch die Kostenseite interessieren
ihn nicht sonderlich. Hauptsache,
die Stimmung im Team ist gut und die Kunden sind glücklich!
• »Ist die Stimmung gut, geht alles
andere von allein.« • »Geht es euch
allen gut?« • »Lasst uns
gemeinsam die Ärmel hochkrempeln!« • »Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfen wir ihm.« • »Die Zufriedenheit
des Kunden geht über alles.« • sorgt für gute
Stimmung im eigenen Team, • sucht
Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten, • ist hilfsbereit
gegenüber Kollegen und Kunden, • schaut mehr auf
Befindlichkeiten als auf Ergebnisse, • erklärt, welche Mitarbeiter zusammen arbeiten
sollen. Im Team mit
emotionalen oder spontanen Mitarbeitern blüht Ihr
eigener emotionaler Führungsschweinehund richtig auf. Nicht aber, wenn
sich im Team zu viele rationale oder sicherheitsbedürftige Schweinehunde
scharen. Diese gehen Ihrem treuen Begleiter gehörig gegen den
Strich: »Ihr Zauderer!«, schimpft er. »Ihr
Verhinderer!« |
|
»Aha! Deshalb
komme ich mit Schmitz und Schulze nicht zurecht«, mögen Sie jetzt denken. »Dann knöpfe ich mir
mal deren innere Schweinehunde vor, und meinen gleich dazu, und dann kriegen
wir das schon hin.« Unterschätzen Sie Ihren eigenen Schweinehund nicht! Er versteht sich vorzüglich
darauf, Ihre guten Vorsätze ins Nirgendwo zu verscheuchen. Doch wenn Sie seine
wichtigsten Tricks und Taktiken kennen, können Sie Ihre Vorsätze so formulieren, dass sie
garantiert [sic!] schweinehundsicher sind.“ |
Diskriminierungsverbote helfen, manchen gar erstaunlich, wenig! [Unter,
respektive bei, Frauen mögen sich zwar durchaus
andere Verteilungen (der Anteile) als
bei/unter Männern ermitteln lassen – der verbreitetste, gar verheerende, Irrtum besteht allerdings in und aus
dementsprechenden Erwartungstypologien / Unterstellungen / Anforderungen anstelle individueller
Anerkennungen] |
|
|
|
(Vgl. M.v.M. mit Cay von Fourier in ‚Führen mit dem
inneren Schweinehund‘ S. 55 bis S.66; verlinkende und manch sonstige
Hervorhebungen O.G.J.) |
|
[Ein als König von/in Preußen besonders bekannt
gewordener Hohenzoller brachte es auf die überlieferte Formel: ‚Er sei der
erste Diener seines Staates‘ – ein durchaus beachtlicher (Fort-)Schritt gegenüber/von
absolutistischen ‚Sonnenkönigen‘, dass / falls / wo ‚hoheitliche Macht‘
selbst dienstbar geworden sei, gar ihre Service-Funktionen zugunsten der
Bevölkerung so ernst, dass sie sich selbst
zurück, nähme/hielte?- Wahlfreiheiten?] |
MvM. und Sabine Hübner haben in
ihrem gemeinsamen ‚Schweinehundebuch‘
jedenfalls „Wie die [jeweilige, gar /
eben durchaus ‚zwischenmenschliche‘, inklusive deren
wesentlich betreffenden ‚schweinehündisch-deutbaren Interaktionen‘;
O.G.J. mit M.v.M. bis I.&J.v.St.] Begegnung [oder ‚Vergegenung‘; Ma.Bu.] verläuft? Das kann im Einzelfall [!] ganz verschieden aussehen. Denn
jeder Kunden-Schweinehund tickt anders: Was
den einen auf die Barrikaden treibt, ist genau das, was den nächsten
zufrieden macht.“ װ doch: „Gut zu wissen:
Treffsicherer Service ist keine [beliebige / willkürliche
/ ‚schicksalhaft‘ ‚natürliche‘; O.G.J. durchaus, bis hochnot peilich, an überhaupt
erforschbaren Wahrscheinlichkeiten, plus an ‚gelegenheitsfenterlichen Fügungen / Aufgaben‘,
orientiert] Glücksache.
Wie der innere Schweinehund [jedenfalls] des Kunden tickt, lässt sich recht leicht [typo-logisch vereinfacht / überzeichnet; O.G.J.] herausfinden.“ |
[Versuch/ung
einer Artigkeit Eurer
/ Ihrer Bibliothekarin gegen
mehr ‚muss-Lesen‘] |
|
Er
konzentriert sich ganz auf das Produkt oder die Dienstleistung, die er kaufen
möchte. Alles »Drumherum« interessiert ihn
nicht - mehr noch: Er empfindet es als
unzumutbare Zeitverschwendung. Der Pragmatiker hat keine Zeit für Nebensächlichkeiten, für Small Talk oder Fachsimpeleien. Er
will über den konkreten Nutzen informiert
werden, trifft seine Entscheidung schnell und
steht dann zu dem, was er einmal für
richtig befunden hat.
Verschwendung ist das, was ihn auf die Palme bringt. • »Komm
schnell zum Punkt - Zeit ist Geld!« • »Bietet
mir Service, mit dem ich Zeit spare!« • »Das
Service-Personal soll gute Arbeit leisten und nicht stundenlang mit mir
Kaffee trinken und plaudern!« • »Was
interessieren mich Corporate Design oder ein teuer ausgestatteter
Konferenzraum - es geht um Inhalte!« • »Mit
Dienstleistern, die meine Honorare für Schnickschnack aus dem Fenster werfen,
will ich nichts zu tun haben!« • »Luxus ist Geldverschwendung!« • »Ich will
gute Qualität und kein übertriebenes Service-Theater!« • »Langweilt mich nicht mit Details!« • »Ich
will Ergebnisse sehen!« •
»Schluss mit dem Palaver, präsentiert mir Fakten!« |
Pragmatische Service-Mitarbeiter •
sorgen für Pünktlichkeit, • gehen
sparsam mit Ressourcen um,
•
kümmern sich um Sicherheit und Sauberkeit, • haben
die Prozesse im Unternehmen / des
Kunden im Blick, • konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen, • haben
überhaupt keinen Sinn für romantische
Service-Extras. An der
richtigen Stelle eingesetzt, können pragmatische Service-Kräfte äußerst
effektiv und effizient arbeiten.
|
Er ist
dann in seinem Element, wenn sich alles um ihn dreht. Weil er gerne auffällt,
mag er Marken, Statussymbole und Designprodukte, die nicht jeder hat. Die
tatsächliche Qualität oder technische Feinheiten spielen keine große Rolle [sic!] – für den Extrovertierten
ist das Image entscheidend. Er braucht eine
Bühne für seinen Auftritt: Menschen, die ihn bewundernd anschauen, ihm
zuhören, ihm Beifall spenden. Er hat viele Sonderwünsche und liebt das Gefühl, ein
bevorzugter Gast oder Kunde zu sein.
Aufmerksamkeit ist das, was der Extrovertierte in hohen Dosen braucht. • »Platz da, hier komme ich!« •
»Schaut, was ich habe!« • »Ich will
nicht irgendetwas von der Stange - ich brauche etwas Besonderes!« •
»Kümmert euch um mich!« •
»Welche Überraschung hat man sich
wohl dieses Mal für mich ausgedacht?« • »Wenn
meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, leide ich!« • »Hört
mir zu - ich habe etwas Spannendes zu erzählen!« •
»Bewundert mein gutes Aussehen!« • »Ohne
Luxus kann ich nicht leben.« • »Ich
benötige eine bevorzugte Behandlung.« |
Extrovertierte Service-Mitarbeiter • identifizieren sich völlig mit »ihrem« Unternehmen
oder tun wenigstens so. • wissen alles über die Marke und wenig zu
Produktdetails, • überraschen ihre Kunden [/
Vorgesetzte] gerne mit Extras, •
nehmen für diese Extras verspätete Lieferungen in Kauf, •
nehmen sich viel Zeit für Präsentationen, •
gönnen sich und ihren Kunden gerne ein wenig Luxus. Extrovertierte
Service - Mitarbeiter passen sehr gut in unkonventionelle Unternehmen:
schrille Modeboutiquen, schräge Werbeagenturen und Design-Ateliers,
ungewöhnliche Hotels oder Freizeitparks.
|
|
Er ist
ein durch und durch rationaler [sic!] Mensch.
Vor jeder Investition analysiert er die Angebote, vergleicht
Produktmerkmale und Preise, informiert
sich in Fachzeitschriften und beim Verbraucherschutz, wägt Vor- und Nachteile ab. Er
kauft dort, wo er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis findet – ob ihm ein
Unternehmen oder seine Mitarbeiter
sympathisch sind oder nicht, spielt eine untergeordnete Rolle [sic!]. Service bedeutet für ihn, dass man
ihn mit Zahlen, Daten und Fakten versorgt.
Er
kleidet sich vor allem praktisch – Moden und Konventionen sind ihm völlig
gleichgültig. Optimierung,
darum geht es dem Analytiker. • »Gebt
mir Daten, damit ich den Fall analysieren kann.« • »Ist
das wirklich der günstigste Anbieter?« • »Gibt
es keine anderen Produkte, die zum gleichen Preis noch mehr können?« • »Design
spielt keine Rolle - auf die Funktion kommt es an.« • »Wo
können wir noch etwas einsparen?« •
»Können wir den Vorgang verkürzen oder vereinfachen?« • »Es
interessiert mich nicht, wie modern etwas ist, sondern nur, wie gut es ist.« • »Ist
das der optimale Zeitpunkt?« • »Ich
will Testberichte sehen!« |
Analytische Service-Mitarbeiter •
suchen die aus technischer Sicht optimale Lösung, • argumentieren ausschheßlich mit
Daten, Zahlen, Fakten, •
können »irrationale« Kundenwünsche nicht verstehen, • präsentieren
knapp und schnörkellos, •
halten Service-Extras für unnötig, • sehen
nur die sachliche Ebene, nicht die menschliche. Als
Controller oder IT-Experten sind Analytiker hervorragend aufgehoben - vor
allem, wenn sie hauptsächlich mit anderen Analytikern in Kontakt stehen.
|
Wenn
das Bauchgefühl stimmt, ist für den Harmoniker die Welt [sic!] in Ordnung. Ihn interessieren technische Details
und auch die Schnäppchenjagd nicht sonderlich. Was für ihn zählt, ist eine
gute Beziehung zum Unternehmen. Weil er viel
Zeit braucht, um Vertrauen zu entwickeln, liebt er ausgedehnte
Gespräche auch über private Themen. Der
Harmoniker entscheidet sich am liebsten gemeinsam
mit seinen Kollegen oder seiner Familie für eine Dienstleistung oder ein
Produkt.
Gemeinschaft ist das, was für den Harmoniker zählt. • »Wenn
Chef und Mitarbeiter mir sympathisch sind, kaufe ich gerne wieder hier ein.« •
»Lassen Sie uns erst einmal in Ruhe kennen lernen.« •
»Passen unsere Wertvorstellungen zusammen?« • »Ich
stimme jeden fraglichen Punkt mit den Kollegen / der Familie ab.« • »Ich entscheide erst dann, wenn sich die Entscheidung gut anfühlt.« • »Wenn
das Unternehmen sich sozial [/ ökologisch] engagiert, zahle ich gern etwas
mehr für seine Produkte.« • »Wenn
jemand mich nur deshalb freundlich
behandelt, weil er mir etwas
verkaufen will, werde ich misstrauisch.« • »Auf
der menschlichen Ebene muss es stimmen.« • »Wenn
wir uns gut verstehen, können wir ins Geschäft
kommen.« •
»Meinem Bauchgefühl kann ich immer vertrauen.« |
Harmonische Service-Mitarbeiter • tun
alles, damit der Kunde sich wohl
fühlt, • können sich gut in Kundenwünsche einfühlen, • vergewissern sich oft bei ihren
Vorgesetzten, •
agieren leise und zurückhaltend, • sorgen für gute [sic!] Stimmung im
eigenen Team, •
drängen den Kunden niemals zu einer Entscheidung. Service-Mitarbeiter
mit einem starken Hang zur Harmonie können bei Unternehmen gut aufgehoben
sein, die persönliche Dienstleistungen erbringen. Ihre Stärke ist ihr gutes Einfühlungsvermögen,
|
|
[Sich / Anderen was davon anzutun / abzuverlangen? – erweisen
sich/wir als wesentliche / im engeren Sinne Fragen; durchaus erheblich
überformt von durch Status-, Geschlechts- und/oder gar Liebes- bis Weisheitsangelegenheiten] |
(Vgl. M.v.M. mit Sabine Hübner in ‚Service mit dem
inneren Schweinehund‘ S. 56 bis S. 71;
verlinkende und manch sonstige Hervorhebungen O.G.J.) |
[Andere Unterschiede,
exotische über etwa erotische bis etwa
xenophobische Abstoßungs und Anziehungskräfte
verstärken zumal Spannungen durchaus
erhelblich] |
#hier
|
[Empirische Fenster öffnen und Wirklichkeitsstücke,
die gar zu wenig gesehen werden, …] |
Moralische
Empörungen über allerlei ‚(typologische) Frustrationen‘ (namentlich des östlich anschlie0enden Kaiserbaus bis Michaelsflügels und\aber des nördlichen
Erfahrungsflügels der Erkenntnis/se
wegen) sind/werden meist omnipräsent: Äußerlich,
die ungeheuerliche Anderheit sonstiger
Typen, mit angeblich ‚deren‘ Anziehungs- plus Abstoßungskräften. – Sowie innerliche
Bemerkbarkeiten anteiliger/aspektischer Auchheiten ‚in‘/bei mir selbst,
gleich gar als selbige
Individualität. |
|
 [Träumt es sogar von wessen Kotau – oder versucht sich/andere nur wer worin?]
[Träumt es sogar von wessen Kotau – oder versucht sich/andere nur wer worin?]
Na klar ist und wird das Egoismus-Syndrom .... ![]() [Sie, Euer Gnaden,
behalten die Qual der Wahl Ihrer hier richtigen, zumal
verbalen, Phrase]
[Sie, Euer Gnaden,
behalten die Qual der Wahl Ihrer hier richtigen, zumal
verbalen, Phrase]
So mag durchaus zutreffen, dass unser (also des und der Menschen) ‚Ego‘ (gar und immerhin lebenslang) zumindest einen
endlosen Strom von Gedanken und Gefühlen
fabriziert (und/oder zu empfangen –
jedenfalls – meint, bis vermag).
[Abbs. Staustufe Siegmaringer Schloss des Gedankenflusses] Wichtig
dabei, bis dagegen, ist/wird bzw. wäre allerdings, dass (mit der immerhin ehrwürdigen Meisterin Jetsunma Tenzin
Palmo) nicht dieser gewaltige, kaum aufhaltbare (sei er nun ein eher ‚natürlich‘ vorfindlicher und/oder gar selbstfabrizierter bzw.
potenzierter, bis exponenezieller) Strom das
Problem (oder womöglich dessen zu denkende, äh erforschende bzw. zu fühlende,
Lösung) enthält – sondern, dass/falls er (namentlich in Form / mittels seiner
gerade aktuellen Teile / Produkte) so elementar (d.h, bekanntlich: über Leben
und Tod miteintscheidend) ernst genommen wird, dass wir uns – gar selbst Sie/Euer Gnaden sich – mit diesen
Gedanken/Gefühlen bzw. Empfindungen identifizieren
/ selbig- ja gleich- und gemein-machen
(zeitgenössisch brav, etwa so ‚neuro-logisch‘ als wären wir/Sie unser/Ihr Gehirn, oder
Körper, oder Ansehen, oder Vermögen , oder Firma/sozio-kulturelle Figuration,
oder Taten und Unterlassungen pp.).
Etwa Paul Kohtes reduziert diese Komplexität
dadurch, dass er sie erhöht – mit seiner Vorstellung
einer Projektionsfläche [imaginär( unterstellt)er Wahrnehmungsmöglichkeit]
all der Gedanken aller an einer Besprechung
teilnehmenden Menschen während dieser ganzen ernsthaften Sitzung (etwa auch
z.B. einer Geschäftsleiter- bzw. Mittarbeiterbesprechung oder
Regierungskabinettssitzung). Aus persönlicher Selbsterinnerung, eigner
Beteiligung an derart wichtigen Situationen, heraus mag durchaus einleuchten, dass/wie Beobachter überzeugt wären:  [Die Joint Chiefs of staff / Generalstabschefs
unterstehen dem oberbefehlshabenden US-Präsidenten / Regierungschef]
[Die Joint Chiefs of staff / Generalstabschefs
unterstehen dem oberbefehlshabenden US-Präsidenten / Regierungschef]
‚Einer «Truppe von Verrückten» vor sich zu haben‘. Und so [sic!] sei auch «dieses Königreich ‚Ego‘ entstanden; «wo es irgend einen anonymen Herrscher gibt, der aber gar nicht selber herrscht – sondern ständig beherrscht wird, von anderen Strukturen: von der Aggression, von seiner Ablehnung, von seinem Verteidigungsmister, von allem was so zu einem Königreich dazu gehört. Und das sind alles Facetten, die in unserem Hirn [neurologisch respektive sozialpsychologisch messbar] stattfinden, die aber autonom ablaufen, meistens jedenfalls, und gar nicht mehr [sic! sofern überhaupt bereits einmal, gar vielleicht bedingt in Kleinkindertagen? O.G.J.] ] von mir gesteuert werden. Und das ist ja ein desaströser [gar kompensatorische Kontrollsucht über alles und jeden anderen Menschen provozierender, oder scheinlegitimierender? O.G.J.] Zustand: Dass dieses Königreich da einfach vor sich hinwerkelt, ja vor sich hin regiert. Und niemand nimmt Einfluss darauf, niemand strukturiert das, [vgl. alternativ R.O.-B.'s Metapher von Kutscherin oder Kutscher mit Fahrzeug und Pferden] Sondern da werden Entscheidungen getroffen, von denen [zumindest] ich hinterher, staunend davor stehend, nicht selten bemerke, dass ich/wir sie ausgerechnet rational handelnd und/oder auf das (ungehört gebliebene) vielleicht sogar mehrheitliche ‚Bauchgefühl‘ vertrauend, überhaupt nicht gewollt habe/n/hätten.
 Eben nur allzu oft oder wenigstens Opfer Ihres/unseres/meines eigenen Innen- oder
Verteidigungsministers geworden – bekanntlich
die intensivsten ‚Beter‘ jedweder Art
von ‚Nation‘ – allerdings darum, dass
was auch immer sonst eintreten möge, nur. um aller Himmels Willen, nur keine (innere
und/oder äußere) Sicherheit. –
dies(e) würde nämlich Kontrolle äh
solche Minister elementar verzichtbar, bis – gar
mit Jesaja 61 das ‚Machen von‘ / ‚Bemühen um‘ (wenigstens
aber das ‚wechselseitige Erzwingen von [gleich gar/zumal nicht-kriegerischer] Koexisrenz‘) – überflüssig machen.
Eben nur allzu oft oder wenigstens Opfer Ihres/unseres/meines eigenen Innen- oder
Verteidigungsministers geworden – bekanntlich
die intensivsten ‚Beter‘ jedweder Art
von ‚Nation‘ – allerdings darum, dass
was auch immer sonst eintreten möge, nur. um aller Himmels Willen, nur keine (innere
und/oder äußere) Sicherheit. –
dies(e) würde nämlich Kontrolle äh
solche Minister elementar verzichtbar, bis – gar
mit Jesaja 61 das ‚Machen von‘ / ‚Bemühen um‘ (wenigstens
aber das ‚wechselseitige Erzwingen von [gleich gar/zumal nicht-kriegerischer] Koexisrenz‘) – überflüssig machen.
 Schon heftig, dass / falls \ wenn (oder wo)
Menschen nicht anders
könn(t)en als von sich selber auszugehen?
[‚Wessen Ego‘ / Positionswechsel, derer
die hier thront/en, ändert nichts an Bedürfnissen
– verdeutlicht allenfalls
etwas an / von komplementären
Wechselseitigkeiten] Falsche (/ überbotene
Trenn-)Fragen, wie ‚devot versus dominannt‘, äh Gartenbankangelegenheiten?
Schon heftig, dass / falls \ wenn (oder wo)
Menschen nicht anders
könn(t)en als von sich selber auszugehen?
[‚Wessen Ego‘ / Positionswechsel, derer
die hier thront/en, ändert nichts an Bedürfnissen
– verdeutlicht allenfalls
etwas an / von komplementären
Wechselseitigkeiten] Falsche (/ überbotene
Trenn-)Fragen, wie ‚devot versus dominannt‘, äh Gartenbankangelegenheiten?  Hauptschwierigkeiten der ‚Ego‘-Diskurse/Thematiken
– derartiger, gar aller resch-Konzeption/en-
Hauptschwierigkeiten der ‚Ego‘-Diskurse/Thematiken
– derartiger, gar aller resch-Konzeption/en-![]() überhaupt, also:
überhaupt, also:
Dass/Wo schon einige Leute mehr bemerkten,
![]() dass/wie das, dem Vorwurf des ‚Hedonismus‘
auszusetzende, ich אני /ani (bis gar anochi/ אנוכי ICH) des Egoismus zwar (jederzeit
beliebig) vom / durchs
dass/wie das, dem Vorwurf des ‚Hedonismus‘
auszusetzende, ich אני /ani (bis gar anochi/ אנוכי ICH) des Egoismus zwar (jederzeit
beliebig) vom / durchs  [Des
‚Interpunktierenskreislaufs‘ vortrefflichste
Peinlichkeiten-Mehrungen:
Omnipräsent( wachsend)e Rücksichtslossigkeiten-Erfahrungen,
dass gar nicht
[Des
‚Interpunktierenskreislaufs‘ vortrefflichste
Peinlichkeiten-Mehrungen:
Omnipräsent( wachsend)e Rücksichtslossigkeiten-Erfahrungen,
dass gar nicht jede Gemeinheit bis Krimmunalität ‚(‚dumm‘ äh) auf einem (summenverteilungsparadigmatischen
/ ermessens) Irrtum beruhen muss‘, so manches
schlicht Absicht, immerhin listige/kolaterale ‚in Kauf nahme‘,
oder aber/allenfalls
‚Unfall‘, sein/werden
mag]
![]() Du (ups
genderspezifiziert את /at/ oder /ara/ אתה) ersetzbar, davon und dadurch
aber nicht im Geringsten ‚altruistisch(er)‘ ist/wird
– allenfalls (ausgleichend, bis
überkompensatorisch eher) in Gegenteilen.
Du (ups
genderspezifiziert את /at/ oder /ara/ אתה) ersetzbar, davon und dadurch
aber nicht im Geringsten ‚altruistisch(er)‘ ist/wird
– allenfalls (ausgleichend, bis
überkompensatorisch eher) in Gegenteilen.
![]() [
[![]() Des Personalisierungsscanners
Fehler-/Störungs(liste_Nr.3) angereichert/vereschlimmbessert durch den zweiten der zehn ‚dümmsten Fehler kluger
Leute‘:
Des Personalisierungsscanners
Fehler-/Störungs(liste_Nr.3) angereichert/vereschlimmbessert durch den zweiten der zehn ‚dümmsten Fehler kluger
Leute‘: ![]() Gedankenlesen. – Die zumeist (spätestens
im individuellen/situativen
Detail) irrige
Unterstellung der/die andere/n dächte/n,
fühlte/n, wollte/n
‚genau das was ich, an dieser/deren Stelle, gerade denke, fühle und will‘. Eben
inklusive moralischer (eben nicht allein
intellektueller) Empörungen, dass/wenn immer ‚sich jemand erdreistet‘, abweichender Auffassung zu sein/bleiben]
Gedankenlesen. – Die zumeist (spätestens
im individuellen/situativen
Detail) irrige
Unterstellung der/die andere/n dächte/n,
fühlte/n, wollte/n
‚genau das was ich, an dieser/deren Stelle, gerade denke, fühle und will‘. Eben
inklusive moralischer (eben nicht allein
intellektueller) Empörungen, dass/wenn immer ‚sich jemand erdreistet‘, abweichender Auffassung zu sein/bleiben]  [Sozio-logischerweise wird gemeinsam
Zusammenhaltendes, gerade auch bei ‚inhaltlichen‘/geregelten Auseiandersetzungen, (spätestens ‚notfalls‘) äußerlich/rituell
kompensativ dutch Abgrenzungen von, bis Aus-Eingrenzung der/des,
anderen gesucht/versucht]
[Sozio-logischerweise wird gemeinsam
Zusammenhaltendes, gerade auch bei ‚inhaltlichen‘/geregelten Auseiandersetzungen, (spätestens ‚notfalls‘) äußerlich/rituell
kompensativ dutch Abgrenzungen von, bis Aus-Eingrenzung der/des,
anderen gesucht/versucht]
Auch so/daher kam und kommt es zu
überindividueller Vergottung, äh Singularisierung, ![]() All der
anderen, bis von
All der
anderen, bis von ![]() uns allen, zum/als kollektiv vorgegeben
unterstelltes ‚Wir/Gemeinwohl‘ (dem אנוכיואת׀ה beide[s sendend-empfangende],
äh alle,
dienstbar …).
uns allen, zum/als kollektiv vorgegeben
unterstelltes ‚Wir/Gemeinwohl‘ (dem אנוכיואת׀ה beide[s sendend-empfangende],
äh alle,
dienstbar …).
[Gerade optisch/‘cheering‘/beobachtend ‚vereinfacht‘
פשט unterscheiden/t sich die Darstellung/en beider(lei quasi)
Universumsvorstellungen – hier beim Knie der Cheerleaderin angebracht/enthüllt
פשט /pschat/ – vor und eben nach G’ttes Widerspruch (gar
zur/gegen die Grundstrukturen des, zudem
monokausalistischen, Mythos, gleich gar abendländischen Singularverständnisses)
erheblicher als dies(es ‚eine andere Pünktchen‘
so) manchen erscheinen mag, bis kann]  Gegenüber
solch kosmischen Konzepten – (für und mit
sich) alleine nahe um sein/das einzige/s יחיד Zentrum, seine ‚sich allenfalls (bis ungern, respektive fälschlich)
individuell vorkommenden‘,
Teile vorübergehend kreisen, jedoch ‚eigentlich dahin zurückkehren / sich auflösend damit vereinigen s/wollen‘,
mögenden;
Gegenüber
solch kosmischen Konzepten – (für und mit
sich) alleine nahe um sein/das einzige/s יחיד Zentrum, seine ‚sich allenfalls (bis ungern, respektive fälschlich)
individuell vorkommenden‘,
Teile vorübergehend kreisen, jedoch ‚eigentlich dahin zurückkehren / sich auflösend damit vereinigen s/wollen‘,
mögenden;
 [Mehrere
Globi/en – gar-ups anti-gnostisches Bekenntnis zu/von Schöpfungsberechtigung zumindest von ‚Innerraumzeitlichkeiten‘]
[Mehrere
Globi/en – gar-ups anti-gnostisches Bekenntnis zu/von Schöpfungsberechtigung zumindest von ‚Innerraumzeitlichkeiten‘]
stehe/t hier ein/das ‚wirkliche/s wir‘ – gleichwohl eben
nicht-dualistisch widerstreitend
summenverteilendes –
zwiegesprächlich qualifiziert ‚dialogisches‘,
einender durchaus Respektsabstände wahrend komplementär/gerde
ungleicher bis kritischer/oppositioneller, jedoch ‚ebenbürtig‘
interagierender, (Freundschafts-)Bündnispartnermächte (die durch wechselseitig hinreichend
zuverlässigen Willkürverzichte/Vertragstreue,
ansonsten nicht vorhandene/unzugängliche, gemeinsame Möglichkeitenspielräume erschaffen). 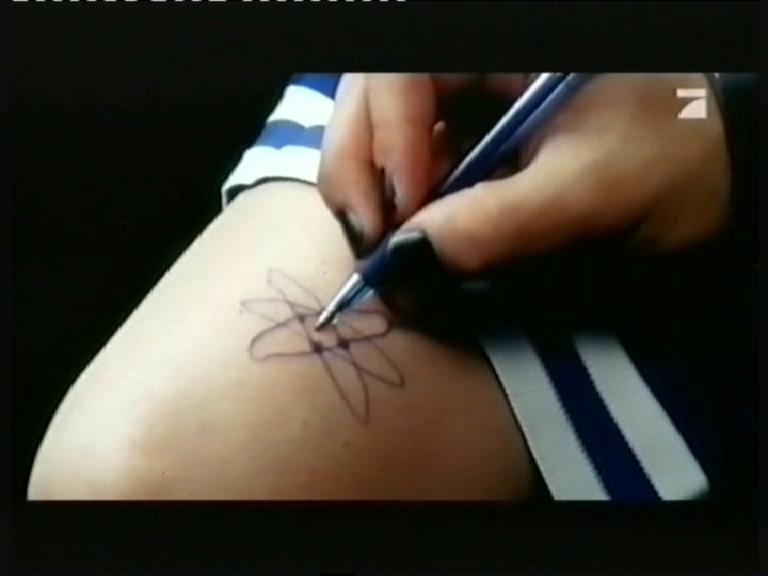
[Nicht einmal, und schon gar nicht, G’tt dazu verpflichten / darauf beschränken, äh so verstehend begreifen, müssend: nur/immerhin im/als der/die anderen Menschen (aber/also nicht auch, oder allenfalls insofern, ‚innerlich/e‘ – zumal ‚Spuren unter der Sonne‘) ‚auf Erden antreffbar …‘]
 [Reverenzen,
exemplarisch immerhin zweier, oder gar beider,
Töchter einer – hier in diesem Hochschloss
vielleicht sogar manchmal Hebräisch/Iwrit verwendender/folgender –
Stimme – für/vor Euer Gnaden]
[Reverenzen,
exemplarisch immerhin zweier, oder gar beider,
Töchter einer – hier in diesem Hochschloss
vielleicht sogar manchmal Hebräisch/Iwrit verwendender/folgender –
Stimme – für/vor Euer Gnaden]
‚Eine‘ über ‚sehr Vieles‘, bis ‚zu Viel(es)‘, entscheidende Problemfacette, auf einer weiteren Seite des Ego(ismus)vorwurfs ist ja die omnipräsente, reflexartig eingeübte Denkform/Sichtweise:
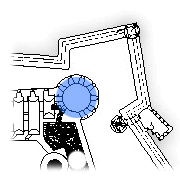 Wenn und/oder da die oder der Andere bzw. die Anderen
sich nicht so verhalten, bis
sind; wie ich bzw.
wir es ‚für richtig/wahr bzw. natürlich oder erwünscht
halte/n, dann sei dies (oder nullsummenparadigmstisch
eben: ich/Du) selbstsüchtig‘ (‚nicht-erwachsen‘, ‚respektlos‘
oder gleich und von hier oben aus, drunten so maximal kontrastkar gut/eindeutlich
einsehbar basal ‚schlecht/böse‘) zu nennen; um damit eben, so wirkmächtig
und umgehend wie nur möglich, eine ‚demütige‘, äh passende, Änderung
zu fordern bis erzwingen (zu dürfen/können).
Wenn und/oder da die oder der Andere bzw. die Anderen
sich nicht so verhalten, bis
sind; wie ich bzw.
wir es ‚für richtig/wahr bzw. natürlich oder erwünscht
halte/n, dann sei dies (oder nullsummenparadigmstisch
eben: ich/Du) selbstsüchtig‘ (‚nicht-erwachsen‘, ‚respektlos‘
oder gleich und von hier oben aus, drunten so maximal kontrastkar gut/eindeutlich
einsehbar basal ‚schlecht/böse‘) zu nennen; um damit eben, so wirkmächtig
und umgehend wie nur möglich, eine ‚demütige‘, äh passende, Änderung
zu fordern bis erzwingen (zu dürfen/können).
Denn schließlich möchte ja, bis
dürfe, sich niemand ‚ego-sücjtig‘ nennen/schelten lassen (gar ‚da man
es dadurch selbstschädlich und/oder
asozial werden, bis sein, könnte‘, und dies keinesfalls dürfe, respektive
dafur/damit das Ganze – also auch sich selbst, als auf immerhin Duldung
durch den/die Andere/n angewiesen – zumindest
gefährde). 
Besonders hinterhältig daran ist, unter anderem, dass es durchaus Individuen und Gruppen gibt, die sich (sei dies nun intendiert – nicht zuletzt aus kurzfristig, einseitigen/mächtigen Optimierungs-Interessen heraus und/oder weil sie diese motivationale Strategie des Heteronomosmus durchschauen, bis entlarfen/bekämpfen, nutzen, oder bedrückend empfinden –, selbst bemerkt oder selbst nicht wahrgenommen) egoistisch bzw. (als Gemeinwesen) schowinistisch verhalten – und gar eher noch mehr Leute und Sozialfigurationen/Organisationen, deren Verhalten so wirkt, bzw. entsprechend gedeutet werden kann
(zumal sich dies logisch stringent aus dem, so gerne gelobten angeblichen Gegenkonzept, ‚dem Altruismus‘, namentlich als verzweckte, bis frustrierte, Selbstaufopferung, statt als arglistige [womöglich Selbst-] Täuschung, und spätestens kontrafaktisch bekanntlich immer jederman, vorhaltbar bleibt)
deutlich, dass/was auch eine der wohl bedeutendsten/folgenreichsten Einsichten von (namantlich schottischen) Moralphilosophen neuzeitlicher ‚Moderne‘ damit zu tun hat: Dass etwa ein Bäcker seine Erzeugnisse weder aus ‚reiner‘/alleiniger Nächstenleibe herstellen, noch völlig selbstlos verkaufen, bis selbstgefährdend verschenken, muss (oder gar darf) um-zu ermöglichen (jedenfalls seinerseits nicht zu behindern – aber eben alleine/autark, ohne/gegen die Anderen, keineswegs erzwingen zu können), dass viele Leute, bis alle Beteiligten (gar ‚die Wirtschaft‘ insgesammt), davon profitieren (zwar nicht unbedingt einen sogenannten/besteuerbaren ‚Mehrwert‘, doch zumindest ‚ein Mehr an Produkten‘, zu- bis aufteilen) können.
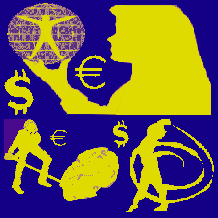 [Da/ss ein
gegenwärtiger ‚Arbeiterhaushalt‘ den Lebenstandard,
jedenfalls die Konsummöglichkeiten,
eines ‚mittelalterlichen‘ Grafenhauses aufweist – hat mit Produktivitätssteigerung zu tun / bedauern gar
nicht alle]
[Da/ss ein
gegenwärtiger ‚Arbeiterhaushalt‘ den Lebenstandard,
jedenfalls die Konsummöglichkeiten,
eines ‚mittelalterlichen‘ Grafenhauses aufweist – hat mit Produktivitätssteigerung zu tun / bedauern gar
nicht alle]
Weder da/ss es diese Denkformen und Argumentationskonzepte (namentlich ‚selbstsüchtige Egoismusvorwürfe‘ und/oder ‚Rücksichtsforderungen‘) gibt – noch, dass sie
 [Jederzeit beliebig (ein- bis
vielstimmig), im Chor, abrofbar: ‚Alles nur noch Egoisten, jede/r denkt
allein an sich‘ – nur ich, ganz allein, denke an mich]
[Jederzeit beliebig (ein- bis
vielstimmig), im Chor, abrofbar: ‚Alles nur noch Egoisten, jede/r denkt
allein an sich‘ – nur ich, ganz allein, denke an mich]
(und vorauseilende – gar vergebliche – häufig
‚Gehorsam‘ genannte Gefolgschaft zu i/Ihrer
angeblichen/sprachlichen ich-Vermeidung)
hochwirksam bzw. nützlich sind, müsste bestritten werden,
![]() um berechtigte Zweifel an der ihnen (univok) entsprechenden Existenz des (etwa mit
‚Gier‘ / ‚Sucht‘ pp.) Gemeinten / Begriffenen, an (oder gar ‚irgendwo in‘) natürlichen, sozial-figurierten bzw. juristischen
und selbst virtuellen Personen / Wesen zugeschriebenen Mangels, eben (.entweder ‚gut‘..oder ‚böse‘.) anstelle
um berechtigte Zweifel an der ihnen (univok) entsprechenden Existenz des (etwa mit
‚Gier‘ / ‚Sucht‘ pp.) Gemeinten / Begriffenen, an (oder gar ‚irgendwo in‘) natürlichen, sozial-figurierten bzw. juristischen
und selbst virtuellen Personen / Wesen zugeschriebenen Mangels, eben (.entweder ‚gut‘..oder ‚böse‘.) anstelle ![]()
![]() von in/an Summen-verteilungsparadigmatisch(
strukturell unausweichlich)en ups Konflikt/e-Fragen
überhaupt, respektive deren Leugnung/Ignoranz/Verwendung,
gelegen;
von in/an Summen-verteilungsparadigmatisch(
strukturell unausweichlich)en ups Konflikt/e-Fragen
überhaupt, respektive deren Leugnung/Ignoranz/Verwendung,
gelegen;
![]() oder aber alternativ,
um den erheblichen Verdacht, aufkommen. zu lassen:
oder aber alternativ,
um den erheblichen Verdacht, aufkommen. zu lassen:
 [[Herrschafts-
bis sogar Gegenüber-Macht-Fragen
stellend, respektive dies/e (zumal als Existenzvorwürfe. zumindest wegen des/der kaiserlich, äh unausweichlich Anderen) bemerkend]
[[Herrschafts-
bis sogar Gegenüber-Macht-Fragen
stellend, respektive dies/e (zumal als Existenzvorwürfe. zumindest wegen des/der kaiserlich, äh unausweichlich Anderen) bemerkend]
Dass iedes mal, bis nur,
die Existenz des anderheitlich Ungeheuren/Vertrauen
(anderer
Gebäudeteile eben desselben Hochschlosses)
in ‚Euch‘ bzw. ‚Du‘ und ‚ich‘, bis ‚es‘,
abgetrennt, äh adressiert,
wird, bekämpft, erhalten, bestritten pp., eben (über uns/Sie) bestimmt werden soll. – Ein womöglich sogar singulärer,
respektive immerhin zeitweise, bis überwiegend, so erfahrener,
allzu meist – wenn auch in einigen Hinsichten notwendigerweise vergebens – als ‚innerer‘ oder ‚Innerstes‘ zu um- äh zu begreifen versuchter, ‚Kern‘, soll und
muss damit nicht ausgeschlossen sein/werden – mag
sich eher als einziges (selbst) soweit (gar absichtlich) nur
‚durchstreichen‘, bis qualifiziert
aufheben, oder (gar versehentlich und/oder nebenan fremdmotiviert –
namentlich eben: verzweckt) ‚vergessen‘ / ‚verlieren‘ können; dass also vielleicht
sogar Sie / Dero
Gnaden sich selbst zu verfehlen, ![]() ... [die passendere ‚Verbform‘ wissen oder vermuten immerhin Sie
selbst].
... [die passendere ‚Verbform‘ wissen oder vermuten immerhin Sie
selbst].
Insofern (‘sorry‘ oder auch/doch nicht)
![]() gibt es / existiere(n)
[ani/] ‚ich‘ וו gar [anochi/]
‚mich‘,
gibt es / existiere(n)
[ani/] ‚ich‘ וו gar [anochi/]
‚mich‘, ![]() existieren wahrscheinlich mehrere ‚ich's‘,
existieren wahrscheinlich mehrere ‚ich's‘,
![]() bis immerhin (so) viele ‚Du's‘ respektive ‚Sie/s‘,
bis immerhin (so) viele ‚Du's‘ respektive ‚Sie/s‘,
die m/sich so empfinden (und/oder immerhin zeitweise entsprechend nennen/genannt werden, können):

‚Akt(ions)zentren des und der Menschen‘,
sogar an ‚ihren‘ Auswirkungen ‚in Raum und Zeit‘ (der
Welt von Ja, Nein und\aber diesbezüglich
Unentschieden) erkennbar, wenn auch nicht in
‚der‘ (einzigen
äh einen) Art und Weise darin 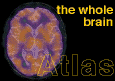 [nämlich im Köepr oder als Teil
einer Person / von Lebewesen] (ausgerechnet, zumal ‚stofflich‘, insbesondere nach Licht-Farben-Klang,
‚im Gehirn‘) zu
verorten gesucht (zu) werden (hätten).
[nämlich im Köepr oder als Teil
einer Person / von Lebewesen] (ausgerechnet, zumal ‚stofflich‘, insbesondere nach Licht-Farben-Klang,
‚im Gehirn‘) zu
verorten gesucht (zu) werden (hätten).
Unzerstörbar mag das/Ihr
individuelle/s, (dazu) nicht notendigerweise
unbedingt ‚Seele‘ /
‚Psyche‘ zu nennende, durchaus Zentrum
zwar schon sein oder werden,
aber unwandelbar muss es hoffentlich nicht schon immer (in dem Sinn) gewesen sein (dass 'subarBZIELL# ÜVERHAUPT nichts und niemand
dazugelernt respektive anders, gar besser, werden kann). ![]()

Für ein Denken und wo (zeitgleich / gleichzeitig) immer Alles mit Allem singulär (gar ‚pantheistisch‘) Eines bzw. Dasselbe wäre, mögen oder müssten (womöglich alle) diese Begrifflichkeiten – und zwar gerade in ihren ‚inhaltlichen‘ Hinsichten, des damit Gemeinten – Synonyme, also Ausdrücke für (Teile – bestenfalls Teilperspektiven / Aspekte) des Gsnzen sein – das verwerfen zu wollen damit plötzlich näher gelegen sein kann, als mancher Mensch in den besten Absichten vermutet oder gar wollte. Hier im bis als Turm dieses Hochschlosses dürfen, und sollen sie sogar/gerade, Unterschiede machen – vielleicht jene die S/sie wollen, zumindest solche, die in ein- und demselben Schiff des Handelns, nicht gleichzeitig zu meheren verschiedenen Ufern zu fahren – da es solche nichtidentischen Ufer (gar dadurch qualifiziert) gibt (dass ich mir bzw. wir uns nicht ‚nur‘ virtualita zugänglich machen äh einbilden / vorstellen es gäbe s/Sie: Du, ich, es, er, wenn auch – mit ausgerechnet antitotalitärern Ausnahmen – im Plural). Wobei bis wogegen die Existenz von Unterschieden / Differenz und sogar von Diskontinuitäten nicht bedeuten muss, dass immer alles vollständig totaliär, unverbindbar oder unverbunden von- bis gegeneinander sein/bleiben müsste.
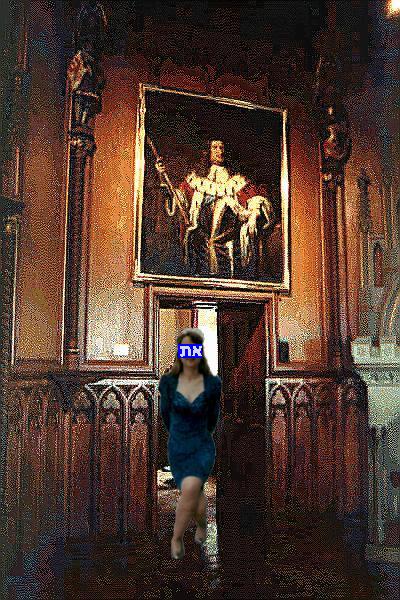 [Kaum eine regierende Herzogin, und gleich gar
Königin, zu deren Adelstiteln, respektive
Herrschaftsfunktionen, nicht zugleich auch, bis mehrfach, ‚Gräfin‘ zählen]
[Kaum eine regierende Herzogin, und gleich gar
Königin, zu deren Adelstiteln, respektive
Herrschaftsfunktionen, nicht zugleich auch, bis mehrfach, ‚Gräfin‘ zählen]
Dem holzvertäfelten ‚ich aber denke / sage / verberge / tue Euch‘
Türzwischenraum von/zur Bibliothek der Erkenntnisse
mit dem hier sogenannten Markgrafenzimmer, zumindest dieses Selbstturms,
trennend und verbindent – ‚gegenüber‘ findet sich mancher Launen- oder
Gestimmtheitstüre(h) zum und vom kaiserlichen Anderheitsbau.
 [Eine, bis die ‚eigentliche‘ eben nicht
bloß/immerhin Könige überbietende, Ungeheuerlichkeit von Anderheit/en /
Nichtidentität bleibt_ Dass gar niemand an der damit ups kaiserlichen
Majestät jedes (nicht vollständig determinierten / zweiten, auch/gerade nur
bedingten Freiheits-)Subjekts vorbei kommt]
[Eine, bis die ‚eigentliche‘ eben nicht
bloß/immerhin Könige überbietende, Ungeheuerlichkeit von Anderheit/en /
Nichtidentität bleibt_ Dass gar niemand an der damit ups kaiserlichen
Majestät jedes (nicht vollständig determinierten / zweiten, auch/gerade nur
bedingten Freiheits-)Subjekts vorbei kommt]  Wie leicht, bis vielleicht werde jemand etwas anderes
bewusst?/!
Wie leicht, bis vielleicht werde jemand etwas anderes
bewusst?/!
[Baulich sehr nahe benachbart, beinahe ‚genau‘ darüber, befindet sich nämluch/eben – sogar der minimalster Möglichkeit(en)korridor (wenigstens/immerhin des ‚Unterlassen[können]s)]
‚Frau Gräfin‘, ‚Herr Graf‘ sollen, bis sollten, bekanntlich eher untergebene Menschen bzw. i/Ihnen/den Hoheiten in, zumindest einem bestimmbaren Sinne anvertraute (eben nicht immer auch angetraute) Personen, gleich gar (beim) Betreten, mehr oder minder verbal sagen, Mademoiselle Komptesse.
Wenn/Wo am (auch/gerade einem vorgegebenen, äh dem ereichten) Eregbnis alle, zumindest durch deren Nicht-Verhinderung/deren Duldung, beteiligt, höchstens Scheitern (manchmal) einzelnen zurechenbar scheint/ist, aber alle betrifft – sei selbstbezeichnend/selbstverstehend** von ‚wir‘ die Rede..
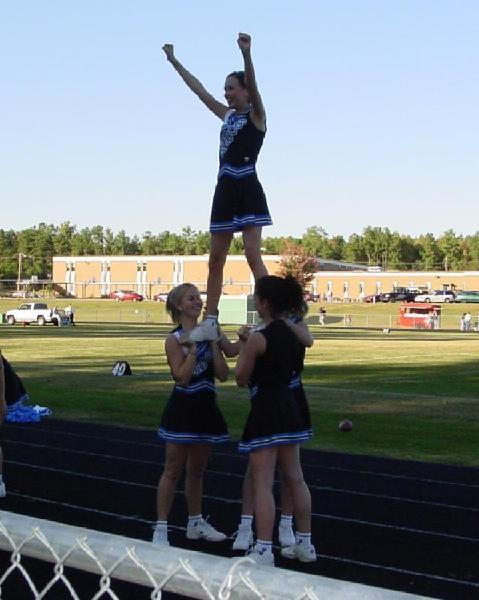 [Wir – bereits emergentes ‚mehr‘, jedenfalls
etwas anderes, als Summe/Produkt der/seiner Teile – gar
wav-qualifizierte Einheit, ohne vernochtende Auflösung der Beteiligten im/zu
Ganzen]
[Wir – bereits emergentes ‚mehr‘, jedenfalls
etwas anderes, als Summe/Produkt der/seiner Teile – gar
wav-qualifizierte Einheit, ohne vernochtende Auflösung der Beteiligten im/zu
Ganzen]  Von derart gleich- oder höherrangigeem
Ansehen, dass sigar eine Heirat (soziologisch die höchst mögliche
Beziehungsintensitätsstufe nach Gruss-, Tauschhandels-, und Frendschaftsrelationen
) ohne Statusverlust der Beziehung gegenüber vorherigem der Beteiligten
wurde/wird ‚geburtszentriert‘/herkunftsorierentiert (durchaus
diskriminierend/‚verungleicht‘) ‚ebenbürtig‘-genannt.
Von derart gleich- oder höherrangigeem
Ansehen, dass sigar eine Heirat (soziologisch die höchst mögliche
Beziehungsintensitätsstufe nach Gruss-, Tauschhandels-, und Frendschaftsrelationen
) ohne Statusverlust der Beziehung gegenüber vorherigem der Beteiligten
wurde/wird ‚geburtszentriert‘/herkunftsorierentiert (durchaus
diskriminierend/‚verungleicht‘) ‚ebenbürtig‘-genannt.
 [/sod/ manchen gar
Geheimnisverrat] Selbstturm zumindest mit
[/sod/ manchen gar
Geheimnisverrat] Selbstturm zumindest mit ![]() D.b.G.
wäre zu bemerken, bis einzusehen: Dass Erfolge
(sozio-logisch unausweichlich) immer eine (‚plurale‘)
‚Leistung von uns‘ (gar allen zusammen), dem ‚wir‘ zuzurechnen, sind – logischerweise
spätestens, bis sogar gerade mit, all jenen Leuten, die sie (warum und wie auch
immer) nicht verhinderten.
D.b.G.
wäre zu bemerken, bis einzusehen: Dass Erfolge
(sozio-logisch unausweichlich) immer eine (‚plurale‘)
‚Leistung von uns‘ (gar allen zusammen), dem ‚wir‘ zuzurechnen, sind – logischerweise
spätestens, bis sogar gerade mit, all jenen Leuten, die sie (warum und wie auch
immer) nicht verhinderten.
Während ich Niederlagen/Scheitern, zumal sozialpsycho-logischerweise, stets mir (‚singulär‘)
alleine zuzuschreiben – als Autoritätsperson sogar als ‚meine Verantwortung zu
übernommen‘ – habe(n sollte, bis muss), äh zugewiesen
bekomme. 
Gleich gar da, wo ‚der Rabbi‘ mit seinem (weder notwendiegerweise besseren, noch immer schlechteren) Plan/Rat (wie ja auch in ‚Demokratie‘ und ‚Kompromiss‘ schon so oft) der entscheidenden Mehrheitsmeinung seiner Gemeinde unterlag, und deren Beschluss ausführte.
 Der
ganze Achtsamkeitsflügel bleibt schließlich
weitererseits so weit vom Selbstturm hier entfernt, dass s/Sie gerade nicht
ganz ohne Erfahrung/Erkenntnis 'zusammen (bzw. sowohl dahin als auch daher)
kommen' können.
Der
ganze Achtsamkeitsflügel bleibt schließlich
weitererseits so weit vom Selbstturm hier entfernt, dass s/Sie gerade nicht
ganz ohne Erfahrung/Erkenntnis 'zusammen (bzw. sowohl dahin als auch daher)
kommen' können.
Es 'steht' z.B. auf oder hinter einer der Holzwände des kleinen Zu- und Ausgangsraums der Erfahrung nach zu lesen / zu hören / zu sehen / zu merken oder ist vielleicht an der Decke bzw. auf dem Fussboden zu finden. - Und prompt ist das so gerne f+r unschuldig erklärte Säuglings-Baby, ganz besonders egoistisch selbstzentriert und lernt erst, meist mit ungefähr drei oder vier Lebensjahren, so etwas wie Empatie/Mitgefühl ('auch' bewusst - fgwa im Unterschied zum Empfinden, zumal mütterlicher, Gestimmtheiten anderer als eher inreföeltierte, gegebene Umweltbedingung) für andere bis schließlich sopgar für anderes (etwa Eigentum, Grenzen pp.). Auch bleibt dem Neugeborenen eher plausiebel zu unterstellen, dass es seine Bezigspersonen, wie namentlich Amme bzw. Mutter, benötigt, denn dass dies Liebe (gar in einer von Begriffsdifferenzen - etwa 'Kindes(/rl)iebe' und 'Mutterliebe', für sich mehrfach, teils überlappende Interverenzbereiche des Vorfindlichen - suggerierten Weise) zu sein hätte.
Das (‚Selber‘) und jedes Partizip selbst (und nicht etwa ‚persönlich‘) ist ja bereits und gerade darin uneindeutig, dass es zwischen Adjektiv und Verb ‚schwanken‘/wechselnd entweder, bis sowohl eine Eigenschaft beschreiben, als auch eine Handlungsweise (das mit den Seinsweisen ist ja noch weitaus komplexer bzw. wird in den Denkformen mancher Sprachen zumindest manchmal offen ‚wegge- bis unterlassen‘) benennen kann; und die bekanntlich eben auch daher ‚Mittelwort‘ genannt wird, bzw. dazwischen ‚daher kommend‘ nicht notwendigerweise immer konsensuale, mehr, oder meist minder, reflektierte, Interpretatio erfährt (bis erfordert).
 Gerade dabei (bei solch letztlich
unvermeidlich anthropomorpher/menschenähnlicher bis vermenschlichender Ausdrucksweuse) ist es aber (zumindest im
aktiven Geschlecht gesehen/genommen ja) gar nicht das/ein ‚Wort‘ bzw. der Aus- respektive Eindruck selbst
das/der etwas tut oder lässt, sondern die
interagierenden Menschen, die sich/andere
seiner subjektiv bedienen, bzw. seinen Bedeutungen unterwerfen, respektive zu
entziehen, versuchen – wenigstens aber, gar für möglichst absichtskonform
gehalten – mehr oder minder vverbindlich, darunter auswählen, und
herumwechseln. Hinzu kann kommen, bzw. dabei bleibt ‚sein-werdend‘
auch noch, dass das/ein ‚Wort‘/Aus- bzw. Eindruck gar nicht
notwendigerweise (und schon gar nicht immer) das Selbe ist, was es/er
ist bzw. sei – eben Töchter einer Stimme.
Gerade dabei (bei solch letztlich
unvermeidlich anthropomorpher/menschenähnlicher bis vermenschlichender Ausdrucksweuse) ist es aber (zumindest im
aktiven Geschlecht gesehen/genommen ja) gar nicht das/ein ‚Wort‘ bzw. der Aus- respektive Eindruck selbst
das/der etwas tut oder lässt, sondern die
interagierenden Menschen, die sich/andere
seiner subjektiv bedienen, bzw. seinen Bedeutungen unterwerfen, respektive zu
entziehen, versuchen – wenigstens aber, gar für möglichst absichtskonform
gehalten – mehr oder minder vverbindlich, darunter auswählen, und
herumwechseln. Hinzu kann kommen, bzw. dabei bleibt ‚sein-werdend‘
auch noch, dass das/ein ‚Wort‘/Aus- bzw. Eindruck gar nicht
notwendigerweise (und schon gar nicht immer) das Selbe ist, was es/er
ist bzw. sei – eben Töchter einer Stimme.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Das wichtige Gut, bzw. die
zentrale Erfahrung, der Selbstwirksamkeit – gleich
gar auf, bis über, Andere – ist/wird
Das wichtige Gut, bzw. die
zentrale Erfahrung, der Selbstwirksamkeit – gleich
gar auf, bis über, Andere – ist/wird 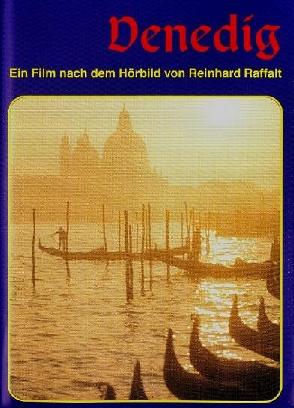 durchaus qualifiziert überwindbar – „Suche den
Schlaf, wenn Du liebt,
scheue ihn, wenn Du spielst, fürchte ihn
wenn Du regierst“ (vgl. Venedig R.R.) ... Vollendung
durchaus qualifiziert überwindbar – „Suche den
Schlaf, wenn Du liebt,
scheue ihn, wenn Du spielst, fürchte ihn
wenn Du regierst“ (vgl. Venedig R.R.) ... Vollendung 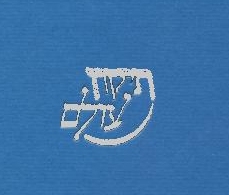
#hierfoto

File:///D:\sphaeren-ghz\hz-üanor-balkon055.jpg
Senioer de Montaigne – gar anstatt ‚immerhin‘ ebenfalls einen
Markgrafen (und sei es selbst jener zollerisch-preussischer Markbrandenburg) – zu bemühen liegt nicht unwesentlich an seinem geläufigeren
מיכאל-Vornahmen
‚Wer ist wie G'tt?‘ an einem anderen Ende des Anderheitsbaus, wesentlicher [sic! gerade er, bereits M.E.d.M.,
nicht erst M.v.M., warnte
uns bekanntlich ausdrücklich vor Komperativen] jedenfalls als sein ‚Geschlecht‘, in welchem Sinne des mehrdeutigen
Begriffes auch immer
– also in allen. Hinzu kommt, bzw. gehört, (hier) jedoch noch die, von
ihm zumindest erstmal so benannte, bis gefundene, literarische Form der Erkenntnisdarstellung
bzw. -findung die – gar im Widerspruch zum wohl
eher zum zeitgenössischen Trend  kartesischen
Schritt/Schnitt – eine geradezu umgekehrte ‚kopernikanische Wende‘ ermöglicht,
genauer überhaupt einmal: Den (und gar die) Menschen – konsequenterweise
keineswegs ohne Todverfallenheit – in den sogenannten
‚Mittelpunkt‘ stellend bzw. als und zum
Ausgangspunkt des eigenen Seins,
oder zumindest Denkens, respektive Schreibens, nehmend.
kartesischen
Schritt/Schnitt – eine geradezu umgekehrte ‚kopernikanische Wende‘ ermöglicht,
genauer überhaupt einmal: Den (und gar die) Menschen – konsequenterweise
keineswegs ohne Todverfallenheit – in den sogenannten
‚Mittelpunkt‘ stellend bzw. als und zum
Ausgangspunkt des eigenen Seins,
oder zumindest Denkens, respektive Schreibens, nehmend.

Prompt gleich in zweifacher
Hinsicht, eine Art von Sakrileg, das offiziell eine, immerhin daher
ehrenhafte, Position auf dem Index verbotener Bücher der römisch-katholischen
Kirche einbrachte, der dem in politischen
Positionen eher um vernünftigen Ausgleich bemühte
Staatsmann und Autor, in Frankreich zumindest zeitlich näher stand, als dem
hugenottisch-protestantischen Lager.
In eher wissenschaftlicher Hinsicht, bzw. was den Einfluss auf die (frühe) Neuzeit angeht, gilt es heute/retrospektiv manchen Leuten als erklärungsbedürftig, dass bzw. warum ‚damals‘ die ‚objektivierte Sicherheit‘ (in/durch die absolutesten Prinzipien) versprechenden (reduktionistischen) Denkformen – M.E.d.M. wo nicht gar dem und en Menschen gegenüber (eher: ‚unfreundlich‘) – vorgezogen wurden / (zumindest ‚abendländisch bis heute wirksam) durchgesetzt/gewählt worden sind.

File:///D:\sphaeren-ghz\hz-üanor-balkon056.jpg anor-balkon056
[Zumal in enger Verbindung
mit Missverständnissen, wie ‚es gehe um ein/das Entweder-Oder zwischen
‚Innensicht/en‘ (etwa ‚gefühlt empfundene Größen) wie Temperatur oder gar
Zeit) und ‚Ausenansicht/en‘ (gegen imtersubjektiv
gemessene Werte)] 
Immerhin
‚sprachlich‘ für die und in der Grammatik ist die (gar axiomatische) Setzung des/der ‚ichs‘
geläufig. So gilt es etwa als weitaus
länger üblich zu bemerken/meinen: ‚Ich habe einen/meinen Körper‘, als etwa zu formulieren ‚Ich
bin mein/ein Gehirn‘. (Der mit dem / über den etc. der ‚Welt‘ von Ja und Nein, den [bzw. den
von mir] immerhin in Teilen erkennbaren, teils be-
und manchmal sogar ergreifbaren Objekten
zugerechnet wird / ein- bzw. Ausgesetzt ist/wurde).
Was auch immer letzterer also sonst werden und/oder im Einzelnen sein mag, unterscheiden wir ihm (unterscheidet er ‚sich‘ unseres Erachtens - insofern ‚passivischen Geschlechts‘) von jenem ‚ich(s)‘ die/der ‚ich bin‘, und das (sigularisiert, bis gar singular statt autistisch sein-werdend) auch/hier als ‚Selbst‘ im engeren Sinne betrachtet/bezeichnet werden mag.
Allerdings sind manche – etwa semitische oder gerne gleich als ‚gebrochen‘ empfundene, bis bezeichnete/diffamierte –Ausdrucksformen hier – jedenfalls für Tempusformen der Gegenwart/en – deutlich vorsichtig, bzw. zurückhaltender, im Gebrauch modaler Verben. Namentlich was ‘to be‘ angeht (und ggf. auch Denkformen des ‚Habens‘ differenzierend). Die Klassiker: AN(oCH)i SaRaH und AN(oCH)i ABRa(Ha)M gelten vielen (etwa indoeuropäisch akulturierten) Denkformen. als eine Art von ‚Verzicht‘ auf eine (den Gebrauch einer) Präsenzform von Sein (Und das Bemühen der Vier-Otijot unter/in denen zwei He interagieren ist, mit seinen Übersetzungsvarianten – in welcher argumentativen Absicht es auch geschehen mag – ja meist nicht sehr weit.)
Die so verstummend geäußerte Respektsbezeugung der Majestät verbaler Sprache selbst vor einen, gar vor Ihrem ganz persönlichen, Dasein, bis da-gewesen-werden-Sein, drückt auch den Vorbehalt der Möglichkeit Ihres/eines/des semiotisch qualifizierten ‚Selbers‘ aus, ohne dass es existenznotwendigerweise verbalisiert werden muss, bzw. dies höchstens teilweise kann. Gerade und ausgerechnet (die Gremzen dessen) was Namen sind, gehört zu den Nichtwissensprinzipien.

File:///D:\sphaeren-ghz\hz-üanor-balkon057.jpg
![]() Es
sind nicht zuletzt wirkmächtige Missverständnisse –zumal
sprachlicher Denkart – die das bzw. ausgerechnet Ihr/Euer Selbst in Verdacht, respektive Konflikt mit und zum Ganzen, bringen. Ausgerechnet in,
oder aber unmittelbar benachbart zu, jenen kulturellen Gegenden, die und wo
seit langem wirkmächtige, bis wichtige, ganzheitliche und holistische
Einsichten Raum und stattfinden, kennt die Sprache/Denkart keine
verabsolutierbare Vorstellungsform, keine Möglichkeit des reinen, alleinigen
Singulars. Manche Asiatinnen und Asiaten können ‚die indoeuropäische
Rechthaberei‘, dass jemand auf seiner einen, einzigen, optimalen, guten pp.
oder wie auch immer seienden, Meinung beharrt, weder
fassen noch nachvollziehen, da in diesen semiotischen
Horizonten ‚Meinung‘ zugleich bzw. immer auch /gar nur) plural ‚Meinungen‘ sind/übersetzt werden.
Es
sind nicht zuletzt wirkmächtige Missverständnisse –zumal
sprachlicher Denkart – die das bzw. ausgerechnet Ihr/Euer Selbst in Verdacht, respektive Konflikt mit und zum Ganzen, bringen. Ausgerechnet in,
oder aber unmittelbar benachbart zu, jenen kulturellen Gegenden, die und wo
seit langem wirkmächtige, bis wichtige, ganzheitliche und holistische
Einsichten Raum und stattfinden, kennt die Sprache/Denkart keine
verabsolutierbare Vorstellungsform, keine Möglichkeit des reinen, alleinigen
Singulars. Manche Asiatinnen und Asiaten können ‚die indoeuropäische
Rechthaberei‘, dass jemand auf seiner einen, einzigen, optimalen, guten pp.
oder wie auch immer seienden, Meinung beharrt, weder
fassen noch nachvollziehen, da in diesen semiotischen
Horizonten ‚Meinung‘ zugleich bzw. immer auch /gar nur) plural ‚Meinungen‘ sind/übersetzt werden.
Mit
ganz erheblichen Folgen auch und gerade für Ganzes, dass weder ‚das Ganze‘
denk-/fassbar ist, noch nur eine singuläre Ganzheit gedacht werden kann. –
Nicht erst, oder allein, manch ‚monotheistischer‘-Anspruch
scheitert daran notwendigerweise – auch
und gerade jene/r von tramspersonaler oder überindividueller, gar objektiver Singularität, tun dies zumindest da,
wo, und solange, ihr/deren Ganzes nicht grenzenlos,
bis überall .... gar
‚offen‘ ... ![]() [noch unbekanntes
Modalverb.]. Jenes sogenannte ‚Ganze‘,
[noch unbekanntes
Modalverb.]. Jenes sogenannte ‚Ganze‘,  das vom menschlichen
Verstand, bis Verhalten
– obwohl bis weil diese selbst dazu gehören mögen, zumindest aber
wechselwirkend damit verbunden sind und\aber werden – in
Teilen gehandhabt, respektive stückweise verstanden, wird, oder immerhin werden
müsse. Wogegen die. gar gerne wohlfaile. Behauptung – namentlich (selbst)
‚holistisch‘ an's Ganze zu denken nzw. Alle und Alles zu berücksichtigen/beteiligen, oder etwa völlig auf sich
selbst zu verzichten – nicht hinzureichen vermag, allenfalls im Gegenteil.
das vom menschlichen
Verstand, bis Verhalten
– obwohl bis weil diese selbst dazu gehören mögen, zumindest aber
wechselwirkend damit verbunden sind und\aber werden – in
Teilen gehandhabt, respektive stückweise verstanden, wird, oder immerhin werden
müsse. Wogegen die. gar gerne wohlfaile. Behauptung – namentlich (selbst)
‚holistisch‘ an's Ganze zu denken nzw. Alle und Alles zu berücksichtigen/beteiligen, oder etwa völlig auf sich
selbst zu verzichten – nicht hinzureichen vermag, allenfalls im Gegenteil. ![]()
Richard
David Precht stellt mit seinem Buchtitel ausdrücklich die, gar spannende Frage:
‚Wer bin ich und wenn ja wie viele‘ 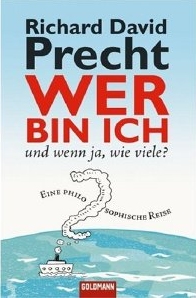
 [Ungefähr ‚östliche‘
und Zugangswand des Markgrafenzimmers; einer- und weiterseits ‚genau‘
westliche des Kaiserbaus]
[Ungefähr ‚östliche‘
und Zugangswand des Markgrafenzimmers; einer- und weiterseits ‚genau‘
westliche des Kaiserbaus]  Beabsichtigen Hoheit ernstlich
Gelegenheiten füt
Tat(ursach)en
zu halten? Eine in Innenwänden des Markgrafenzimmers, gemeinsam
mit dem Schlafgemach des Königs, verborgene
hyperreale/ auch‘
Beabsichtigen Hoheit ernstlich
Gelegenheiten füt
Tat(ursach)en
zu halten? Eine in Innenwänden des Markgrafenzimmers, gemeinsam
mit dem Schlafgemach des Königs, verborgene
hyperreale/ auch‘ ![]() –Stiege verbindet, zumal mit dem Rot(en Salon)
–Stiege verbindet, zumal mit dem Rot(en Salon)  Menschen ‚bewusst‘, möglicher Fehlerfahndung:
Menschen ‚bewusst‘, möglicher Fehlerfahndung: 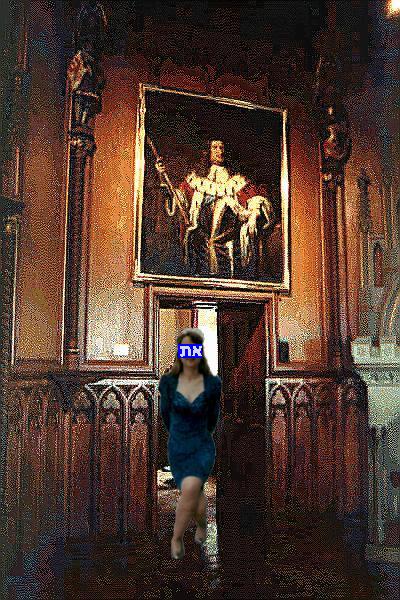 [Ein/Das – gleich gar andersgeschlechtliche/weibliche, doch ebenbürtige – Gegenüber כנגדו aus/durch den – inzwischen zivilisatorisch vielleicht sogar ‚intim(er)en‘ – eben herrschaftlichen Schlafbereich]
[Ein/Das – gleich gar andersgeschlechtliche/weibliche, doch ebenbürtige – Gegenüber כנגדו aus/durch den – inzwischen zivilisatorisch vielleicht sogar ‚intim(er)en‘ – eben herrschaftlichen Schlafbereich]
#jojo-askese-libertinismus-HOSEN
Zwar durchaus ‚leider‘ (da summenverteilend
‚Richtigeres
mehren[
sollend/wollen]d‘ – einigen sich Ex-Nonnen
und Ex-Nutten streitbar vielleicht immerhin, in Sachen Rocklänge – auf
Damenhosen-Pflichten, oder seien nur pure Leggins zu exhibitionistisch-!/?),
dennnoch bleiben Askese undוו/äh\זזversus Libertinismus – gegeneinander,
miteinander und je einzeln allenig maximiert/überbietend/vergottet – ups verwerflich( peinliche – ein älteres/anderes ‚Wort‘
für/von Streng)e Ethisierungen
/ ‚Moral(itäten[ersatz-,
nein -hyperrealisierungsembleme])‘:
Zwar gibt es/existiert ‚zu wenig‘ (von so einigem
Tauglichkeiten / einigen Tauglichen bis Talenten,
viel vielen, sofern nicht allen,
Menschen Wichtigem etc.), ![]()
![]()
![]() manche behaupten/überzegen-sich
zudem (falls nicht sogar ‚allein ursächlich‘) sei/werde
Vorhandenes schlecht/ungerecht verteilt: Manche Gemeinwesen deffinierten, bis handhaben, immerhin Grenzen
eines
Existenzminnimums;
manche behaupten/überzegen-sich
zudem (falls nicht sogar ‚allein ursächlich‘) sei/werde
Vorhandenes schlecht/ungerecht verteilt: Manche Gemeinwesen deffinierten, bis handhaben, immerhin Grenzen
eines
Existenzminnimums;
doch (gegenpolig/provokannt) haben nicht erst ‚Luxusgesetze‘, äh
Grenznutzenkurven und Sättigungen ‚gezeicgt/verhindert‘, dass auch ‚noch so
viel (gerade Wesentliches) zu
haben‘ nicht dagegen hilft / davor
schützt ‚zuviel zu brauchen / fürchten / nutzen
/ riskieren / verachten / wollen‘.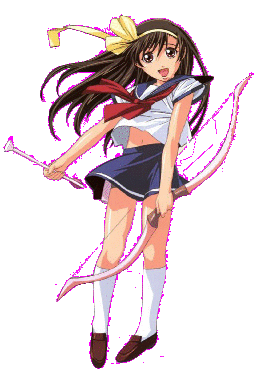 Denkempfindfungsaffekte hier ‚Almosen bis Umverteilung‘ versus
‚Pflichten bis Vorlosten‘ und Redeweisen / Reflexe charaterisieren bis machen
durchaus Unterschiede. [Aber: Mehr Einhaltung/Observanz des richten Maßes müsse/werde doch möglich/zu-verlangen sein-!Imperative:
‚Ich war jung und brauchte das Geld‘]
Denkempfindfungsaffekte hier ‚Almosen bis Umverteilung‘ versus
‚Pflichten bis Vorlosten‘ und Redeweisen / Reflexe charaterisieren bis machen
durchaus Unterschiede. [Aber: Mehr Einhaltung/Observanz des richten Maßes müsse/werde doch möglich/zu-verlangen sein-!Imperative:
‚Ich war jung und brauchte das Geld‘] 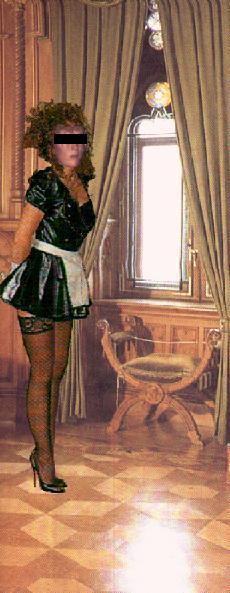 Gerade falls, und eben wo, ich(/Du – wie ‚indirekt‘ bis
‚restriktiv‘ auch immer) ‚dazu
gezwungen
sein/werden‘ sollte/st, müssen müsste/st, möchte/st, kann/st pp. ‚es bin(/bist)‘, lasse ich (! somit eben, gar intersubjektiv
wechselseitig, äh zumal widerstrebend) Unabwendliches
zu. [Dass, und wie, ‚die dewote Rolle‘ stärker
als dominannte – zählt zu den besonders verborgenen …:
Gerade falls, und eben wo, ich(/Du – wie ‚indirekt‘ bis
‚restriktiv‘ auch immer) ‚dazu
gezwungen
sein/werden‘ sollte/st, müssen müsste/st, möchte/st, kann/st pp. ‚es bin(/bist)‘, lasse ich (! somit eben, gar intersubjektiv
wechselseitig, äh zumal widerstrebend) Unabwendliches
zu. [Dass, und wie, ‚die dewote Rolle‘ stärker
als dominannte – zählt zu den besonders verborgenen …: ![]() Der zudem längst nicht nur/allein
hypersexualisierte, empörende/empörte (in
alphabtischer Willkür gelistet/verdreht) Libertinismus, kommt – so manche Leute (beiderlei
Fraktionszugehörigkeiten) überraschenderweisen
– nie ohne dementsprechend
kontrastiert, komplementär heftig empörende/\empörte asketische Gegenforderungen / Verhaltensweisen daher
/ (namentlich
‚materieller/stofflicher‘ Realitätenverachtung – mindesten der Erlebniswelten
/ abgelegen, öh abweichenden Wirklichkeiten[motive]
anderer Leute) zustande]
Der zudem längst nicht nur/allein
hypersexualisierte, empörende/empörte (in
alphabtischer Willkür gelistet/verdreht) Libertinismus, kommt – so manche Leute (beiderlei
Fraktionszugehörigkeiten) überraschenderweisen
– nie ohne dementsprechend
kontrastiert, komplementär heftig empörende/\empörte asketische Gegenforderungen / Verhaltensweisen daher
/ (namentlich
‚materieller/stofflicher‘ Realitätenverachtung – mindesten der Erlebniswelten
/ abgelegen, öh abweichenden Wirklichkeiten[motive]
anderer Leute) zustande]  [Gerne
‚anderseits‘-genannt, zugleich exakter nordöstliche
Innenwand des Markgrafenzimmers, und eben mit / der Bibliothek ‚ihre/r‘ südwestliche/n, inklusive ר־ו־ח Zwischenwarteräumchen: Überm/Vom/Zum ups-Durchgang des und
mit dem Erfahrungenflügel/s, woher/wohin auch ‚offiziell/e
Audienzgeladene (zumal – brav[ ‚mutig/mündig‘ und oder\aber ‚gehorchend
bis
folgsam‘, multilingual knicksend]e, bis gar artig, schwarz-weiße
– Dialektik)‘ eingelassen
und entlassen] Hinterhältig an/in Askese,
dass/wie auch ‚ihre‘ rücksichtsvollste Sparsamkeit, grenzenloser Verschwendung annalog ähnlich, Materieverachtung / Saluteverzicht!
[Gerne
‚anderseits‘-genannt, zugleich exakter nordöstliche
Innenwand des Markgrafenzimmers, und eben mit / der Bibliothek ‚ihre/r‘ südwestliche/n, inklusive ר־ו־ח Zwischenwarteräumchen: Überm/Vom/Zum ups-Durchgang des und
mit dem Erfahrungenflügel/s, woher/wohin auch ‚offiziell/e
Audienzgeladene (zumal – brav[ ‚mutig/mündig‘ und oder\aber ‚gehorchend
bis
folgsam‘, multilingual knicksend]e, bis gar artig, schwarz-weiße
– Dialektik)‘ eingelassen
und entlassen] Hinterhältig an/in Askese,
dass/wie auch ‚ihre‘ rücksichtsvollste Sparsamkeit, grenzenloser Verschwendung annalog ähnlich, Materieverachtung / Saluteverzicht!  -‚Schwarz‘ und/\auf Rückseiten
‚weiß‘- verbindet/\trennt# beide Nichtfarben, äh solch( und ähnlich grau)er Dienstbekleidungselemente, all(
d)es
Dialektischen
-‚Schwarz‘ und/\auf Rückseiten
‚weiß‘- verbindet/\trennt# beide Nichtfarben, äh solch( und ähnlich grau)er Dienstbekleidungselemente, all(
d)es
Dialektischen ![]() gerade hier
gerade hier ![]() eben Grenzen (zumal aufhebend/gestaltend, staatt
eben Grenzen (zumal aufhebend/gestaltend, staatt auflösend/vernichtend) ziehend komplimentär komplett erst gegenüber Farbigem, immerhin ‚blau‘.  [Der/Des Menschenverachtungen unterscheiden sich nämlich –
gar entgegen so mancher Behauptungen/Rede bis
Überzeigtheiten/Überwältigtheit – nicht notwendigerweise
zwischen/nach Totalitätsgraden,
oder Formen der/von Herrschaftsdurchsetzung] Noch so eiserne feste Willen verblassen weiter gegenüber/hinter/unter/vor beiderlei Glaubensüberzeugtheriten.
[Der/Des Menschenverachtungen unterscheiden sich nämlich –
gar entgegen so mancher Behauptungen/Rede bis
Überzeigtheiten/Überwältigtheit – nicht notwendigerweise
zwischen/nach Totalitätsgraden,
oder Formen der/von Herrschaftsdurchsetzung] Noch so eiserne feste Willen verblassen weiter gegenüber/hinter/unter/vor beiderlei Glaubensüberzeugtheriten.
[Bibliotheksseitig
offene דלד Südtüre, mit deckenorientiertem
Einblick ins Entscheidungseck des/vor dem Einlass/es Richtung Markgrafenzimmer/Königssalon, eben der (zumal Ihrer/Eurer) Bewusstheit/en]
Bewusstsein/-werden ersetzen/erzwingen
kein (abwendbares) Handeln und würden/könnten ja nicht einmal absichtsloses Verhalten
rechtfertigen.  [Wenigstens (nicht) mit
hochgewehtem Rock im Windhauch ertappt] #jojo
[Wenigstens (nicht) mit
hochgewehtem Rock im Windhauch ertappt] #jojo
Ups-oh Peinlichkeitserschrecken der Selbsterkenntnisse-Blösen, bis qualifizierter Demut
Aha-‚Freuden/-Furchten‘, was ‚im Moment‘ / ‚lange zuvor‘ – ups, vor
Eintritt in / Verlassen von (selbst Eurer Gnadens) höchst eigenr/en Bewusstheit/en – doch/noch so
alles ...  … Sie wissen bestimmt schon / erinnern s/mich
noch – auch die gesamte Literatur bleibt
voller Beispiele/Mühen.
… Sie wissen bestimmt schon / erinnern s/mich
noch – auch die gesamte Literatur bleibt
voller Beispiele/Mühen.  Können & Dürfen Menschen, wider
ihr besseres ‚Wissen / Gewissen‘, Forderungen des Gemeinwesens / Gesetzes einhalten, ohne dieses/dessen Ergebnis – zumal durch ihre gegenteiligen Überzeugthheiten
/ ‚Empfindungen‘, authentischen bis trügerischen ‚Motive‘ pp. – ethisch zu entwerten-!/?/-/. Gänige Antwort-Erfahrungen reichen
bekanntlich Normen-hierachisierend von ‚häufig‘ bis ‚nie‘. [Drausen in /rewach/ ‚Zwischen-Raum‘ mit /ruach/ ‚‘Bewegung‘: ‚Wieviel
/resch-waw-chet/ (davon/wo)von /chet oder:
ched/ חית׀חיד wie/wodurch/wer zu ertragen‘-Fragen bleiben
allerdings auch/gerade drinnen: רוח] Vokalisierung(sbedürftig).
Können & Dürfen Menschen, wider
ihr besseres ‚Wissen / Gewissen‘, Forderungen des Gemeinwesens / Gesetzes einhalten, ohne dieses/dessen Ergebnis – zumal durch ihre gegenteiligen Überzeugthheiten
/ ‚Empfindungen‘, authentischen bis trügerischen ‚Motive‘ pp. – ethisch zu entwerten-!/?/-/. Gänige Antwort-Erfahrungen reichen
bekanntlich Normen-hierachisierend von ‚häufig‘ bis ‚nie‘. [Drausen in /rewach/ ‚Zwischen-Raum‘ mit /ruach/ ‚‘Bewegung‘: ‚Wieviel
/resch-waw-chet/ (davon/wo)von /chet oder:
ched/ חית׀חיד wie/wodurch/wer zu ertragen‘-Fragen bleiben
allerdings auch/gerade drinnen: רוח] Vokalisierung(sbedürftig).
Das zwar holzverkleidete doch
mit blau-golden abgehängtem
Deckenhimmel-Firmament versehene (‚Werde / Soll / Kann / Will / Darf
/ Bin / pp.-ich‘)-Kabuff ist, im hohenzollerischen Hochschloss,
bekanntlich auch mit nehrfarbigen
Gemälden / Erzählungen versehen.
Hier geht es, äh steht ‚ups‘, zudem, nicht nur abkürzend für einen, wie auch immer, ‚vereinigten
Paketdienst / Parteikonsens‘, sondern diese verbale Peinlichkeitsbemerkungs- respektive Fluchtimpulsbetonungs- oder Ersatzhandlungsäußerung hat/soll gezielte (doch nicht
etwa/etwas irgendwie ‚entschuldigende‘) Verwendung bei, bis gegen, etabliert( mit-, vor-
und nachgemurmelt)en, (gemeinschaftlich, bis durchaus
gemeinwesentlich, synchronisieren
s/wollenden) für ‚selbstverständlich zutreffend‘ gehaltenen,
entscheidend-wichtigen – zumal irrigen, bis falschen Erkenntnisse-leitende/paradigmatischen realitätenhandhaberischen
– Auffassungen / theologisch-philosophischen
(zumal ‚alltäglichen-alltags‘-)Denkformen / (Bildungs-)Reflexen
verunsichern/betonen/alarmieren,
die wir/ich hier (zumindest
manchmal, ohne deswegen/dazu
notwendigerweise alles angeblich, oder tatsächlich, damit-Beabsichtigte zu
verwerfen/verachten – doch, zumal kynisch/gar
‚bissig‘) kritisiere/n.
 [Ups-Durchgangswarteraum, gesichtetes Gemälde-Detail, zwischen Erfahrungenflügel
und Selbstfragenturm, zu Bewusstheit/en, auf der bell Ètage]
[Ups-Durchgangswarteraum, gesichtetes Gemälde-Detail, zwischen Erfahrungenflügel
und Selbstfragenturm, zu Bewusstheit/en, auf der bell Ètage]
 [Das ‚andere‘/weitere innere Gemälde – etwa ‚ambivalenter
Dialektik(frage)‘, was beispielhaft bemerkt: dass/wie immerhin (und quellenmäßig
kaum strittig) der
Apostel Paulus im Römerbrief festhält, ‚der Tod sei die Folge der Zielverfehlung/Hamartia‘ (bestenfalls unzureichend eher als ‚Sünde‘ bekannt/verborgen); während er zeitnah, doch eher emphatisch, im ersten
Korintherbrief schreibt: dass/wie Sterblichkeit/der Tod zu Zielverfehlung/en anreizt/verleitet‘ – ist
im Hochschloss eher an einer Wand mit dem/des Erfahrungenflügel/s zu bemerken]
[Das ‚andere‘/weitere innere Gemälde – etwa ‚ambivalenter
Dialektik(frage)‘, was beispielhaft bemerkt: dass/wie immerhin (und quellenmäßig
kaum strittig) der
Apostel Paulus im Römerbrief festhält, ‚der Tod sei die Folge der Zielverfehlung/Hamartia‘ (bestenfalls unzureichend eher als ‚Sünde‘ bekannt/verborgen); während er zeitnah, doch eher emphatisch, im ersten
Korintherbrief schreibt: dass/wie Sterblichkeit/der Tod zu Zielverfehlung/en anreizt/verleitet‘ – ist
im Hochschloss eher an einer Wand mit dem/des Erfahrungenflügel/s zu bemerken]
#jojo
[Gar intim überwacht, jedenfalls im kleinen Audienzwarte- bis ups-Durchgangskabuff
entdecken/betrifft manche gar den/der
‚Bodenfliesenspiegel‘ – in welchen jeweiligen Wortwahlensinnen auch immer dies hier gedeutet, statt deutungsfrei]  Spätestens ‚es lieben
zu müssen‘ eröffnet Möglichkeiten ‚es zu hassen‘.
Spätestens ‚es lieben
zu müssen‘ eröffnet Möglichkeiten ‚es zu hassen‘.
Was
allerdings/nämlich, undװaber
zu wenig (skeptisch) ‚in/an Bewusstheiten ‘ befindlich erscheint: Die (nachstehend etwa neun, zumal dualistischen bis dialektischen) Kennzeichen und Inhalte,
auch als ‚gnostisch‘ zu bezeichenden Denkens bis Fühlens
und Reagierens, mit i/Ihren, häufig konsequenten – doch eher selten als solche/s (gar selber bis in/von/an Fanatismen) bemerkten, Folgen. 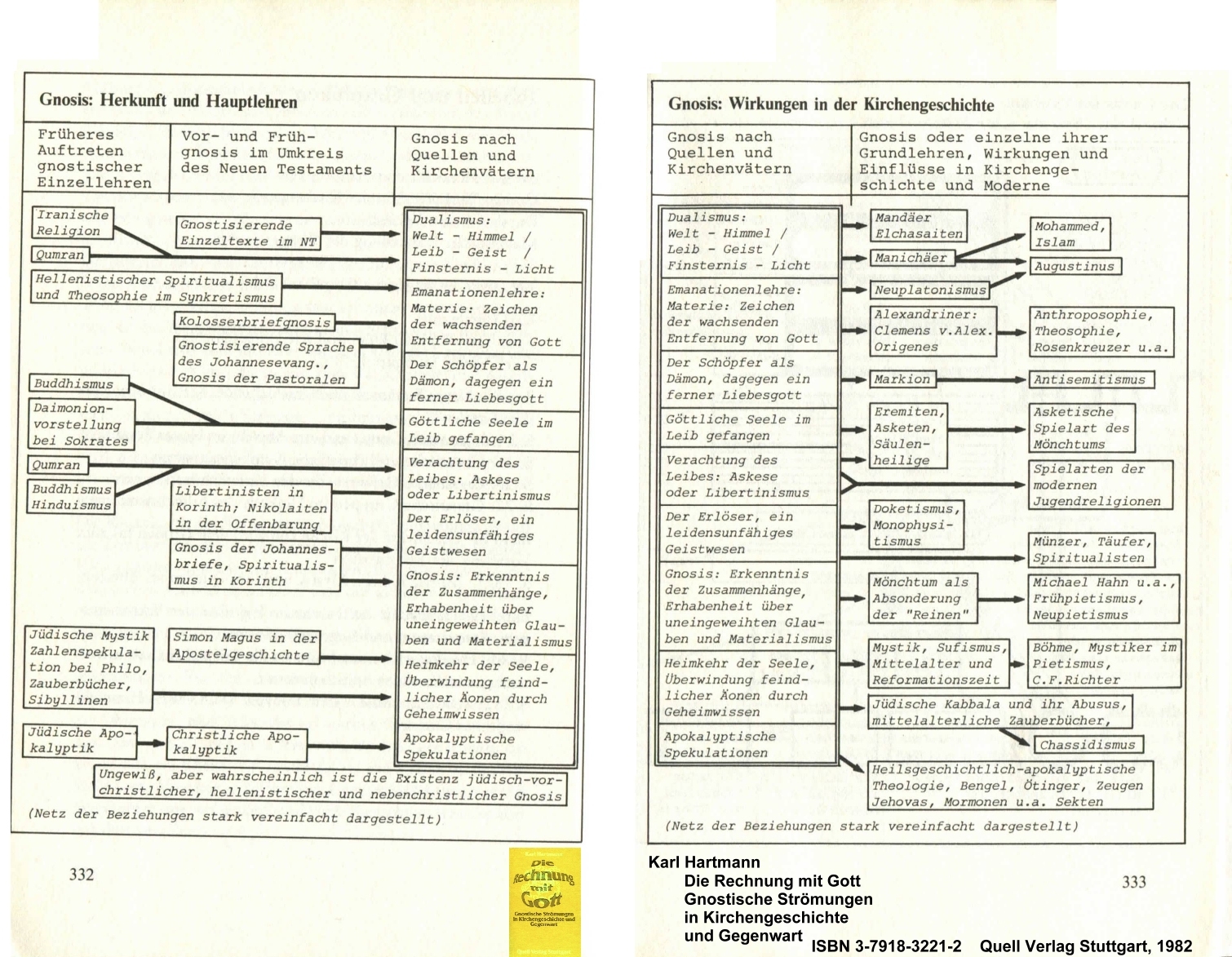
Wer maximal
kontrastklare Entweder-schwarz-Oder-weiß Entscheidungen sucht/braucht, äh was/wozu trennscharf ‚einfach‘ Reduziertes entweder richtig
wahr oder ‚rein‘ (oder schlimmstenfalls/sogar ‚teils‘) falsche Unwahrheiten/Lüge – außer zu Herrschaftsausübung über
Menschen – meint,
bis nützt / leisten
sollte und kann:
|
|
|
|
|
|
|
Ein ‚dämonischer Schöüfergott‘ wirkt als Trenner
/ Entferener des auch/noch gegenwärtig Vorfindlichen
von pantheistischer ganz nur bei sich Selbigkeit / Identität (des ‚Geistes‘ respektive der ‚Materie‘)!
|
|
göttlicher
Seelenfunkensplitterreste, und/oder ‚Geist bis (bis gar ‚individueller‘ / autistischer) Odem‘, in körperlicher und
sozial(
kollrltiviert)er Leiblichkeit / Fleichlichkeit / ‚im gefallen /
getrennt / eigenen Seelischen‘‚auf Erden‘ gefangen gehalten: also:
|
|
|
|
###rinrückungsende###
Zwar und immerhin gönne ich Ihnen (seines-/Euresgleichen) / Anderen
(ungleichen bis gleicheren) ein (gar) schön(er)es Leben חיים. -Doch- (deutlich
/ noch) bin
ich nicht
bereit meine( Da)s(ein) zu
vernichten/beenden, damit Sie/äh andere mehr/überhaupt verbleibende Möglichkeiten (Erde, Luft, Materuie-Geist,
Nahrung, Trink-Wasser, Wäene
– zu
verteilen/verbrauchen-) haben.
– Darauf mein eigenes Leben (innerraumzeitlich / ‚Unter der Sonne‘) durch (zumal Gene-/Gedanken- oder
immerhin Stiftungs-)‚Nachkommen‘ zu verlängern (gar anstatt ‚zu vertiefen‘
pp,) schon eher; manchmal auch willens und fähig ‚Bäume zu
pflanken/zivilisieren‘ (gar nicht so selten, dass die zumal optimale Lösung/Antwort
von gestern bis heute, das Problem spätestens von übermorgen); -wesentlich bin/werde ich immerhin/allerdings- zu vertragstreuen (sogar asymmetrischen / ungerechtem bis falschem) Optionenverzichten bereit,
die/soweit sie ‚gemeinsam‘ (mich/uns überzeugend,
bis künftig) nehr/andere Möglichkeiten ergeben, als ‚wir‘/alle ohne Cooeration/en hätten.
Und/Aber
die Fragen (im engeren verhaltensfaktisch unausweichöichen,
anstatt stets unmerklichen, Sinne) ob, wie, was davon Sie,
Euer Gnaden, nicht nur ‚anders sehen/sagen/wollen‘, sondern auch gegenteilig
machen, ups
dürfen (anstatt nur ohnehon können) oder eben gerade besser nicht tun sollten-!/? halte/n ich, bis wir, für geradezu entscheidend: Zumal das (wie, welche) Zusammenlebensangelegenheiten angeht.
Zwar viele, bis total alle (etwa auch ‚Privatsphären‘
zugehörende nicht als rechtsfrei missbrauchend), Lebensbereiche getreffen könnend /
beeinflussen dürfend – doch sowohl in Entscheidungsfindungen als auch was
deren durchsetzung/en angeht antitotalitär – mag E.A.S. akzeptable
Verfahrensweisem genannt/aufgezeigt haben.
An /
Übesr der – zwar zu gerne,
aber doch nur, bis metakognitiv irreführend, sogenannten – ‚Kopfkino-Sofabank der Phantasien‘ zumal der/aller
Leute / Milleus (recht individuell, teils unterschiedlich bis bereichsweise deckungsgleich): Inner(lich)er Geheimnisverrat der / an Vorstellungen: es existierten
nur solche/diese Illusionen / Repräsentationen – nichts / keinerlei Repräsentiertes (und dieses gleich
gar verortet ‚in Gehirn‘
/ Materie ‚davon umgewandelt‘). Menschen können (meistens, bis [nicht einmal] immer [allen alles ‚bemerklich‘] – so ‚schmal‘ der ups ‚Freiheiten‘- äh ‚Fehler‘-Korridor
droben auch scheinen/sein mag) ‚weitaus mehr‘ / (optional) ‚durchaus anders‘ als
sie/wir tun & lassen wollen und/oder (warum / wozu auch immer) sollen. Metakognition ist spätestens wenn die
Verfahrensweisen zum Gegenstand des Gesprächzs bis der Debatte werden –
bekannt/blockierbar. Anträge zur Geschäfstordnung/Befangegenheitsbesorgnissen
bekannt, wenn Entscheidungen vorsitzender Personen / Beschlüsse von
Ältestenräten geändert oder genutzt werden wollen. Verfassungen / Burgfrieden
sind zum(al viele elenebtar betreffend, letztlich gewaltsamnktioniert
verbindlich) geregelten Nebeneinanderä bund Zusammenleben, bis
Zusammenarbeiten (sowohl in Personalfragen als auch in Sachangelegenheiten),
von Menschen (und Kindern) gemacht, die (‚bei aller Feindschaft/Liebe‘‘
zumindest: auch/manchmal/meistens – obwohl [gar schrift- äh vorlagenlesend und debattierend, mit Dentpausen
anstatt Überredungen/ Die auch historisch weit, bis vor die Enstehung der heutigen
gar Kampf-Begrifflichkeiten zurückreichende, ja
durchgänige „jumanistische Revolte“ richtet sich dabei, bis zudem, stets
gegen Herrschaftsausübungen des und/oder der über den und\aber die Menschen –
allenfalls ‚im Namen von‘ Gotheit/en, resepeive Prinzipien und Zwecken, eben
zumindest namens von (immerhin ups individuellen, subjektiven)
Notwendigkeiten / ‚Richtigkeit‘, (stets mit überindividuellem
Wahrheitsanspruch gemeinwesentlich, bis intersubjektiver Gültigkeitsabsicht
auftretenden) Vernunften respektive Imperative/Eändern alles Möglichkeitenraumes
überhaup, erfolfende Weisungen. – im, gar Wesentlichsten, aufPhänomene der
eben ‚nicht-Alleinheit des jeweiligen Menschen‘ (nicht einmal erimitisch
lebender Asketen) zurück gehend, wie es im später
‚gesellschaftsvertraglich‘-betrachteten/bezeichneten Optionenpakekt
‚noachidischer Gebote‘, mindestens aber ‚nimrodischer‘ Herrschaftsbeziehunge
zu, Reagen kommt, das/s hinreichende Wohlverhalten desder einzelnen erbittet,
bis erhökt, den Schutz seitens des – zumal meist (etwa im ‚großen Jäher‘,
Zauberhelden pp.) personifuierten – Gemeinwesens.
Abb.
Szgzraton/Uniformitätsgemeinschaft [Gerade Vertragsrecht ist weder ‚rechtsfrei‘
noch beliebig/willkürlich] Doch kann
bis darf (und gar nicht so selten ‚muss‘ einem/manchen) ‚unöffentlich
verborgenes‘ (zumaö spzial-abweichendes) Verhalten/Handeln, etwa in der
eigenen bis erweiterten ‚Privatsphäre‘ genügen, oder aber unterbleiben
(längst nicht jede Phantasie/jeder Wunsch
kann und/aber gleich gar nicht je darf oder muss ausgelebt sein/werden). Abb.
Pluraitätengemeinwesen [Über Gemeinschaftliches
hinausgehende gemeinwesentliche ‚Öffentlichkeit/en‘
kennen durchaus Bewusstheitenartiges – sind gar (zumal/zumindest juristische)
Person doch gerade kein (einheitliches/‚einzeln einziges‘) Intersubjekt,
sondern sind/werden aus unterschiedlichen Subjekten/Personen figuriert]
|
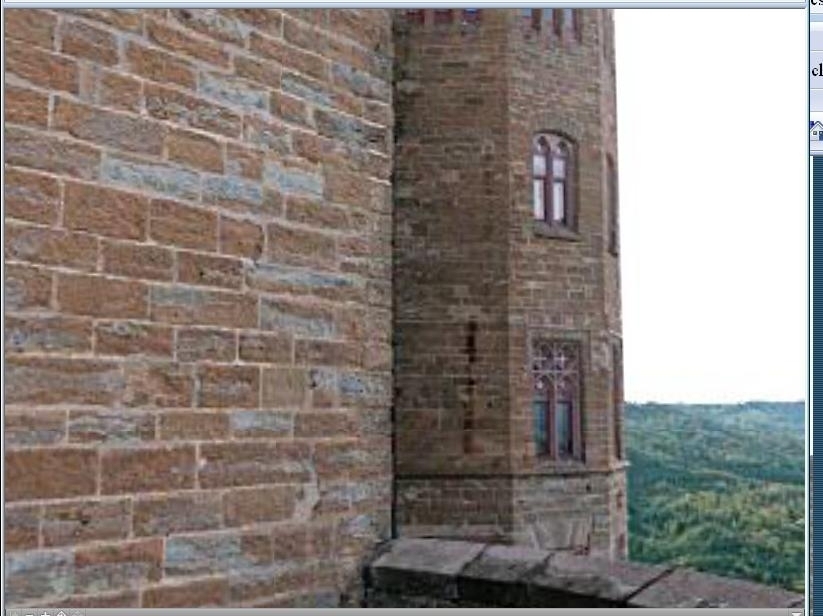 [Von auch schon als ‚Über-Ich/s‘, zumal
irrig (wider modale, bis existenzielle Aspektik) singularisiert
auch als – in aller
[Von auch schon als ‚Über-Ich/s‘, zumal
irrig (wider modale, bis existenzielle Aspektik) singularisiert
auch als – in aller ![]() -Regel: ‚schlechtes‘ äh ‚gutes‘ – ‚Gewissen‘ zu besetzen versuchte,
Bezeichneten verdrängt / überlagert / ersetzt: womöglich Magister/a interior]
-Regel: ‚schlechtes‘ äh ‚gutes‘ – ‚Gewissen‘ zu besetzen versuchte,
Bezeichneten verdrängt / überlagert / ersetzt: womöglich Magister/a interior]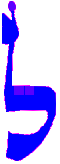 LaMeD
lernt
LaMeD
lernt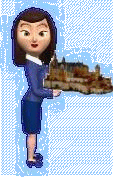 ‚zweites‘ Obergeschoss: [Roter Salon im
Markgrafentum – gar der Fehler- äh
Fürstenwohnung zugeschlagen]
‚zweites‘ Obergeschoss: [Roter Salon im
Markgrafentum – gar der Fehler- äh
Fürstenwohnung zugeschlagen] 
 «Der
gestirnte Himmel über mir, und das moralische
Gesetz in mir, …» so ungefähr formulierte,
bis meint, immerhin und bereits, betroffen beeindruckt
«Der
gestirnte Himmel über mir, und das moralische
Gesetz in mir, …» so ungefähr formulierte,
bis meint, immerhin und bereits, betroffen beeindruckt ![]() Immanuel
Kant; verlinkende Hervorhebungen O.G.J..
Immanuel
Kant; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.. 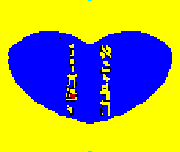
s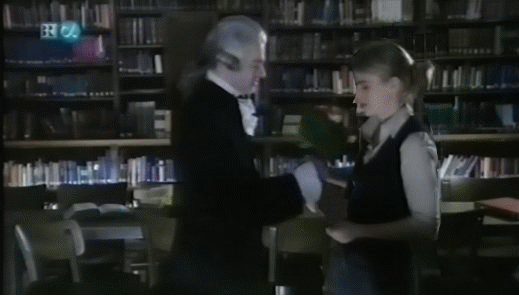 Wobei ja nicht nur der (ge)wichtige indoeuropäische
Singular, die übrigen Unterwerfungen / Ambivalenzen, gleich gar
nicht allein/reduktionistisch den ‚naturalistisch‘ gesternten Himmel, (gleich gar /haSCH-MeM-JuD-MeM/) eher ‚übersehen‘, oder gar
missachten, könnte.
Wobei ja nicht nur der (ge)wichtige indoeuropäische
Singular, die übrigen Unterwerfungen / Ambivalenzen, gleich gar
nicht allein/reduktionistisch den ‚naturalistisch‘ gesternten Himmel, (gleich gar /haSCH-MeM-JuD-MeM/) eher ‚übersehen‘, oder gar
missachten, könnte. 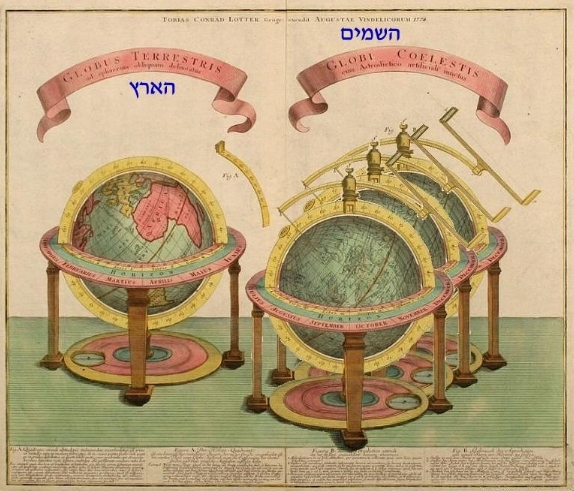
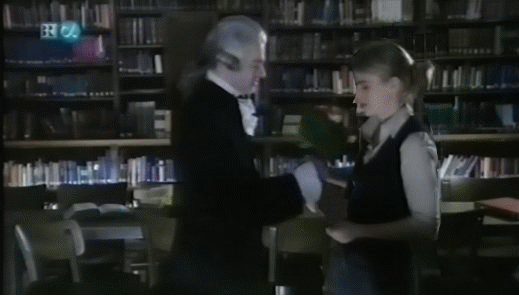 Sondern auch
die, ohnehin nicht mit Ethik identischen (immerhin bereits qualifiziert, anstatt willkürlich oder
beliebig, ‚jeweiligen‘), ‚Moralen/Gewissen‘ – ‚richtig‘, ‚falsch‘ und
Vorstellungshorizontreichweite-bezüglich ‚nicht entschieden/unentscheidbar‘
betreffend
Sondern auch
die, ohnehin nicht mit Ethik identischen (immerhin bereits qualifiziert, anstatt willkürlich oder
beliebig, ‚jeweiligen‘), ‚Moralen/Gewissen‘ – ‚richtig‘, ‚falsch‘ und
Vorstellungshorizontreichweite-bezüglich ‚nicht entschieden/unentscheidbar‘
betreffend ![]() – ihren ‚das geltende Gesetz/Recht (
– ihren ‚das geltende Gesetz/Recht (![]() /halacha/,
/halacha/, ![]() BGB,
BGB, ![]() Bill of Rights,
Bill of Rights, ![]() SGB,
SGB, ![]() StGB, Zehn Worte
pp.) überbietenden / lebenden‘-Anspruch, weder verbergen müss(t)en/können, noch (Ethiken)
die letzte, oberste
StGB, Zehn Worte
pp.) überbietenden / lebenden‘-Anspruch, weder verbergen müss(t)en/können, noch (Ethiken)
die letzte, oberste 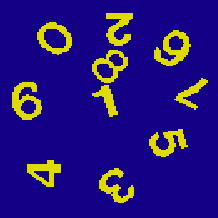 all unserer Modalitäten überhaupt sind/würden. –
all unserer Modalitäten überhaupt sind/würden. –  Während die ganzen Gesetzesbegrifflichkeiten(-Inflationen, un- bis )bekanntlich:
Weder
Während die ganzen Gesetzesbegrifflichkeiten(-Inflationen, un- bis )bekanntlich:
Weder  ‚die‘ ToRa(H – zumal narrativ deutendes Gespräch,
bis gar durchaus nornativ, eben kaum
weniger anwendungsbedürftig, geschriebener geradeToRaT, und\aber gerade darüber hinaus), noch
‚die‘ ToRa(H – zumal narrativ deutendes Gespräch,
bis gar durchaus nornativ, eben kaum
weniger anwendungsbedürftig, geschriebener geradeToRaT, und\aber gerade darüber hinaus), noch 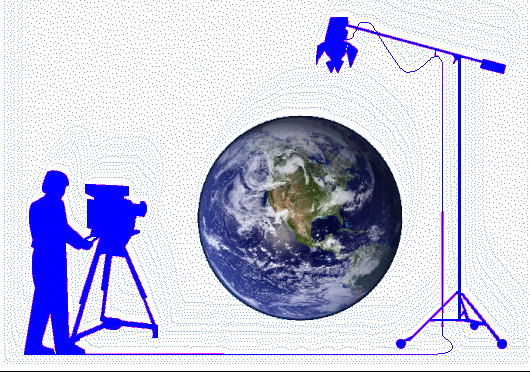 das Vorfindliche (gleich gar als Universum,
Natur-Wissenschaft,
Geist, Empirie,
Beobachtende) hinreichend/abdeckend repräsentieren.
Ein (bis der) geradezu
das Vorfindliche (gleich gar als Universum,
Natur-Wissenschaft,
Geist, Empirie,
Beobachtende) hinreichend/abdeckend repräsentieren.
Ein (bis der) geradezu ![]() ‚kartesischer‘
Tribut, auch noch des Aufklärers Kant, an die
neuzeitliche Entscheidung / abendländische Wendung: Sich <im Angesicht
der bestialischen Schrecken der, über ‚30-jährigen‘, europäischen Urkatastrophe
des, ‚Glaubens-‘ genannten, Überzeugtheiten-Spaltungskrieges (trotz/wegen Augsburg 1555 –
‚kartesischer‘
Tribut, auch noch des Aufklärers Kant, an die
neuzeitliche Entscheidung / abendländische Wendung: Sich <im Angesicht
der bestialischen Schrecken der, über ‚30-jährigen‘, europäischen Urkatastrophe
des, ‚Glaubens-‘ genannten, Überzeugtheiten-Spaltungskrieges (trotz/wegen Augsburg 1555 – ![]() britisch
eher ab 1642 bis 49, und kontinental immerhin bis 1648 blutrünstig)> endlich
vom subjektiven Selbst, bereits dem (ja auch noch individuellen
gar) eines M.E.d.M., zumal aber all der (im Namen, bis
Schutz, ihres jeweiligen Gottes[verständnisses] wider einander kämpfen s/wollenden, äh müssenden) soziokulturellen Figurationen, ab zu wenden; und
sich/alle – statt weiter brav den launisch
hoheitlichen und kulturell, bis religiös, so vielfältig relativen Bezogenheiten
–
britisch
eher ab 1642 bis 49, und kontinental immerhin bis 1648 blutrünstig)> endlich
vom subjektiven Selbst, bereits dem (ja auch noch individuellen
gar) eines M.E.d.M., zumal aber all der (im Namen, bis
Schutz, ihres jeweiligen Gottes[verständnisses] wider einander kämpfen s/wollenden, äh müssenden) soziokulturellen Figurationen, ab zu wenden; und
sich/alle – statt weiter brav den launisch
hoheitlichen und kulturell, bis religiös, so vielfältig relativen Bezogenheiten
–  der überindividuell synchron(isrbar), und zumal
interkulturell genau gleich / zwingend alternativlos gemeinsam, scheinenden (Hoffnung
auf’s / Sehnsüchte und Erwartungen vom für)
‚objektiv‘ vorfindlich gegeben(/findbar gehalten)en, allerhöchst absoluten, jedenfalls entpersönlicht, äh unpersönlich,
allen Lebewesen, bis allem, heteronom-vorgesetzten, Ordnungsprinzip – über, hinter (griechisch: meta, bis) als dem Ganzen –
hinzugebe n /anzupassen.
der überindividuell synchron(isrbar), und zumal
interkulturell genau gleich / zwingend alternativlos gemeinsam, scheinenden (Hoffnung
auf’s / Sehnsüchte und Erwartungen vom für)
‚objektiv‘ vorfindlich gegeben(/findbar gehalten)en, allerhöchst absoluten, jedenfalls entpersönlicht, äh unpersönlich,
allen Lebewesen, bis allem, heteronom-vorgesetzten, Ordnungsprinzip – über, hinter (griechisch: meta, bis) als dem Ganzen –
hinzugebe n /anzupassen.



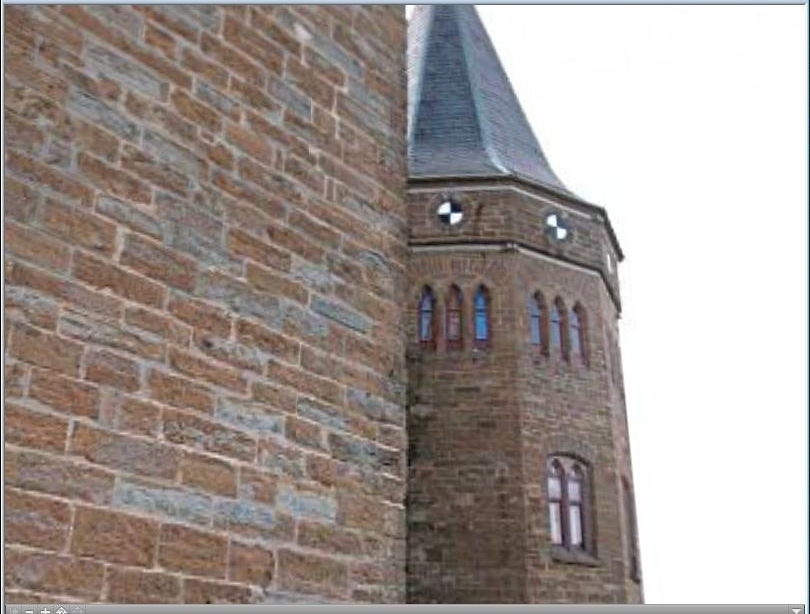 [Die
‚untere‘, hier sichtbare, dieser Türmlichkeit
oberen Fensterreihen betroffen/betreffend bleibt
Äußeres (zumal ‚Belehen‘ ja ohnehin
verdächtig nahe am ‚Missionieren‘ – undוו׀זז längst
nicht jedes ‚Lernen‘/La;eD/‚Lehren‘
verborgen)]
[Die
‚untere‘, hier sichtbare, dieser Türmlichkeit
oberen Fensterreihen betroffen/betreffend bleibt
Äußeres (zumal ‚Belehen‘ ja ohnehin
verdächtig nahe am ‚Missionieren‘ – undוו׀זז längst
nicht jedes ‚Lernen‘/La;eD/‚Lehren‘
verborgen)]  [Ups maskierter Eintritt ‚zur‘, oder sogar/eher ‚der,
Magistra interior‘ …]
[Ups maskierter Eintritt ‚zur‘, oder sogar/eher ‚der,
Magistra interior‘ …]  [… jedenfalls kaum eindeutigerer, ‚Knicks-Distanzen derselben / ‚inwendigen Lehrerin‘] Warum/Wogegen auch immer auf wirkmäcfhtigste/s ‚Neinm’s/lo/לא
verzichtender bis zurückgreifender Mündigkeitsausdruck?
[… jedenfalls kaum eindeutigerer, ‚Knicks-Distanzen derselben / ‚inwendigen Lehrerin‘] Warum/Wogegen auch immer auf wirkmäcfhtigste/s ‚Neinm’s/lo/לא
verzichtender bis zurückgreifender Mündigkeitsausdruck? 
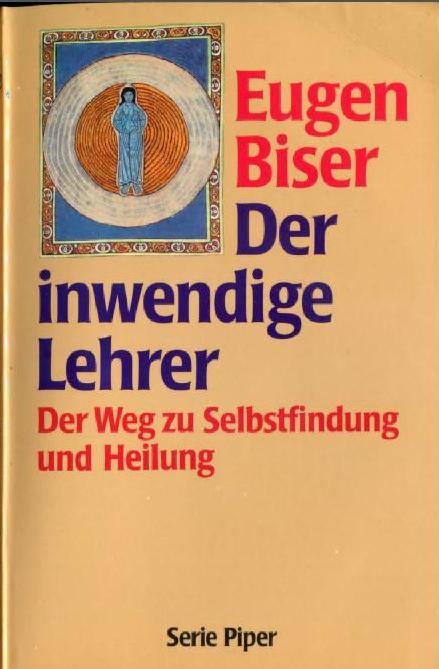 [Nochmal
מד
[Nochmal
מד![]() – mit Reverenz/en an Eugen Biser
– eines der bereits
recht alten Bücher – ausgerechnet und immerhin von #hier
– mit Reverenz/en an Eugen Biser
– eines der bereits
recht alten Bücher – ausgerechnet und immerhin von #hier![]() Augustinus,
zu bis wider sich selbst – in/aus/anstatt/mit ‚Augen seines früh-vollendet
verstorbenen‘ Sohnes Adeodat]
Augustinus,
zu bis wider sich selbst – in/aus/anstatt/mit ‚Augen seines früh-vollendet
verstorbenen‘ Sohnes Adeodat]
E.B. Gliederung / etwas
kommentierte ‚Leseprobe‘
Vorwort: Die Perle 9
(jene
‚des‘ Tauchers veröffentlichend/vorzeigen
s/wollend; vgl. der Absichtslosigkeit/en bedürftige; zumal nachstehend
entdeckt namentlich Jesajabuch 65:1 / Römerbrief
20:20)
I. Die Entdeckung 11 (bis immerhin
dreifach qualifizierte Aufhebungen; vgl. über F.W.H. hinaus)
Die Entgegnung (vom gar systematisch Gesuchten versus/zum
nicht einmal beiderseits gewollten Gefunden-werden; vgl. Jesaja wechselseitiger bis Picasso einseitiger scheinend)
- Die Überraschung (Erwartungshoritint/e übersteigend:
qualifizierte Aufklärung und Subjektivismus sind obzwar
biblischen Ursprungs; betreffend/betroffene Mündigkeitsäußerungen
werden jedoch
für rebelliosch gehalten) - Die Direktive (Zielkonflikt ‚überzeugter Menschenbilder‘ vertragstreuen Gefolgschaftsbedarf, Zusammengehörigkeitsgemeinsamkeiten und Entscheidungsverfahren reduktionistisch/symbolfetischistisch
contra Würde, Freiheit und Verantwortlichkeiten auszuspielen drohe/ermöglicht beiderseits nur Verlierer zurückzulassen: Lösungsweg qualifizierte Mystik;
Ka.Ra statt ‚gnostischen‘ Denk-Empfindens; vgl. Ka.Ha. gegen Fr.We.&Co.) – Die zweifache Diskrepanz („Während die Kirchenspitze [sic! doch längst nicht allein nur
diese, viel zu
ähnlich engagiert; O.G.J. zubdestens
politologisch / kausal(-determin)istisch auktorial geneigt] mit wachsendem Nachdruck auf ihrem
moralischen Führungsanspruch beharrt, erwartet das Kirchenvolk [sic!
zusätzlich/zunehmend erschüttert durch verbrecherisches Amtsträgererverhalten,
auch micht allein ‚geistlicher‘; O.G.J.] heißen Herzens Zuspruch und Hilfe [sic!] in seiner Sinnsuche
und Lebensangst. […] Noch
stärker kommt diese Diskrepanz in struktureller Hinsicht zum Vorschein. Hier
steht einer übergewichtigen Außenleitung eine nur defizitär entwickelte
Innenlenkung und Selbstbestimmung gegenüber. Es fehlt nicht nur jede
Einrichtung, die dem einzelnen Gelegenheit bietet, seine Anliegen, Zweifel,
Bedenken und Wünsche zu artikulieren; vielmehr herrscht zudem eine dialogfeindliche Stimmung,
die seine Äußerungen in das schiefe Licht der Unbotmäßigkeit und Aufsässigkeit
rückt. In dieses Mißverhältnis wird er zudem von außen her durch die
Dauererosion gezogen, die von der ständig eskalierenden Medienszene ausgeht
und, ohne daß er es bemerkt, seine Kompetenz und damit die Voraussetzung jeder
mündigen Stellungnahme untergräbt.“; S. 14 f. verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) - Der Ungeist (Kollektive Depression als typisch sozialpsychologische
Ge- bis Verstimmtheit, sich spätzzeitlich / endzeitlich / vorwendezeitlich
erlebender Gemeinwesen, diagnostiziert [wobei/‚wogegen‘ allerdings nicht mehr als 60% ‚positive
Äußerungen‘ realistisch; V.F.B.]:
„Noch immer suchte die emotionale
Verstimmung nach ideeller Bestätigung und
religiösem Ausdruck. Sie fand in der Spätantie [beides] in der akademischen Skepsis und dem
die Gemüter verdüsternden Schicksalsglauben. Innerkirchlich entsprechen dem
heute die Tendenzen, die auf eine Ideologisierung des Glaubens und auf seine
Verengung zu einer dogmatischen und moralischen Doktrin hinwirken. Dem leistet
das eingefleischte und sich zusehends verfestigende Mißverständnis Vorschub,
daß das Christentum dem Typus der nomothetischen [vgl. ‚Konsielswenden‘
Apostelgeschichte Kapitel 15, bis ob/was sich überhaupt, wie für welche
Gemeinwesen (‚konstantinisch‘) eignet] und asketischen[-versus-libertiunistischen; vgl. Ka.Ha.] Religionen
zugehöre.“ S. 15 verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
 Alternative Ernte-immerhin-Aussichten.
[„Perspektive
des zugleich sich wandelnden und
in seiner Identität erhaltenden Glaubens [sic!] einsichtig. Er betrifft ebenso die sich auf das Erfahrungsmoment
verlagernde Glaubenserwartung
wie die vom
traditionellen Instruktionsmodell abrückende Glaubensvermittlung
und nicht zuletzt das dem »dialogischen Prinzip«
[sic?/! japhetischem
Denken vielleicht genügend
universalistisch erscheiend, semitischen jedenfalls
kaum plural genug; O,G.J. mit E.B.&R.H,] verpflichtete neue
Glaubensverständnis.
Rückläufig aber bestätigt sich damit tatsächlich der von RAHNER angekündigte Wandel
in der Selbstdarstellung des Christentums. Präsentierte es sich bisher
vorwiegend als moralische Autorität, um nicht zu sagen als Sprachrohr des Weltgewissens,
so kündigt sich heute mit zunehmender Deutlichkeit der Eintritt in sein [/welches?
O.G.J. anti-gnostisch] mystisches Stadium an. Mit der Glaubenswende [sic!] zusammen bildet dieser Wandel die
beiden [sic!] Seiten
des epochalen Vorgangs, der ebenso wie der freiheitliche Aufbruch im
europäischen Osten noch immer der zulänglichen Deutung harrt.“ S. 14 verlinkende Hervorhebungen O.G.J.
Alternative Ernte-immerhin-Aussichten.
[„Perspektive
des zugleich sich wandelnden und
in seiner Identität erhaltenden Glaubens [sic!] einsichtig. Er betrifft ebenso die sich auf das Erfahrungsmoment
verlagernde Glaubenserwartung
wie die vom
traditionellen Instruktionsmodell abrückende Glaubensvermittlung
und nicht zuletzt das dem »dialogischen Prinzip«
[sic?/! japhetischem
Denken vielleicht genügend
universalistisch erscheiend, semitischen jedenfalls
kaum plural genug; O,G.J. mit E.B.&R.H,] verpflichtete neue
Glaubensverständnis.
Rückläufig aber bestätigt sich damit tatsächlich der von RAHNER angekündigte Wandel
in der Selbstdarstellung des Christentums. Präsentierte es sich bisher
vorwiegend als moralische Autorität, um nicht zu sagen als Sprachrohr des Weltgewissens,
so kündigt sich heute mit zunehmender Deutlichkeit der Eintritt in sein [/welches?
O.G.J. anti-gnostisch] mystisches Stadium an. Mit der Glaubenswende [sic!] zusammen bildet dieser Wandel die
beiden [sic!] Seiten
des epochalen Vorgangs, der ebenso wie der freiheitliche Aufbruch im
europäischen Osten noch immer der zulänglichen Deutung harrt.“ S. 14 verlinkende Hervorhebungen O.G.J.
„Denn seine [des Magister interior] »Belehrung« verfolgt stets die Tendenz, das ideologische Mißverständnis
des Glaubens [] zu verhindern
und ihn in der Freiheit einer dialogischen [sic! ‚zwiegesprächlichen‘; R.Ch.Sch.] Beziehung[sbeziehung; mit
Ge.Si.] zu erhalten. Wer
glaubt, unterwirft sich keinem Regelsystem und
keinem
ideologischen Zwang; vielmehr geht der Glaubende auf den Anruf ein, den der Offenbarer durch seine
Selbstmitteilung an ihn richtet und der, weil er von dem »Vater der Erbarmung
und Gott allen Trostes« (2Kor 1,3) ausgeht, das »Heil« des Menschen im
umfassenden
Sinn dieses Ausdrucks will.
Doch
damit kündet sich im Begriff des
inwendigen Lehrers eine von der Bezeichnung her nicht vermutete Vielfalt [sic!
falls/soweit nicht sogar indoeuropäisch stärker als ‚(leeres) Nichts‘
gefürchtete Vielfalten Vielzahlen; O.G.J. echad/achat-singularpluraler-אחד׀אחת bis sino-tibetisch (doch nicht allein
‚individueller‘) rechthabereienskeptisch]
an, der es genauer nachzugehen gilt. Es verhält sich tatsächlich wie
mit dem Schlußwort von GOETHES
Bildungsroman, das von dem Glücksfall [sic!/?
Herrschaftsverantwortungen/Wünsche und-waw
,wirkliches wir'; Bo.Gr.]
spricht, daß der Sucher [biblisch Saul] nach »seines Vaters Eselinnen« ein Königreich gewinnt oder besser noch
wie mit dem Fall des KOLUMBUS, der eine Passage suchte und einen Kontinent
entdeckte.“ S. 16 verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
Weiblichkeit/en semitisch nicht etwa ausschließen oder verbergen müssend/sollend.
 [Nicht einmal
deterministisch/fremdbestimmt losgewordene Wahlnotwendigkeiten]
[Nicht einmal
deterministisch/fremdbestimmt losgewordene Wahlnotwendigkeiten] 
II.
Der Fundort 17
Der Tagesanbruchs - Das »Buch
von uns« - Der Kerngedanke - Die Illumination - Die Überschreitung – Der Kontext - Das Schlußwort
III.
Der Kontinent 27
Das Reich in Person - Die Identifikation - Der
Vielgestaltige - Der Weisheitsbezug - Die Vergewisserung - Die Hauptaspekte -
Die Sprachformen - Die Erscheinungsformen
IV.
Die Herkunft 37
Mitwissende Freunde - Der Fürsprecher - Der
Christusgeist - Die Herrenworte - Der lebensgeschichtliche Anhalt - Der
Paradigmenwechsel - Die Hadespredigt - Das Profil
V.
Der Ursprung 48
Die elementare Geisterfahrung - Der
Präsentische - Die Anwesenheit - Der Fortlebende - Das Nachleben
VI.
Die Einwohnung 56
Die Hemmungen - Die Vermittlungsformen - Das
Weisheitsmodell - Die Rekapitulation - Die Inhabitation – Die Inversion - Die E
ntsprechung - Die Glaubenswende
VII.
Der Lesemeister 69
Die Erschließung - Die Verstehenshilfe - Der
Herzensbrief - Das Meergewächs - Die Spiegelung - Verstehst Du? - Vor euren
Ohren - Die Selbstübereignung - Die Umsetzung - Der Herzensbrund - Der
Durchbruch - Ich bin es - Wo ich bin - Der Engpaß - Der Vorzugsjünger - Der
Einwand – Die Wiederbelebung - Die Methodenfrage - Der akustische Zugang - Die
optische Lesart - Der haptische Zugriff (vgl. Drei
Wege ins Erinnerungsvermögen; Konfuzius) – Das Machtwort - Das Einvernehmen
VIII.
Der Lebemeister 111
Die Neulektüre - Der Kronzeuge - Der Bekenner –
Der Geschichtsgang - Die Lebensgeschichte - Die Gebetshilfe - Der Synergismus -
Die Identifikationshilfe - Die Gebetstat - Die Gelassenheit - Das Liebesgebot -
Die Seligpreisungen - Der Sozialbezug - Die Gewissensformen - Lehrer und Lehre
- Das Kommunikationsproblem
IX.
Der Therapeut 141
Die Existenznot - Formen der Heilung - Der
Abgrund der Angst - Haptische Heilserfahrung – Wege der Bildtherapie -
Bildhafte Entzaüberung - Arzt und Hirt - Bildhafte Anverwandlung - Der rettende
Ruf - Heraus- und Hervorgerufen - Die Einwilligung
X.
Die Gleichzeitigkeit 158
Gegensinnige Tendenzen - Zwiespältiges Dasein -
Die Phasenverschiebung - Die Überbrückung - Die Vergegenwärtigung - Die
Geistesgegenwart - Der Glaubensgrund – Der Ausgleich
XI.
Das Gleichgewicht 167
Epochale Fehlsteuerung - Das kirchliche
Ungleichgewicht - Die Ich-Schwäche - Die luzide Wahnidee - Die Entlastung - Der
Friedensgewinn - Der Wesensdialog (vgl.
Zwiegespräch; R,Ch.Sch.)
XII.
Die Erweckung 176
Der Geist der Schwere - Die Schlagseite - Die
Gegensteuerung - Die Ablösung - Die Austreibung - Die Erhebung - Die
Erleichterung (vgl. Wurf;
R,M.R.) - Die Verbundenheit - Die Retterhand - Die Windstille - Bewegung
und Ruhe
Nachwort:
Das Prisma 192
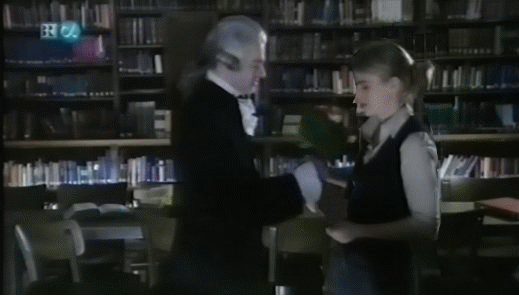 Na klar, lassen dennoch / dabei
notwendigerweise menschenseitige (#hier) ‚wie oben so (ähnlich) auch unten‘-Prinzipien
grüßen
Na klar, lassen dennoch / dabei
notwendigerweise menschenseitige (#hier) ‚wie oben so (ähnlich) auch unten‘-Prinzipien
grüßen  – sich, gar ‚der ‚Tabula smaragdina des Hermes Trismegistos‘-Fülle?, gleichwohl selbsterkennend transzendieren.
– sich, gar ‚der ‚Tabula smaragdina des Hermes Trismegistos‘-Fülle?, gleichwohl selbsterkennend transzendieren. 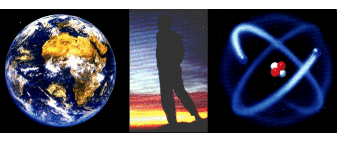 [An, bis über, den Grenzenränderen
begreifenden Verstehens und deutenden Erklärens …]
[An, bis über, den Grenzenränderen
begreifenden Verstehens und deutenden Erklärens …]
 Jener Turm/tower eben, aus
und über dem sich die, insbesondere
biographische, gar individuelle, ‚Lernkanzel‘, statt der (dann gar auch noch so
selten leere ‚Be-)Lehrkatheder‘,
erheben, jedenfalls kann und darf.
Jener Turm/tower eben, aus
und über dem sich die, insbesondere
biographische, gar individuelle, ‚Lernkanzel‘, statt der (dann gar auch noch so
selten leere ‚Be-)Lehrkatheder‘,
erheben, jedenfalls kann und darf.  – Eine der Schwierigkeiten scheint zumindest in oder mit dem /
dann zu bestehen, was / wenn Bewusstheit/en, eher
mit Selbst/en zu tun haben, als davon getrennt werden/sein
zu
müssen, oder zu können vermeint werden.
– Eine der Schwierigkeiten scheint zumindest in oder mit dem /
dann zu bestehen, was / wenn Bewusstheit/en, eher
mit Selbst/en zu tun haben, als davon getrennt werden/sein
zu
müssen, oder zu können vermeint werden.![]()
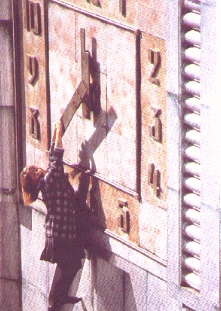
Möchte
oder werde י ich ר ‚Zeiten‘
erdenkend-erinnern,
die mir besser
\ schlechter gefallen als
gegenwärtige/s-? Antworten
(‚Eulysischer Felder‘ eher unzureichend=
An-,
Auf-, Aus-, Ein-, Gegen- und etwa Zuver-Sichten, äh Salons mögen
mehr /\ weniger …
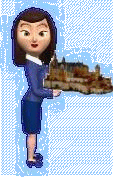 [Auch ‚der‘ Anschein, und Aussehen überhaupt, haben nämlich den wesentlich schlechteren(!) Ruf als
[Auch ‚der‘ Anschein, und Aussehen überhaupt, haben nämlich den wesentlich schlechteren(!) Ruf als ![]() bereits
der (blose) Scheins, זזundוו gleich gar Vorstellungserwartungen] Schwarz-(gar auf Rückseite/n)-weiße #Endweder--Oders# liegen (heraldisch / hohenzollerisch, bis sogar irrig) nahe? .
bereits
der (blose) Scheins, זזundוו gleich gar Vorstellungserwartungen] Schwarz-(gar auf Rückseite/n)-weiße #Endweder--Oders# liegen (heraldisch / hohenzollerisch, bis sogar irrig) nahe? .
Blaue Aussichtssalons, recht weit oben in diesem
Markgrafentum gar, so dass jemand / wer selbst-?, eher wiederum / auch
nicht, in des eigenen (na klar-? Hochschlosses) Burghof
ein- / hinein-zu sehen … (‚bereits‘ in Unterschieden zu /\ von Flaggen- und sogar Bischosturmfragen aus) 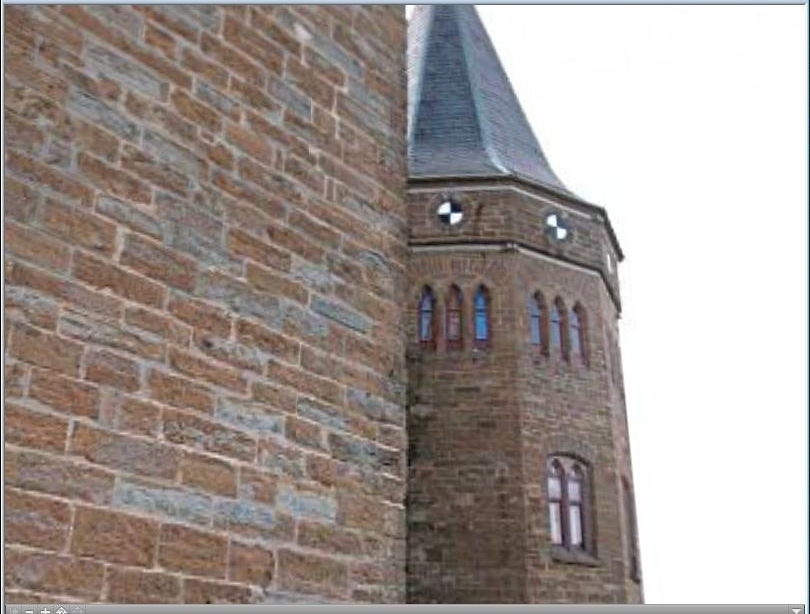 Gemeinsamkeiten mit / vom / zum Kaiserturm ligen fern gegenüber,
äh disbezüglich ‚innensichtlich‘
nahe. [Nahezu ganz (erscheinend) umlaufende (metakognitive – ausgerechnet den
eigenen ‚Schlosshof‘,
bis ‚Hinterhöfen‘, der
Burg ‚ausnehmende‘) drei-gliederige Fensterreihe, mindestens meherer Richtungen
Aussichten, dicht unterm Dachbereich des Markgrafenturmes]
Gemeinsamkeiten mit / vom / zum Kaiserturm ligen fern gegenüber,
äh disbezüglich ‚innensichtlich‘
nahe. [Nahezu ganz (erscheinend) umlaufende (metakognitive – ausgerechnet den
eigenen ‚Schlosshof‘,
bis ‚Hinterhöfen‘, der
Burg ‚ausnehmende‘) drei-gliederige Fensterreihe, mindestens meherer Richtungen
Aussichten, dicht unterm Dachbereich des Markgrafenturmes]
 Auch im
und nach Süden umlaufende Fenster außen/innen? [Gefragt ist/wird – ob aus / im / vom selben Salon, oder
mehreren (bereits an / der ‚Sprachen‘) Räumen ‚eingesehen‘ – mach
Auch im
und nach Süden umlaufende Fenster außen/innen? [Gefragt ist/wird – ob aus / im / vom selben Salon, oder
mehreren (bereits an / der ‚Sprachen‘) Räumen ‚eingesehen‘ – mach ![]() Anlässen,
Anlässen, ![]() Ballspiel bis R.M.R.-Dichtung,
Ballspiel bis R.M.R.-Dichtung, ![]() Erleben / Erwartungen,
Erleben / Erwartungen,
![]() Gelegenheiten,
Gelegenheiten,
![]() … ] Kommentar/e: Weder nur hilfreireich,
noch stets nachteilig, darüber oder gar davon
zu reden-!/?
… ] Kommentar/e: Weder nur hilfreireich,
noch stets nachteilig, darüber oder gar davon
zu reden-!/?  ‚Vor dem‘ und Blicke ‚in den als-Strukturen-Spiegel/-Filter‘ weiß gegen, und
bis versus schwarz Überschuss-Ernte-Bilanzen:
‚Vor dem‘ und Blicke ‚in den als-Strukturen-Spiegel/-Filter‘ weiß gegen, und
bis versus schwarz Überschuss-Ernte-Bilanzen:  [CHeT – doch
erscheint nicht einmal die Existenz (von Kindern /
Töchtern) notwendigerweisen nur negativ – חית] Think
/ Feel negativ versus positiv balances of evel and / or dood (in a word)
questioned?
[CHeT – doch
erscheint nicht einmal die Existenz (von Kindern /
Töchtern) notwendigerweisen nur negativ – חית] Think
/ Feel negativ versus positiv balances of evel and / or dood (in a word)
questioned?
#olaf ??? ![]() Deckungsungleichheiten
zwischen Denken und Fpühlen, Denken und Sprechen, respektive Fühlen und
Grammatik/en ‚einerseits‘ und/oder/aber Repräsentiertem und Repräsentationen
‚weitererseits: Aspekte werden ‚gewählt‘ / drücken ‚selektierend‘ aus –
unterlassen bis ‚unterdrücken‘, nein verwenden unerwähnte / unbemerkte
anderweitig,von denen ‚das Herz‘Ä, gar des Herzens Balaqvce gerade bis zumeit,
‚voll‘. Dies sich / Sie ändern zu sollen
Deckungsungleichheiten
zwischen Denken und Fpühlen, Denken und Sprechen, respektive Fühlen und
Grammatik/en ‚einerseits‘ und/oder/aber Repräsentiertem und Repräsentationen
‚weitererseits: Aspekte werden ‚gewählt‘ / drücken ‚selektierend‘ aus –
unterlassen bis ‚unterdrücken‘, nein verwenden unerwähnte / unbemerkte
anderweitig,von denen ‚das Herz‘Ä, gar des Herzens Balaqvce gerade bis zumeit,
‚voll‘. Dies sich / Sie ändern zu sollen
/wollen mag eine der Hauptfragen sein/werden – modifiziert aber gegebenfalls
nur diese Balance, äh diesbezüglich
für ‚Schieflage/n‘ Gehaltenes, ![]()
Askese ‚oder‘
(Quixsotic anstatt und)
Libertinismus;
Degenerationsfortschritte versus
Regenerationsfortschritte;
Fülle- gegen Zerfallserfahrungen;
Optimismus(küssen) gegen mismachende
Pesimismen;
Think positiv (versus negativ) balance
„Auf die Frage [sic!/? ‚Problemstellung der / des
Ergehen(müssen)s‘; O.G.J. gar (bedingt) mit Da.Ni. Handhabungsbedürfnisse
‚negativer Emotionen‘ anerkennend – bis durchaus ‚Mitfühlens‘-skeptisch] nach dem Befinden hin [sic?
gar eher ständig vereinfachend (interessiert, vernunftenbegrenzt wahrnehmend); O.G.J. mit Sir
Karl-Reimund Et al. Interessenleitung
kritisch ‚vergleichend‘]
gleicht das Gehirn [sic? oder wer auch immer sonst
denkempfindend entscheidet bis / oder (lieber / fügsam) geschehen läßt; O.G.J.
verdächtig(t)]
den [sic?
(bereits) deutend
dafür gehaltenen / so (M.E.d.M.
–vs. –
Ch.d.P.) erlebten; O.G.J. mit G.P. bis ups kognitions(spzial)psychologisch
Gartenbank-sensitiv – eben mit Da.Ni.] aktuellen mit [/
(kontrastierend) wider (wählend)] einem früheren [sic!/?
abgeleg/hnten /ups\ anderen / besseren / drohendem / erbetenen /
erdebklichen / erhofften / ersehnten / gefürchteten / idealen / ideologischen /
literarischen / perfekten / realen / richtigen / romantischen /
phantastischem / utopischen / verfehlten / verfolmten / verlangten /
versprochenen / verstandenen /
vertrauten / virtuellen / vollkommenen; O.G.J. gar als unnötig (Da.Ni-? Et al.)
versus ‚anzusutrebend‘ (G.P. Et.
al.) verdächtigten] Zustand
[sic!
allenfalls / allerdings ebenfalls ‚erdacht‘ jedoch durchaus ‚konsensfähig
gemeinsam‘ erlebten; O.G.J. ebenfalls mit dem Autor] ab und kommt zu einem negativen
Differenz-Betrag.“ (Da.Ni. S.10, 2016 kausalistisch ‚Beginn-/Wurzel‘-These/n des Jammerns / Stimmungstermometerbefunds;
Fetdruck und zumal verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.)
[Spiegelreverenzen zu / wider / von /
trotz / da / bei / als Anlasszofen, Herrinnen & Co.] _curtsying_maids-stooping_and_side_stepping_their_bobs-bows_in_Greenwich_Connecticut-Stock2008Aug29_(chatched_at_the_door)_spying_on_tenants-Getty82596661-ertappt.jpg) Manche,
dieser bis weitere, Leute gehen
davon aus, dass Soll-Ist-Vergleiche mögliche
oder nötige Voraussetzungen, um (unabwendlich – wenn
auch verschieden schnelles
versus zyklisches) ‚Fortschreiten‘ als Wandel zum Besseren ‚aufhalten /äh\
gestalten / nutzen / verrantworten / verweigern / verwenden‘ zu
können – nur bestimmen, ersetzen oder erzwingen tun ‚Un-Gleichungen‘ (Denken, Rechnen, Reden, Sinn[stiftungen] und
Wünschen / Wissen) eben
‚dies‘ keieneswegs.
Manche,
dieser bis weitere, Leute gehen
davon aus, dass Soll-Ist-Vergleiche mögliche
oder nötige Voraussetzungen, um (unabwendlich – wenn
auch verschieden schnelles
versus zyklisches) ‚Fortschreiten‘ als Wandel zum Besseren ‚aufhalten /äh\
gestalten / nutzen / verrantworten / verweigern / verwenden‘ zu
können – nur bestimmen, ersetzen oder erzwingen tun ‚Un-Gleichungen‘ (Denken, Rechnen, Reden, Sinn[stiftungen] und
Wünschen / Wissen) eben
‚dies‘ keieneswegs. _practices_her_curtsy_to_mirror_at_Boughton_Monchelsea_Place_ahead_Queen_Charlotte_Ball_Maidstone_England_GB-Getty845188322.jpg)
Vom Bischofsturm deutlich
/ ‚vorsichtig‘ ‚überstiegenes‘ umd vom Michaelsturm
‚ereichtes‘ Gegenüber / vis-a-vis des Kaiserturms, nahe beim Flaggenturm,
überm Kaiserbau und
weiteren Erfahrungsbereichen erkennbar.  [Auser Aspekten derselben
Festung bis Lamdschaft,
wie unten,
nur / aber anders, ‚zu sehen‘]
[Auser Aspekten derselben
Festung bis Lamdschaft,
wie unten,
nur / aber anders, ‚zu sehen‘] 
Dass (es), und gleich gar was alles,
die(se) Person für und wider ihr Aussehen tun
könnte / müsse (/ tat, äh versäumte – er)schlägt (allzumeit / beinahe) alles Übrige (Bemerken)
überhaupt-!/?
 [Ups –
‘wireless leash‘ (‚kabellose Leine‘) nennen manche
‘mobile phones‘, äh ständige
#hier
[Ups –
‘wireless leash‘ (‚kabellose Leine‘) nennen manche
‘mobile phones‘, äh ständige
#hier![]() ‚WhatsApp‘-Verfügbarkeit/en ‚per Handy‘, durchaus kritisch ‚Kondituionierungsverdächtig‘ – statt
etwa
‚WhatsApp‘-Verfügbarkeit/en ‚per Handy‘, durchaus kritisch ‚Kondituionierungsverdächtig‘ – statt
etwa abschaffen / verbieten s/wollend]
??Abbs.-NSAäjojo![]()
‚Erinnert Ihr Euch noch?‘ /zachor/-‚plaudern‘-זכור Anwesende ‘small‘: Wartezeiten nutzend waren ‚Marco‘ und ‚das andere Ende der Leine‘, abseits vom Spiel-Feld-Rand, hin und her gehend: Als ‚ein
schneller Ball herangeflogen‘ kam, änderten sechs weitere Füße kurzzeitig schnell ihre Richtung darauf zu; zwei Hände wurden
zu Fäusten, die das Leder zur ausdauernd hinterherrennenden Spielerin
zurückprallen ließen. Diese fing es geschickt auf, knickst ihr beeindrucktes:
‚Klasse, Danke!‘  UndווAber von der Zuschauertibübe, sowie sogar vom
Spielfeld, her brandete Beifall auf. – Denn ‚die
Sadtverwaltung wollte, oder konnte ‚sich noch kein Fangnetz für die
Anlage leisten.‘ [Mannschaften scheinen, im Gegensatz zur
westlichen Grammatik, statt exemplarisch manch (etwa allen, namentlich femininen) semitischen Wortverständnissen, das zu einfach / eifrig (empört / empörend) als
‚männlich‘-bezeichneten Plurals, weibliche Gegenüber-עזר
bis Mitspieler/innen … Sie / Euer Gnaden wussten
fürs / vom ‚Hebraicum / italiano‘] Wählen Sie Ihren Umgang sorgfältig-!/?/-/.
UndווAber von der Zuschauertibübe, sowie sogar vom
Spielfeld, her brandete Beifall auf. – Denn ‚die
Sadtverwaltung wollte, oder konnte ‚sich noch kein Fangnetz für die
Anlage leisten.‘ [Mannschaften scheinen, im Gegensatz zur
westlichen Grammatik, statt exemplarisch manch (etwa allen, namentlich femininen) semitischen Wortverständnissen, das zu einfach / eifrig (empört / empörend) als
‚männlich‘-bezeichneten Plurals, weibliche Gegenüber-עזר
bis Mitspieler/innen … Sie / Euer Gnaden wussten
fürs / vom ‚Hebraicum / italiano‘] Wählen Sie Ihren Umgang sorgfältig-!/?/-/.  [Kern-Hypothese: Emotionen brauchen / finden
Ausdruck bis Verwendung / ihrer Energie/n; mit G.P.]
[Kern-Hypothese: Emotionen brauchen / finden
Ausdruck bis Verwendung / ihrer Energie/n; mit G.P.] 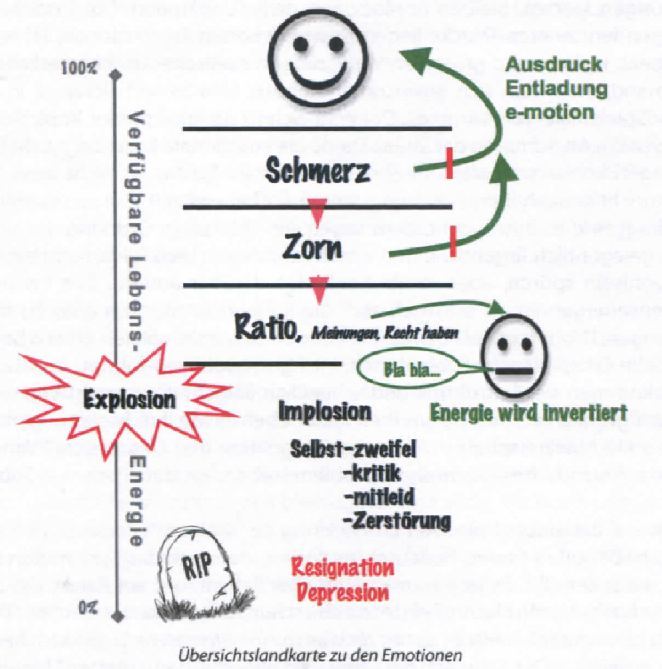
#Anlasszofen
 [‚Anima
und Animus‘ spätestens als Brautleute /
Dyade / Paarung: Aussichten auf zof(f)ende Freunde, Gespielinnen, Hofleute,
Knechte und Mägde habend]
[‚Anima
und Animus‘ spätestens als Brautleute /
Dyade / Paarung: Aussichten auf zof(f)ende Freunde, Gespielinnen, Hofleute,
Knechte und Mägde habend]  Zumal
dualistisch einfach / maximal auf falsch und richtig, gut oder böse kontrastklar
reduziert.
Zumal
dualistisch einfach / maximal auf falsch und richtig, gut oder böse kontrastklar
reduziert. 
Kommen wir Euder Gnaden bekannt oder
verfügbar vor?
 Bekanntlich beschuldigen oder verdächtigen manche ‚ihre‘ Anlasszofen Gelegenheitsfenst zu ersetzen / finden /
schaffen / sein-!/? [Anlässelich: Zumindest immerhin schwarze und weiße / silberne
Einsichtenfenster abruf-, äh denk- bis verfügbar – zofend / zoffend gefragt / empört / kontrastiert / startklar] Gelegenheitsfenster(lich) gehen auch/sogar
Unterlassensmöglichkeiten vorbei-ups?
Steigerungspotenziale kaum begrenzt-!/? [Auf,
da/ss JETZT (sofort) nichts als / anderes (mehr – hyperrealen Atemnotlagen
glichend
– wo ‚erlebnisweltenlich‘ / realita der Impulse und Reflexe Kontrollen am Wichtigsten) – unter Lebensgefahren, äh Lebensverwirkung verboten Fehler zu
begehen / haben / machen] Spätestens
‚Medinen‘ / Politiken teilen, zumindest Frauen, (vere)in(deutigend) zweierlei (falschen – äh gut gegen böse) Kategorien
zu!
Bekanntlich beschuldigen oder verdächtigen manche ‚ihre‘ Anlasszofen Gelegenheitsfenst zu ersetzen / finden /
schaffen / sein-!/? [Anlässelich: Zumindest immerhin schwarze und weiße / silberne
Einsichtenfenster abruf-, äh denk- bis verfügbar – zofend / zoffend gefragt / empört / kontrastiert / startklar] Gelegenheitsfenster(lich) gehen auch/sogar
Unterlassensmöglichkeiten vorbei-ups?
Steigerungspotenziale kaum begrenzt-!/? [Auf,
da/ss JETZT (sofort) nichts als / anderes (mehr – hyperrealen Atemnotlagen
glichend
– wo ‚erlebnisweltenlich‘ / realita der Impulse und Reflexe Kontrollen am Wichtigsten) – unter Lebensgefahren, äh Lebensverwirkung verboten Fehler zu
begehen / haben / machen] Spätestens
‚Medinen‘ / Politiken teilen, zumindest Frauen, (vere)in(deutigend) zweierlei (falschen – äh gut gegen böse) Kategorien
zu!  [Wird/Wurde Knicksen (oder bestimmte
‚Beinkleider‘-Sitten zu Beugen / ‚Konjugieren‘) durch / mit / vom / zum
Knien (oder gar,
bis eher, /Dogeza/ 土下座どげざ Fehlerhaftigkeiten) abgeschafft / (Perfektion
als / in / zu Nin-Ja-Krigerinnen) fatal und final fortgeschritten / zurückgekehrt] ‚Anlasszofen‘ sind und werden auch insofern ‚mehr als
Gelegenheitenfester‘ indem sie, sogar hyperreal( also
elementar / maximal wirksam)e suchen, fimdem und
erschaffen könnrn.
[Wird/Wurde Knicksen (oder bestimmte
‚Beinkleider‘-Sitten zu Beugen / ‚Konjugieren‘) durch / mit / vom / zum
Knien (oder gar,
bis eher, /Dogeza/ 土下座どげざ Fehlerhaftigkeiten) abgeschafft / (Perfektion
als / in / zu Nin-Ja-Krigerinnen) fatal und final fortgeschritten / zurückgekehrt] ‚Anlasszofen‘ sind und werden auch insofern ‚mehr als
Gelegenheitenfester‘ indem sie, sogar hyperreal( also
elementar / maximal wirksam)e suchen, fimdem und
erschaffen könnrn.
bb. yoster-lesen in Zeitung –
skandal-herzogin![]() [Ob, bis welche ‚es werde / müsse dennoch (alles)
irgendwie gut gehen / wertden‘-Zuversichten exkapistisch / nötig &
schädlich gefragt bis fragend (verbraucht/end)]
#hier-abb.-personal??-unten-oben-nicht-auch??-oder-linkziel-verbindung### ‚Was machen / widerfährt Milady da blos
nebenan?‘
[Ob, bis welche ‚es werde / müsse dennoch (alles)
irgendwie gut gehen / wertden‘-Zuversichten exkapistisch / nötig &
schädlich gefragt bis fragend (verbraucht/end)]
#hier-abb.-personal??-unten-oben-nicht-auch??-oder-linkziel-verbindung### ‚Was machen / widerfährt Milady da blos
nebenan?‘ _curtsying_maids-stooping_and_side_stepping_their_bobs-bows_in_Greenwich_Connecticut-Stock2008Aug29_(chatched_at_the_door)_spying_on_tenants-Getty82596661-ertappt.jpg)
Schlagzeile: „Anlasszofe hat Aufgabe gefunden“ (‚aktiv‘ und ‚passiv‘ gemeint
– zumal falls / wo ‚einseitig‘ verstanden).
‚Euch / Mich / Sich unmittelbar
und unreflektiert an / auf‘ (Ab-stand
bis Ab-wehr/en, äh von)
„[…] Pause […] am Ende“ wenn auch nicht vom
„einfach“-Wortfeldgebrauch(sbekenntnis) „Setzen Sie sich keine Ziele und stellen
Sie alle Schalter auf AUS. Keine Beobachtungen, keine Reflexionen, keine
Strategien und Erkenntnisse einfach [sic!]
Ruhe. Machen Sie einen Spaziergang“ abb.-seifernherstellin-ethikerin?=? „und
betrachten Sie die Welt [sic!] mit Kinderaugen. Alles ist interessant, alles
ist richtig. Essen Sie etwas Feines, trinken Sie etwas Schönes. Atmen Sie tief
durch.“.
 Am
Kaiserbau der Anderheitsmajestäten entlang und vorbei.
Am
Kaiserbau der Anderheitsmajestäten entlang und vorbei.  [Aussichten / Anblicke, bis
Markgrafenturm-Fenster, von / zur Gartenbastei]
[Aussichten / Anblicke, bis
Markgrafenturm-Fenster, von / zur Gartenbastei]  Seheb
ebttäuche ja nicht immer alle
Erwartenden.
Seheb
ebttäuche ja nicht immer alle
Erwartenden._Hohenzollern2020Video-Corona.jpg)
Affekte,
Ahas, Alarm, Allergene,
Altlasten, Anrufe, Artigkeiten, Atemnot, Aufgaben, Ausfälle, Bedrohung, Bedürfnisse, Begeisterung,
Behauptungen, Beleidigung, Berufung, Bewusstheiten, Bilder, חיים ,חית
, Chöre%n, דבךים (Dinge/Worte). Diskriminierung, Diskussion,
Dringlichkeiten / Druck, Eckel, Eifer / Eile, Einflüsse, Einsichten, Energie / Erregung, Entscheidungen,
Entsetzen, Enttäuschung/en, Erfahrung / Erinnerungen
/ Erleben, Fehlen / Fehler, Fernsehen,
Flows, Foderungen, Fragen, Freuden, Freunden, Fundamente, Furchten,
Geborgemheit, Gedanken, Gefahren, Gefühle, Gelegenheiten, Gelüste, Gemeinwesen,
Gemurmel, Gewissheit, Glaube, Glück, Gruende /
Grundlagen, Harmonien, Hass, Heurekas, Hoffnung, Hormone, Ideale /
Idee, Ignoranz/en, Impuls, Irrtpmer,
Jammer, Jubel, Klänge / Klingeln, Kontraste, Kraft, Können, Krämkungen, Krankheit, Lachen / Launen,
Lasten, Leiden(schaften) / Lieben, List, ‚live‘-Kommentare. …, Lüge/n, Lust,
Mängel, Maße / Masse, Menschen / Missen,
Misstände, Misstauen, Missverstehen, Müssen,
Nachrichten, Namen, ‚Nein’s, Niederlagen, Normen, Notlagen,
Offenbarung, Offensichtlichkeiten, Orientierungen, Pannen, Pausen, Pech,
Pflicht/en, Pläne, Plagen, Prinzen / Prinzipien, Qualen, Quellen, Rauch, Rache,
Rat, Rebellion, Reden, Reflexe, äh Reize, Rückzug,
Rufe, Scham / Schande, Scheitern, Schmerzen, Schrecken, Schuld/en,
Schweigen, Sexualität/en, Sichreheit,
Sichtweisen, sinn(lichkeit),Sterben, Stimmungen, Stress, Tatsachen, Texte, Tod, Töne, Tragödien, Unfug, Ungeheuer,
Unrechgt / Verbrechen, Verletzungen, Vitalfunktionen, Vorwürfe, Vorstellujngen,
VUKA, Wahren, Wahrheiten, Wahrnehmung, Wesentlichem, Wichtigem, Wirkstoffen,
Wohlbefinden, Wünsche, Wucht / Wut, X-Y-Variante, Zeichen, Zeit/en,
Zurückweisung und/oder Zwänge / Zwecke  Dass
‚Folter fubktioniert‘ braucht nicht betritten zu werden, um Optionen zu haben,
gar zu wählen, bis zu befragen / bemerken – eher in Gegenteilen. [Beliebig
widestehen zu können oder zu müssen, gehört gleichwohl zu den hinterhältigen
Irrttümmern (zumal über
/ gegen Kontemplation) /bis\
Diffamierungen (von ‚inneren Gartenbänken‘ / wider Übungsbedarf)] Keinerlei Exzes-Un-Gleicgewochtes,
nicht erst oder nur des
Gewungs-Seins/Werdens, ausgeschlossen.
Dass
‚Folter fubktioniert‘ braucht nicht betritten zu werden, um Optionen zu haben,
gar zu wählen, bis zu befragen / bemerken – eher in Gegenteilen. [Beliebig
widestehen zu können oder zu müssen, gehört gleichwohl zu den hinterhältigen
Irrttümmern (zumal über
/ gegen Kontemplation) /bis\
Diffamierungen (von ‚inneren Gartenbänken‘ / wider Übungsbedarf)] Keinerlei Exzes-Un-Gleicgewochtes,
nicht erst oder nur des
Gewungs-Seins/Werdens, ausgeschlossen. 
‚einzuulassen / hinzugeben / zu reagieren‘ steht hier durchaus
unter erhenlichem Veracht: ‚Fesselung / Gebundenheit /
Gefolgschaft / Ketten / Knien / Sklaverei (vUnterwerfung / erbrauchende Verzweckung für / in Mizarim)‘ zu sein!
 Aussichten zumal auf Befreiung nicht etwa ganz ausgeschlossen
– allerdings ohne ‚Wozus‘ ausschließen, bestimmen oder weglassen zu
… [‚Dame in Not‘-Embleme bis Qualen
aktivierbar] Gutes / Notwendiges / Ob sie /
Wer Strafe ‚verdiente‘, bis welche, bleriben andere Fragen. ??abb.s-yoster-johann-jagt/trägt-annabelle-zurstreckbaml??
Aussichten zumal auf Befreiung nicht etwa ganz ausgeschlossen
– allerdings ohne ‚Wozus‘ ausschließen, bestimmen oder weglassen zu
… [‚Dame in Not‘-Embleme bis Qualen
aktivierbar] Gutes / Notwendiges / Ob sie /
Wer Strafe ‚verdiente‘, bis welche, bleriben andere Fragen. ??abb.s-yoster-johann-jagt/trägt-annabelle-zurstreckbaml??
Da / Denn elementar (schwarz gegen weiß kontrastnaximiert /
Entweder-Oder reduziert konfrontierend / ‚motivierend/t‘
Allgemeinverbindlichkeit beanspruchend / ethisch-kategorischen
Imperativem/n) und somit ups politisch geht es um Chancen-Verteilungen bezüglich Lebens(bedingungen) und Tod(esarten).
Ob als Aus- oder doch eher Ansichten
befuerchten wir
durchaus, dass Optimismen,
gleich gar des Typs
‘think positiv [versus negativ]‘-Durchhaltens, -Bilanzierens bis -Aufbrauchens
allenfalls excapistisch-pausierend, bis gleich
‚quixotisch‘, neben
/ gegen /tikun/-qualifizierte-תקון Zuversicht/en gehen.
 Lady Annabelle Gruendeln ‚als / die / Eure‘
/ zur Anlasszofe gemachte / gewordene Personalisierungsallegorie
knicksend
Lady Annabelle Gruendeln ‚als / die / Eure‘
/ zur Anlasszofe gemachte / gewordene Personalisierungsallegorie
knicksend  [Respektive auch, bis eher, abstarhiert /
‚entpersonifiziert‘ Entscheidungsschmiede-Turm(fragen
hinreichend
– und das in dem Outfitt gebunden) vervollständigter
[Respektive auch, bis eher, abstarhiert /
‚entpersonifiziert‘ Entscheidungsschmiede-Turm(fragen
hinreichend
– und das in dem Outfitt gebunden) vervollständigter ![]() ‚hinaufgehobener‘ Aspektik]
‚hinaufgehobener‘ Aspektik]  Schmiedeturm mit / über Ausfalltor, am Fusse dieses Markgrafentums der Gremzenregime, draußen auf Festungsebene.
Schmiedeturm mit / über Ausfalltor, am Fusse dieses Markgrafentums der Gremzenregime, draußen auf Festungsebene. 
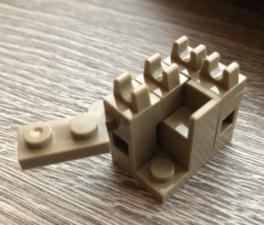 Draußen oder drunten bleibt
/ sei / verursacht Es nicht
Draußen oder drunten bleibt
/ sei / verursacht Es nicht

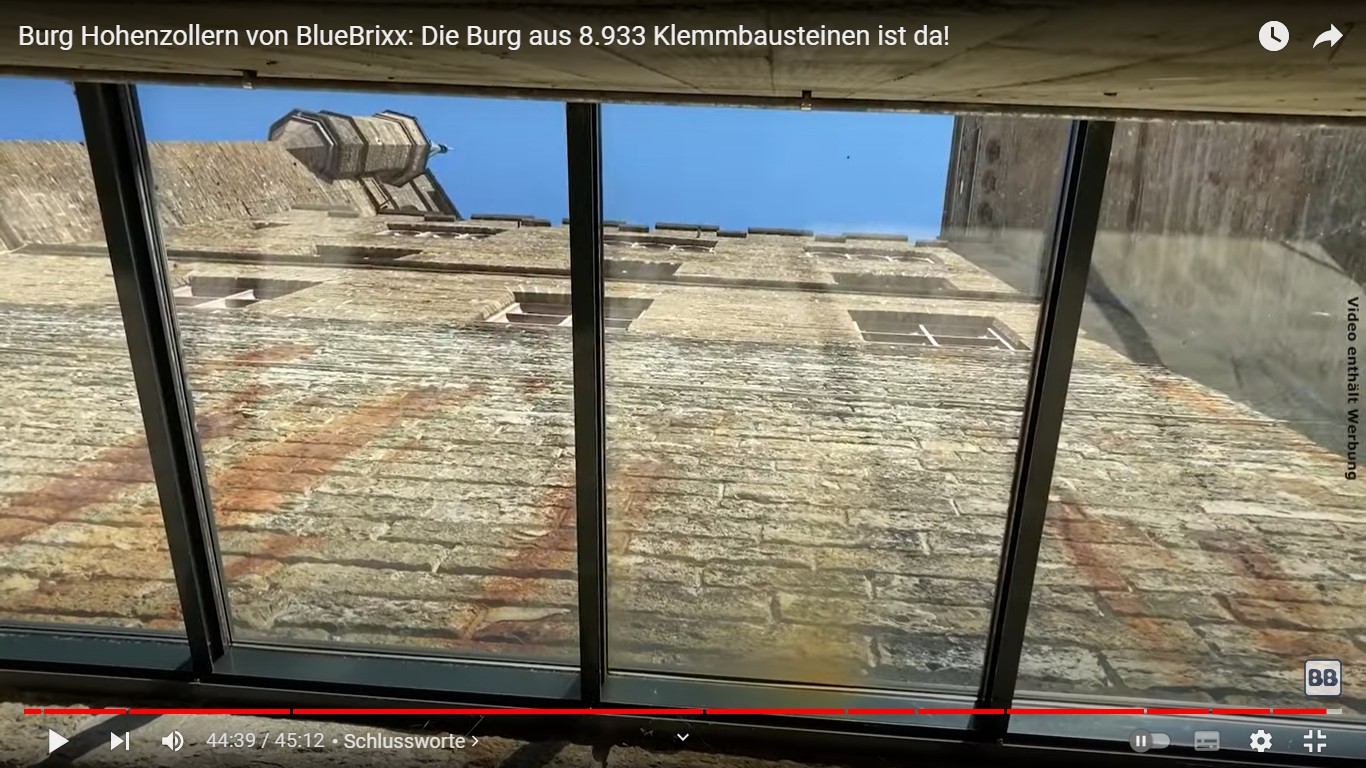


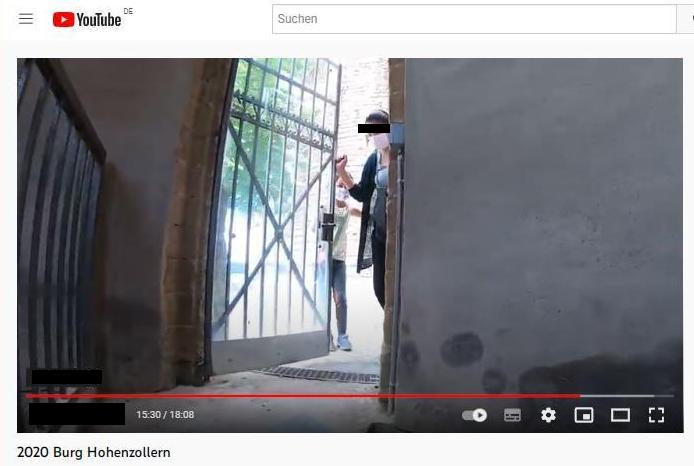


stets Etwas / Jemanden zum
Ablenken, Abmahnen, Ärgern, Aktuallisieren / Allarmieren, Androhen,
Antreiben, Antworten, Baden, Bedienen, Bedürtfen,
Belieben, Beten / Flehen, Betreffen,
Blamieren / Blosstellen, Bleiben, Blockieren / Bremsen, C-Dur-Mitsingen: Dafür (äh ‚D-Moll‘-gegen Altlasten, Bosheit,
Dämonie, Dietrologia, Dummheit, Fehler, Irrtum, Krankheit, Lernen, Reflexe,
Verabredungen, Vergessen, Wahn, Wollen pp.) Gehaltenes, Drängen, Ernten, Erotisieren, Erschöpfen, Erwarten
/ Verkangen, Erzählen / Erzürnen / Provozieren, Feiern, Fragen / Problematisieren, Freuen / Fühlen, Fürchten, Gieren / Eifern, Glauben, Hassen, Helfen, Hindern, Igmorieren, Jagen, Jammern, Kämpfen,
Klagen, Kritisieren / Loben, Leiden,
Lesen, Lückenmanagement / Organisieren / Überspringen, Maßregeln / Müssen, Nachtragen
/ Nehmen, Ordnen / Sicht- bis
Sortierwesen-Wählen, Plagen /
Quälen, Personalisieren / Personifizieren, Planen, Quellen, Raten, Rächen,
Retten, Richten, Ritualisieren, Schaden,
Schieben, Schimpfen, Schlafen, Schlpfen, Schreiben, Schreien, Schrecken,  666 (hier
weder Apokalypse/n,
oder Verabredungsdietrologia,
nnoch Weltuntergang
– sondenn
alternativlos restriktive Zwangsgewalten adressiert, zumal durch perfektionierte
[gar anstatt sozial persönlich/personifizierter – manche, bis viele, Lwute argwöhnen
/ bezweifeln / lehren / leugnen / stauen ja wer für Sicherheitsbehörden arbeitet]
Überwachtheiten)
666 (hier
weder Apokalypse/n,
oder Verabredungsdietrologia,
nnoch Weltuntergang
– sondenn
alternativlos restriktive Zwangsgewalten adressiert, zumal durch perfektionierte
[gar anstatt sozial persönlich/personifizierter – manche, bis viele, Lwute argwöhnen
/ bezweifeln / lehren / leugnen / stauen ja wer für Sicherheitsbehörden arbeitet]
Überwachtheiten)  Sollen, Sterben, Strrafen, Stressen, Stören, Tadeln, Tarnen,
Trüben, Trügen, Ueber…, Unglauben /
Unheil, Unterhalten, Unterlassen / Unterschlagen, Verbessern, Verfehlen, Verlieren, Versäumen, Versorgen /
Vorsorgern, Vertragen, Wandel,
Warnen, Widersperechenm, Widerstehen, Wollen, Wüten, XY, Zürnen, Zuversichtlichen, Zweifeln, Zwingen(sillisionen, äh
Virtualitas hyperrealen Ausdauersimuliersubsituten)
Sollen, Sterben, Strrafen, Stressen, Stören, Tadeln, Tarnen,
Trüben, Trügen, Ueber…, Unglauben /
Unheil, Unterhalten, Unterlassen / Unterschlagen, Verbessern, Verfehlen, Verlieren, Versäumen, Versorgen /
Vorsorgern, Vertragen, Wandel,
Warnen, Widersperechenm, Widerstehen, Wollen, Wüten, XY, Zürnen, Zuversichtlichen, Zweifeln, Zwingen(sillisionen, äh
Virtualitas hyperrealen Ausdauersimuliersubsituten)
wedenkend / findend / habend! – Allerfings/Eben fraglich bleibend:
ob, bis gar welch/wie, qualifizierte ‚Kontemplation / Weisheit‘
durch/gegen/in/wegen Gelegenheiten, bis Notlagen, (überhaup je) erzwingbar (oder etwa Nötigungen / Widerwillen / Zwänge … Sie ‚wissen‘
wohl schon [mehr als genug]): Alles was Menschen atmen, denken, essen, lehren/למד\lernen, trinken, tun & unterlassen oder
wollen ‚ist‘/wirkt potenziell lebensverkürtzend oder lebensverlängernd, (und)
kann/wird Sachaeden respektive
Schmerzen mehren oder mindern; eines/etwas/‚wen‘ davon heraus zu greifen/haben um/und
zu bekennen / erkennen / fühlen / glauben / lehren / sagen / überzeugen /
‚wissen‘ / wpollen: ‚das (etwa Allergen,
Gift pp. Verhalten) bringt mich/uns (alle Betroffenen) um‘ / ‚hat Schuld
bis ist ursächlich‘ – unterliegt gefählich/gefällig unseriösen (Neigungen / Reflexen / Varianten
an/bei/der/in/von/zu) Vereinfachungsnotwendigkeiten (zumal amdere/sich ‚gewohnheitlich‘, interessengemeinschaftlich, komplementär Übereinstimmendem
[Falschem ups / Gegebenem / Nötigem /
Richtigem / Wichtigem] anpassen / unterwerfen / vereinigen / verweigern ups zu müssen, bis zu s/wollen)!  Gsr eher ambivalente Erleichterungen durchaus
inklusive. [Ajutantin ‚Anima‘ (C.G.J.) / ISCHaH an/der/für/in/von Menschenheit, äh Dyade
/ Person – längst losgelaufen unterwegs]
Gsr eher ambivalente Erleichterungen durchaus
inklusive. [Ajutantin ‚Anima‘ (C.G.J.) / ISCHaH an/der/für/in/von Menschenheit, äh Dyade
/ Person – längst losgelaufen unterwegs]  Antiasketisch und antilibertinistisch …
[Hier Irtümmer (als/wie Leugnungen von Druck- bis Kraefteerfordernisen,
Ernähungswirkungen oder Gefahren[-, Krankheiten-, Mängel- und
Überflusshandhabungen]) herauszulesen / zu
verdächtigen, bis (Abwehr-, Bildungs-, Erziehungs- und Hilfs-)Reflexe / Schrecken zu erwarten, überrascht (manche/uns da) wenig] … Empörungen garantierend-!/?
Antiasketisch und antilibertinistisch …
[Hier Irtümmer (als/wie Leugnungen von Druck- bis Kraefteerfordernisen,
Ernähungswirkungen oder Gefahren[-, Krankheiten-, Mängel- und
Überflusshandhabungen]) herauszulesen / zu
verdächtigen, bis (Abwehr-, Bildungs-, Erziehungs- und Hilfs-)Reflexe / Schrecken zu erwarten, überrascht (manche/uns da) wenig] … Empörungen garantierend-!/?  [‚Atemnot‘, ‚Durst‘,
‚Friene‘ und ‚Hunger‘ vier basal personalisiert protitypische Anlaszofen
kellnernd / pausierend in alüabetischer Willkür gelistet]
[‚Atemnot‘, ‚Durst‘,
‚Friene‘ und ‚Hunger‘ vier basal personalisiert protitypische Anlaszofen
kellnernd / pausierend in alüabetischer Willkür gelistet]
Durch Arbeitsteilimng(en:
zeitlich unterbrechende, unter Personen auf- bis zuteilenden) / Sophrosyne erträglich erscheiendes Lückenmanagement /
werdende Unvollkommenheiten-!/?/-/.
 Dass/Wenn manche (wer) der (drei?) wichtigsten Etage(n) Status
(darunter) ‚umstreiten‘ erklären/verstehen wir ‚verschiedentlich‘!
[Gerade/Immerhin ‚Brautkleider‘ sind/waren eher selten/wenig farbig]
ABB.-Tanz-knicks-leherweiß-schwarz Hauptgeschoss: Königssalon / Markgrafenzimmer.
Dass/Wenn manche (wer) der (drei?) wichtigsten Etage(n) Status
(darunter) ‚umstreiten‘ erklären/verstehen wir ‚verschiedentlich‘!
[Gerade/Immerhin ‚Brautkleider‘ sind/waren eher selten/wenig farbig]
ABB.-Tanz-knicks-leherweiß-schwarz Hauptgeschoss: Königssalon / Markgrafenzimmer.
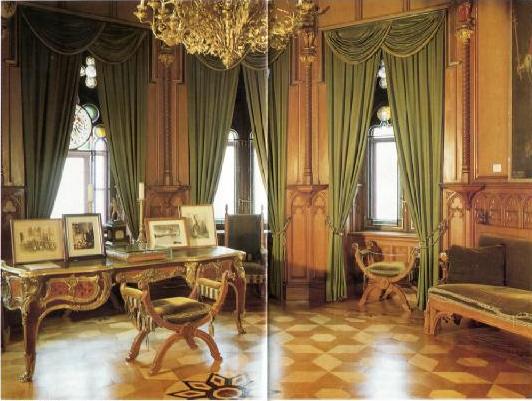 [Etwas Blaues, etwas
Verborgenes …] Ach-ja, Nein-aber die
andere, gar biographische sselbe Denk-Empfind- äh ‚dummheit‘
hetzte/laute/wolle; Spöange icht nich nicht slz/zu.alt … Euer Gnaden wissen
schon, dass/ob/Was Dazulernen bis Verstand-!/?
[Etwas Blaues, etwas
Verborgenes …] Ach-ja, Nein-aber die
andere, gar biographische sselbe Denk-Empfind- äh ‚dummheit‘
hetzte/laute/wolle; Spöange icht nich nicht slz/zu.alt … Euer Gnaden wissen
schon, dass/ob/Was Dazulernen bis Verstand-!/?  [Bewusstheiten und Fehler
befanden sich / finden wir zwar darunter …] Liegen
‚zu-können anstatt/oder/versus
zu-brauchen‘ hier ‚hinter/neben/unter‘ dem/Dir/Ihnen/mir/uns?
[Bewusstheiten und Fehler
befanden sich / finden wir zwar darunter …] Liegen
‚zu-können anstatt/oder/versus
zu-brauchen‘ hier ‚hinter/neben/unter‘ dem/Dir/Ihnen/mir/uns?  [Immerhin über ‚Dualismen‘
hinaussehen könnend & dürfend – Be- bis Gefragt] Dass/Ob Lehrnen/
ל־מ־ד \Lernen einander, miteinander. wem, wie und was angehe /
angeht beschäftigt Theorie / Sichtweisen / Literatur / Denken / Abstraktionen /
Autoritäten (derenseits zwar durchaus verhaltensfaktisch ‚tanzend‘ – doch von Euch/Ihnen/mir/uns).
[Immerhin über ‚Dualismen‘
hinaussehen könnend & dürfend – Be- bis Gefragt] Dass/Ob Lehrnen/
ל־מ־ד \Lernen einander, miteinander. wem, wie und was angehe /
angeht beschäftigt Theorie / Sichtweisen / Literatur / Denken / Abstraktionen /
Autoritäten (derenseits zwar durchaus verhaltensfaktisch ‚tanzend‘ – doch von Euch/Ihnen/mir/uns).  [Unterbleiben/Unterlassungen, nicht
allein/blos/nur/sigar von Neigungen oder Verbegungen, korrelieren mit so
einigem, bis Allem/mehr: ‚Dass
nicht-gelernt, nicht-könne, nicht-koherät / unlogisch / unrecht /
vernunftwidrig oder nicht-wisse (‚nicht-wolle[nd]‘ aus- oder eingeschlossen-?) – wer nicht-tut‘ – für Gerüchte / falsche Vorraussetzungen,
Absichten- bis Sinnesänderungen für möglich, und für ungleich ‚mit‘/von
Verhaltensänderungen, haltend] Aufklärungsmöglichkeiten, Erkenntnissewandel,
Forschungsfotschritte und Lernbedarf
hier(mit) keineswegs bestritten – allenfalls etwas (Validitäten
und Releabilitäten) widerlegbar / (menschenbezogen) relativiert / (Hyperrealitäten) entzaubert /
(Kritiken) enttabuisiert / (Gewissheiten/ Leute/Sozialgebilde) enttäuscht.
[Unterbleiben/Unterlassungen, nicht
allein/blos/nur/sigar von Neigungen oder Verbegungen, korrelieren mit so
einigem, bis Allem/mehr: ‚Dass
nicht-gelernt, nicht-könne, nicht-koherät / unlogisch / unrecht /
vernunftwidrig oder nicht-wisse (‚nicht-wolle[nd]‘ aus- oder eingeschlossen-?) – wer nicht-tut‘ – für Gerüchte / falsche Vorraussetzungen,
Absichten- bis Sinnesänderungen für möglich, und für ungleich ‚mit‘/von
Verhaltensänderungen, haltend] Aufklärungsmöglichkeiten, Erkenntnissewandel,
Forschungsfotschritte und Lernbedarf
hier(mit) keineswegs bestritten – allenfalls etwas (Validitäten
und Releabilitäten) widerlegbar / (menschenbezogen) relativiert / (Hyperrealitäten) entzaubert /
(Kritiken) enttabuisiert / (Gewissheiten/ Leute/Sozialgebilde) enttäuscht. 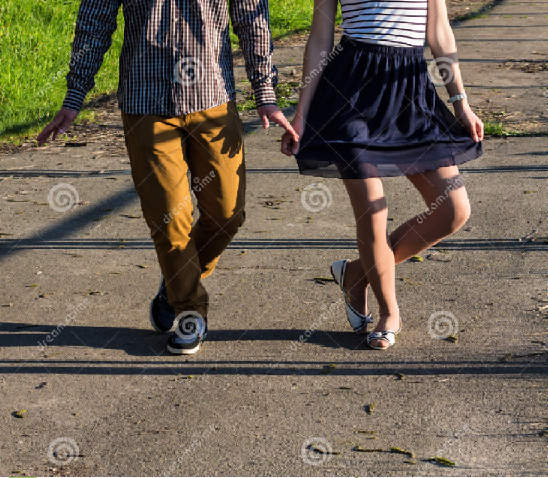 [‘Are Unknown Unknowns‘
nie-alle/n, nie-be-/erdacht, bie-gemacht, nie-gesehen, nie-überall,
nie-versucht, nie-vorgestellt, nie-zugleich, nie-… nirgends]
[‘Are Unknown Unknowns‘
nie-alle/n, nie-be-/erdacht, bie-gemacht, nie-gesehen, nie-überall,
nie-versucht, nie-vorgestellt, nie-zugleich, nie-… nirgends]  [Ach-Ja-aner\o/und-Nein] Fehler-!/?
[Ach-Ja-aner\o/und-Nein] Fehler-!/? 



 Abbs-texte darunter/über Fürstenwognung mit
Ankleidezimmer/Recae am Dame(n)salon zu – Euner Gnaden wissen ja bereits –
Erholungspausen vom Bekleidungsprozess – um wie verlangt/idealisiert aussehen
zu tun.
Abbs-texte darunter/über Fürstenwognung mit
Ankleidezimmer/Recae am Dame(n)salon zu – Euner Gnaden wissen ja bereits –
Erholungspausen vom Bekleidungsprozess – um wie verlangt/idealisiert aussehen
zu tun.
#  Mit Reverenzen,
bereits an/wegen Rainer
Maria Rilke verdichteter ‚Sinn‘, zumindest ‚ein/em funktionaler, äh ‚dialogischer‘ / dyadischer Zweck,
von ‚Schöpfung‘ / Existenz:
Mit Reverenzen,
bereits an/wegen Rainer
Maria Rilke verdichteter ‚Sinn‘, zumindest ‚ein/em funktionaler, äh ‚dialogischer‘ / dyadischer Zweck,
von ‚Schöpfung‘ / Existenz:
 Aussicht
auf die beiden anderen der westlichen T%ürme
- immerhin vom ‚Bergfried‘ aus/her.
Aussicht
auf die beiden anderen der westlichen T%ürme
- immerhin vom ‚Bergfried‘ aus/her.
Quated
reverences: Erst wo/wenn/falls, doch (wohl) immer, wenn/da wo jemand im überhaupt begonnenen Such- bis Findensprozess
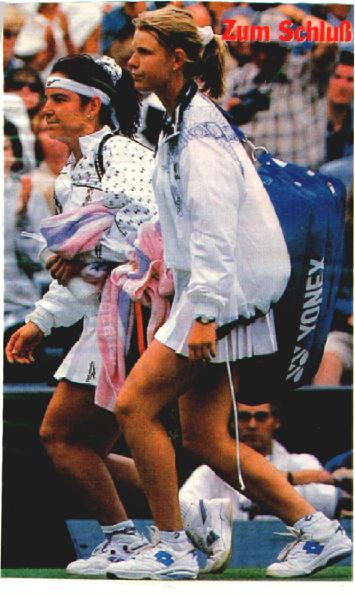 jemand plötzlich
/ ‚Gelegenheitsfenster erfassend‘ Fänger/in
eines, inner- bis
überraumzeitlich genau
gelungen/gezielt/kontingent/verfehlt-? zugeworfenen,
Realitäten-gar-Aneignungs-‚Balles‘,
jemand plötzlich
/ ‚Gelegenheitsfenster erfassend‘ Fänger/in
eines, inner- bis
überraumzeitlich genau
gelungen/gezielt/kontingent/verfehlt-? zugeworfenen,
Realitäten-gar-Aneignungs-‚Balles‘,
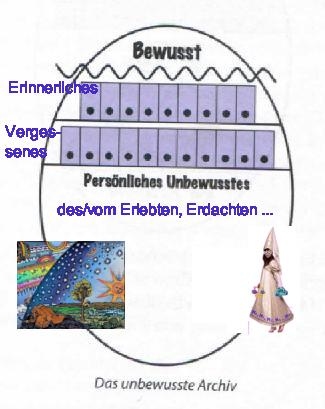
[Wo / Wenn sogar ‚Ungeliebtes / Unangenehmes‘ (you woudn’t / coudn’t love its) ‚nicht hinreeichend änderbar
/ erledigt‘ (you / it mustn’t change) und/oder qualifizierte
‚Bereitschaft zu gehen‘ (leave it), wenigstens aber hinreichend( und
sei/wäre es auch ups beleidigte / hochmütige /\ unterwürfige,
bis frustriert)e Aufgabe (let it / me
go)] 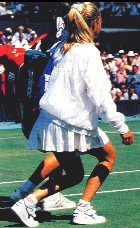 Da / Wenn es mir schwer fällt, sollte ich es vielleicht
tun? [Nicht zuletst, also oft erheblich, auch oder nur, eine
Angelegenheit von ‚besser oder schlechter‘, durch ‚ mehr gegen weniger‘ Askese versus Libertinimus Ablenkungen /
Verirrungen / Verwirrungen / Verzweckungen] Paraphasierte Reverenz an / von R.M.Rilkes Verdichtung:
Da / Wenn es mir schwer fällt, sollte ich es vielleicht
tun? [Nicht zuletst, also oft erheblich, auch oder nur, eine
Angelegenheit von ‚besser oder schlechter‘, durch ‚ mehr gegen weniger‘ Askese versus Libertinimus Ablenkungen /
Verirrungen / Verwirrungen / Verzweckungen] Paraphasierte Reverenz an / von R.M.Rilkes Verdichtung:
Mut
und Kraft (sogar)
vergessen, sich, bis einander, den gar/zumal Zurück-Wurf weder
erleichternd noch erschwehrend,
 Erinnere mich
בבקשה, dass nicht alles Wahrnehmen eine Ausfalltor-Reaktion wert-!/?/-/. [Vorsicht Rücksicht
/ Aussichten: ‚Auf‘ und ‚über Brücken gehend‘
Erinnere mich
בבקשה, dass nicht alles Wahrnehmen eine Ausfalltor-Reaktion wert-!/?/-/. [Vorsicht Rücksicht
/ Aussichten: ‚Auf‘ und ‚über Brücken gehend‘ ![]() können
sich / einander Menschen – gar auch unerwünscht / gefährlich, eben: betreffend – nahe kommen – CHASAK-Segen
am Beginn, bis zum Widerholen, schwieriger
Aufgaben: ‚Krone richten …‘ Wir wüssten schom]
können
sich / einander Menschen – gar auch unerwünscht / gefährlich, eben: betreffend – nahe kommen – CHASAK-Segen
am Beginn, bis zum Widerholen, schwieriger
Aufgaben: ‚Krone richten …‘ Wir wüssten schom]  Paraphasierte Reverenz an / von R.M.Rilkes Verdichtung:
Paraphasierte Reverenz an / von R.M.Rilkes Verdichtung:
ups Seines/meines/Eures (thymitische/s) beitragend
einbringt kommt mehr als immerhin ein, gar überraumzeitlich, tragfähiger Brückenbogen zustande.
 Kommt, gar im Widerspruch zur,
auch ‚gnostisch
denkenden‘, Erlösung, äh Hoffnung
des Determinismus, selbst,
nein gerade, für uns/mich ‚Vorgesehenes‘ nicht so ganz ‚rein‘ einseitig, ohne alle meine/unsere
Genehmigung, bis eigens über immerhin verlässliche Vorgabenerfüllung hinausgehende Beiträge, zustande?
Kommt, gar im Widerspruch zur,
auch ‚gnostisch
denkenden‘, Erlösung, äh Hoffnung
des Determinismus, selbst,
nein gerade, für uns/mich ‚Vorgesehenes‘ nicht so ganz ‚rein‘ einseitig, ohne alle meine/unsere
Genehmigung, bis eigens über immerhin verlässliche Vorgabenerfüllung hinausgehende Beiträge, zustande?  [Basale Vertragstreue, gar über noachidisch
Vereinbahrtes, hinausreichende durchaus relevant, anstatt zwingend, oder wem
wozu hinreichend]
[Basale Vertragstreue, gar über noachidisch
Vereinbahrtes, hinausreichende durchaus relevant, anstatt zwingend, oder wem
wozu hinreichend]
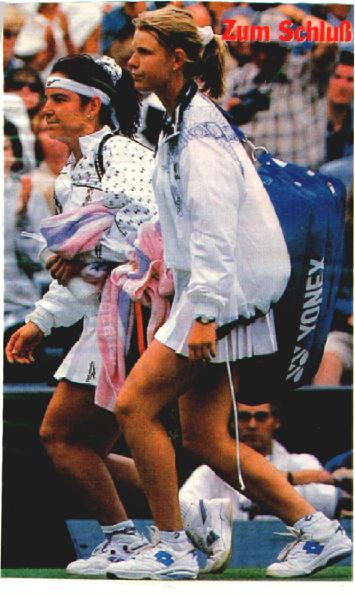 [Qualifiziertes
G’ttvertrauen,
bis die Vater-unser-Bitte: ‚nicht zusätzlich
zu Zielverfehlungen angereitzt/provoziert,
sondern wider Verfehlungen / schlechtes Begehren und Erleben bis Handeln / das Böse, zu müssen/üben/wollen, imunisiert zu werden/sein‘ – setzt der/des Übels Möglichkeiten geradezu voraus; gar
anstatt diese (wie manch griechische, bis gnostisch-pantheistische, Übersetzung / vertraute Lesart deutet / hofft
/ lehrt / unterstellt
/ voraussetzt) Freiheit zu bestreiten/‚vernichten‘] „Zum Schluß [sic! jener
Illustriertenausgabe; O.G.J. beim Betreten und Verlassen des Centre Court
mehere ‘curtsies‘ zählend] ein Knicks. Man muß scvhon sehr gut Tennis spielen, um hier knicksen zu
dürfen.“ (Presseausriss
1997 als …)
[Qualifiziertes
G’ttvertrauen,
bis die Vater-unser-Bitte: ‚nicht zusätzlich
zu Zielverfehlungen angereitzt/provoziert,
sondern wider Verfehlungen / schlechtes Begehren und Erleben bis Handeln / das Böse, zu müssen/üben/wollen, imunisiert zu werden/sein‘ – setzt der/des Übels Möglichkeiten geradezu voraus; gar
anstatt diese (wie manch griechische, bis gnostisch-pantheistische, Übersetzung / vertraute Lesart deutet / hofft
/ lehrt / unterstellt
/ voraussetzt) Freiheit zu bestreiten/‚vernichten‘] „Zum Schluß [sic! jener
Illustriertenausgabe; O.G.J. beim Betreten und Verlassen des Centre Court
mehere ‘curtsies‘ zählend] ein Knicks. Man muß scvhon sehr gut Tennis spielen, um hier knicksen zu
dürfen.“ (Presseausriss
1997 als …) 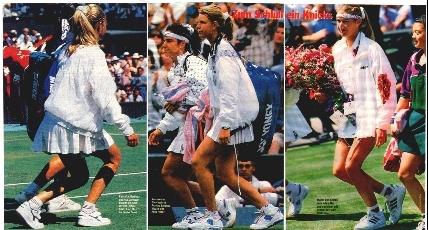 Länger als lebensrestzeitlich
auf Weltrang-, Teilnahme- bis Bestenlisten geführt
zu werden – auch, bis
eher, eine Ehre / ein Dürfen-!/? [Huldigungen ups, zumal der
/ von Sigenenden, nicht etwa ausgeschlossen – anstatt verlangen zu müssen-Fragen/-Antworten]
Länger als lebensrestzeitlich
auf Weltrang-, Teilnahme- bis Bestenlisten geführt
zu werden – auch, bis
eher, eine Ehre / ein Dürfen-!/? [Huldigungen ups, zumal der
/ von Sigenenden, nicht etwa ausgeschlossen – anstatt verlangen zu müssen-Fragen/-Antworten] _and_Vera_Zvonareva_Russia_exit_with_rather_unexprcted_curtsies_some_ballgirls_with_crossed_legs_too-Wimbledon_forschungsplurale_Inhalte_siegten-Getty102605777.jpg) (Serena Williams USA (CR) and Vera Zvonareva
Russia exit Centre Court curtsying synchrone with two of the bball girls at
their left seide 2010[!]) Nicht, dass
obligatorische / vertrags- bis vorschriftsgemäße
Verhaltenserwartungen (gar für/in/wegen Olympia, oder auch-nur / immerhin zu Wimbledon etwa seit 2003) aufgehört hätten – das läge ferene.
(Serena Williams USA (CR) and Vera Zvonareva
Russia exit Centre Court curtsying synchrone with two of the bball girls at
their left seide 2010[!]) Nicht, dass
obligatorische / vertrags- bis vorschriftsgemäße
Verhaltenserwartungen (gar für/in/wegen Olympia, oder auch-nur / immerhin zu Wimbledon etwa seit 2003) aufgehört hätten – das läge ferene. 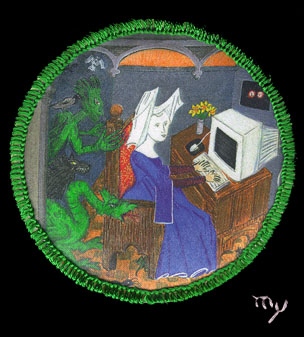 {Erlebt /Gehört: dass Leute ‚ihr‘ Textbuch (gar anstatt ihres Faches-?)
beherrschen} Kern-These/\Lückenmanagement: Zwar ‚zeichen sich‘/wir
‚auktoriale Erzählungen‘ – nicht alleine Ermittlungs(- bis Forschungs)berichte können
‚sich‘ für/gegen ihre Autorinnen und Autoren überraschend ‚ereignen‘, sprachlich stehen einander Referate und
Reverenzen selten nur fern
– dadurch
‚ab/aus‘, (gar
begrümdend / plausibel vermuteT/nD) zu ‚wissen‘, bis (etwa dramatuirgisch / didaktisch
dosiert, eindrücklich, interessant / interresiert, protolollierend, pontuert,
spielerisch, täuschend äh tausachend,
treffend, unterhaltsam etc.) ‚offen (oder zu) zu legen‘, was jedenfalls ‚ihre‘/die
Figuren (bis
Geschehnisse – sogar/gerade ‚innerhalb‘
eines Werkes, verwendeter Grammatik[en / ‚Logiken / Regeln‘], respektive wegen,
Verallgemeinerungsansprüchen mittels/über/von anerkannten, behaupteten, bekannten, erdachten,
erlaubten, gehassten, gesollten, gesuchten, gewählten, idealisiertem, hohen,
strittigen, vereinbarten, vorgefunden Fakten
/ Hyperrealitäten) benötigen, denken, fühlen,
können, motoviere, tun, veranlassen, verbergen, versäumen / versuchen, wollten
pp. – doch nicht immer/nur (gar vor der ‚Niederschrift‘ / Dreharbeitenbeendigung) allumfassend / allwissend /
zwingemd was das Werk (oder gar manche Fachgebit[sdetails] / Kentnisse) ‚angeht / hindert /
unterst+tzt / zoft‘.
{Erlebt /Gehört: dass Leute ‚ihr‘ Textbuch (gar anstatt ihres Faches-?)
beherrschen} Kern-These/\Lückenmanagement: Zwar ‚zeichen sich‘/wir
‚auktoriale Erzählungen‘ – nicht alleine Ermittlungs(- bis Forschungs)berichte können
‚sich‘ für/gegen ihre Autorinnen und Autoren überraschend ‚ereignen‘, sprachlich stehen einander Referate und
Reverenzen selten nur fern
– dadurch
‚ab/aus‘, (gar
begrümdend / plausibel vermuteT/nD) zu ‚wissen‘, bis (etwa dramatuirgisch / didaktisch
dosiert, eindrücklich, interessant / interresiert, protolollierend, pontuert,
spielerisch, täuschend äh tausachend,
treffend, unterhaltsam etc.) ‚offen (oder zu) zu legen‘, was jedenfalls ‚ihre‘/die
Figuren (bis
Geschehnisse – sogar/gerade ‚innerhalb‘
eines Werkes, verwendeter Grammatik[en / ‚Logiken / Regeln‘], respektive wegen,
Verallgemeinerungsansprüchen mittels/über/von anerkannten, behaupteten, bekannten, erdachten,
erlaubten, gehassten, gesollten, gesuchten, gewählten, idealisiertem, hohen,
strittigen, vereinbarten, vorgefunden Fakten
/ Hyperrealitäten) benötigen, denken, fühlen,
können, motoviere, tun, veranlassen, verbergen, versäumen / versuchen, wollten
pp. – doch nicht immer/nur (gar vor der ‚Niederschrift‘ / Dreharbeitenbeendigung) allumfassend / allwissend /
zwingemd was das Werk (oder gar manche Fachgebit[sdetails] / Kentnisse) ‚angeht / hindert /
unterst+tzt / zoft‘.  Greifen Fragen ‚was Menschen dafür, damit,
deswegen auf sich nehmen / ertragen / tun / wollen‘ auch daneben, bis zu
kurz?
Greifen Fragen ‚was Menschen dafür, damit,
deswegen auf sich nehmen / ertragen / tun / wollen‘ auch daneben, bis zu
kurz?  D/Noch ein
Aphorismus sagt: [Kunst komme von Können – käne sie von Wollen … wüssten Sie ja schon
‚Wülstigeres‘]
D/Noch ein
Aphorismus sagt: [Kunst komme von Können – käne sie von Wollen … wüssten Sie ja schon
‚Wülstigeres‘]
Au(k)torial
/ Autoritativ (namentlich ‚etwas / jemandem zu sagen
habend / versuchend‘ –
qua Ansehen / Macht[einfluss], Befugnissen /
Berechtigungen und/oder Kenntnissen / Kompetenzen) nicht immer gleich
notwendiugerweise, oder nur/rein, authentisch, autoritär oder zutreffend-!/?
Autoriale (bereits / gerade ‚mündliche‘) bis autoritative (nicht allein / erst / nur /
überhaupt autoritäre) Befunde
auch mit / unter vielen, bis fast allen, Menschen, intersubjektiv
konsensfähig:  „Die Kunst und wie man sie macht“,
[‚Braucht‘ bis wird
‚innerraumzeitlich‘ [sic! Anderheitliches
/ Ungeheuerliches eben ‚darin‘ (hier und jetzt – nicht
etwa erst / nur [bis überhaupt] ‚Anderswo‘) gefürchtet / verwendet] gar nicht Alles was ich(s / Menschen / Pflanzen / Tiere)
/ Figuration(em) / Dyade(n) erdenke(n)/erlebe(n) auch
aufgezeichnet / beachtet / erinnert / protololliert
/ publiziert (gewesen) sein-? the Art)s) of
‚Lückenmanagement‘] Dass/Ob Sie,
Euer Gnaden, denken bezweifeln wir nicht – was betrifft/intersiert allerdings
manchmal-!/?
„Die Kunst und wie man sie macht“,
[‚Braucht‘ bis wird
‚innerraumzeitlich‘ [sic! Anderheitliches
/ Ungeheuerliches eben ‚darin‘ (hier und jetzt – nicht
etwa erst / nur [bis überhaupt] ‚Anderswo‘) gefürchtet / verwendet] gar nicht Alles was ich(s / Menschen / Pflanzen / Tiere)
/ Figuration(em) / Dyade(n) erdenke(n)/erlebe(n) auch
aufgezeichnet / beachtet / erinnert / protololliert
/ publiziert (gewesen) sein-? the Art)s) of
‚Lückenmanagement‘] Dass/Ob Sie,
Euer Gnaden, denken bezweifeln wir nicht – was betrifft/intersiert allerdings
manchmal-!/?  Denkwerkzeugkasten? [Halten
manche ihr
Publikum für noch dümmerr als sich selbst] Zum
\ Vo®m Sprung der Tat(handlung)?
Denkwerkzeugkasten? [Halten
manche ihr
Publikum für noch dümmerr als sich selbst] Zum
\ Vo®m Sprung der Tat(handlung)? 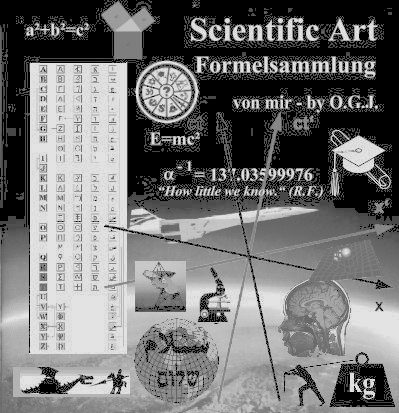


Zwar seien Entdeckungen / Erfindungen nie nur #negativ/\positiv#, noch ausschließlich /
immerhin pure Phantasie/n – denn-ooch kommen sie / wir nicht ganz ohne CHeTs חתר
/ (‚Hochzeitliches‘) חתן / חת / … / (alefbetisch mehr-deutig sortiert-?) חיט
/ חי׀חיים / חיה׀חית /
חטא / … / חבר / חבב׀חיבה / חב׀חבא ![]() ?חא und also auch nicht so ganz ohne jedes ‚Denken‘ aus und zustande-!/? – Bereits uns immerjin Anschauungen und
Begrifflichkeiten erwqeisen sich (spätestens nit/seit Kant – sowie immerhin/mindestens ‚ihrerseits‘/empirisch vorfindlich) inte4rdependent gegen- bis
miteinander wirksame Repräsentationen (des so zu addressioeren/repräsentieren
Versuchten).
?חא und also auch nicht so ganz ohne jedes ‚Denken‘ aus und zustande-!/? – Bereits uns immerjin Anschauungen und
Begrifflichkeiten erwqeisen sich (spätestens nit/seit Kant – sowie immerhin/mindestens ‚ihrerseits‘/empirisch vorfindlich) inte4rdependent gegen- bis
miteinander wirksame Repräsentationen (des so zu addressioeren/repräsentieren
Versuchten).
‚Autoritativ‘, bis ‚urheberlich‘ (wie ‚autoritär‘ bis etwa
‚totalitär‘ und/oder gar ‚kopetent‘ respektive ‚wirksam‘ auch immer) angefangen habend, kaum
ganz anlaslos ‚schreibend‘, auch/gerade ohne immer/überhaupt Bücher bis
mehr beabsichtigen zu müssen.
 Das
gehört sich ja gar nicht? [Ganz ohne ‚Kerrle‘ geht die ‚Scjose‘ nicht
Das
gehört sich ja gar nicht? [Ganz ohne ‚Kerrle‘ geht die ‚Scjose‘ nicht 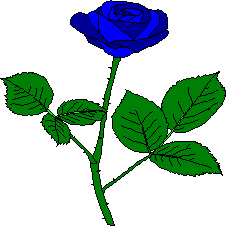 ganz phne ‚Menschen‘ blühe ‚die blaue Rose‘ nicht]
ganz phne ‚Menschen‘ blühe ‚die blaue Rose‘ nicht] 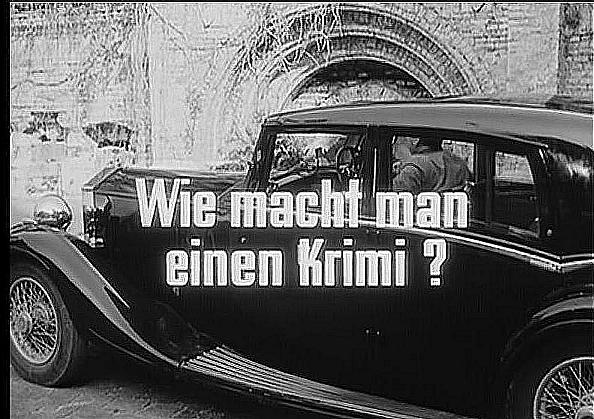 Wi auch immer nach- und
oder vorauseilende Dinge,
Ereignisse und /oder\aber Figuren kaum abwendlich?
Wi auch immer nach- und
oder vorauseilende Dinge,
Ereignisse und /oder\aber Figuren kaum abwendlich? 
Paraphasierte Reverenz an / von R.M. Rilkes Verdichtung: Meteor-Hauch-neugebphren![]()
#Auktoriales des Erzählendes, gar Literaturerstellens, bis / hier / immerhin Rilkes
Meteor entschwindet / rast zwar in dessen / seine Räume davon, doch aus / durch
/ von meinen Händen (mich / uns) nicht los geworden! Gerade falls / wo
die Gegenstämde / Themen intersubjektiv relevant oder sogar konsensual
erscheinen.
 [Es
gibt mehr … (Lückenmanagement/s) זז weniger וו]
[Es
gibt mehr … (Lückenmanagement/s) זז weniger וו]  [… als ich zu wissen behaupte, meine,
wage / will] Oder sind/werden weniger mehr . ohbne
sinnlos?
[… als ich zu wissen behaupte, meine,
wage / will] Oder sind/werden weniger mehr . ohbne
sinnlos? 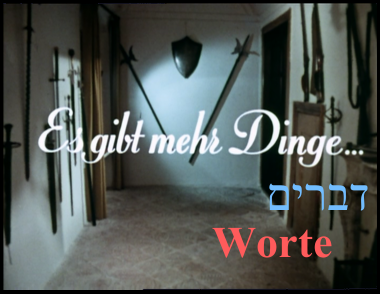
Zwar bleiben der
/ einer / mancherlei Erzählung ‚inhaltliche‘ Qualitäten (Dir, Euch, ihr, mir bis uns ‚realita‘) wichtig – und Kenntnisse (anderer, auch ‚hyperrealer‘,
bis der) Geschichten immerhin begrenzt möglich: „Viel Gescherei und wenig Wolle“,
sprach der Mann, der das Schwein schohr.
– Doch (obwohl und wärend
Seminare zur Macht-Verbesserung des Ausdrucks,
der Form/e[l]n
und [ihrer] Grammatik/[zuläddigkeit]en, bis Ethik und Pistik,
gehaltlos. äh unabhängig von
‚Inhalten‘, scheitern können) schaden auch (gar geistes)wissenschaftliche
Schreibkenntnisse nicht gerade; obwohl in Literatur bis Rhetorik promoviert zu
haben, weder notwendige noch hinreichende Vorausetzungen für Texe liefert, die (‚zu Ende‘ / mehr als zwei)mal gelesen werden ‚können‘
bis wollen. 
V.F.B. benannte was Menschen als ‚Muß-Lesen‘
gegenüber ‚Gemuß-Lesen‘ praktizieren, respektive unterlassen wollten. [Aspektisch,
oder wie auch immer sonst,
zutreffende
Berichte(rstattungen
/ Lage-Darstellungen) fallen bereits, mamche überraschend / verletzend, schwehr / mager aus]  [Nur so /pschat/ פשט äußerlich, oberflächlich, unbekleidet ganz ‚als‘-strukturfrei, begriffslos / neutral / ‚objektiv‘ / sprachlos / unerfahren
/ nicht interessiert / ohne jede Aufmerksamkeit(sentscheidung/en) kommen Anschuungen / ‚Sichtbarkeiten‘ selten, bis nie, aus
/ daher / in Erinnerung / zustande] abb-curtsy-transparentkleid-golden-globe??
[Nur so /pschat/ פשט äußerlich, oberflächlich, unbekleidet ganz ‚als‘-strukturfrei, begriffslos / neutral / ‚objektiv‘ / sprachlos / unerfahren
/ nicht interessiert / ohne jede Aufmerksamkeit(sentscheidung/en) kommen Anschuungen / ‚Sichtbarkeiten‘ selten, bis nie, aus
/ daher / in Erinnerung / zustande] abb-curtsy-transparentkleid-golden-globe??![]()
Russen und Amerikaner: Ob etwa Ähnlichkeiten oder Unterschiede,
wann / wen  [Europa / Menschenheit]
[Europa / Menschenheit] 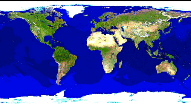 mehr erschrecken?
mehr erschrecken?
[Es finden durchaus – immerhin aspektisch und
perspektivisch abbildbar/e Ereignisse (bis
als ‚Ergebnisse‘ / Erlebnisse) statt] Nicht
nur erdache-?, oder
immerhin inszenierte? 
Zwar bekauptet
sie (mindestens
eine ‚kniende‘, äh politische Aktivistin sogar ausdrücklich, respektive Refelexe-erwartbar
prompt): Sie unterwerfe sich niemandem (mehr) – weder Recht noch Alter/ungen; doch erkennen
Andere dies, gar
besser deutend-!/? Doch kann keine
Diplomati-ups, keine Form(el) /
Formulierung, kein Gefäß, keine Genauigkeit, kein Gespräch, keine Gewalttat-ups, keine Grammatik, keine Höflichleit,
keine Liebe-ups, keine Rücksicht,
keine Umsicht,… nichts immer alle (diesmal) gegen / vor Miß- oder
Unverständnissen schützen – nicht einmal (senderseitig) Erwatetes vermeidet
dies (oder
Verständigung / ups \
wie-es-gemacht/-gemeint) zuverlässig.
[Ob ‚die
Welt‘ (oder
immerhin / wenigstens ‚Thermodynamik‘-Wahrnehmungen-?) zu Euren / Ihren
oder zu meinen Lebzeieten untergeht ist (mir
empörend / erschreckend)
egal / gleich(un)gültig,
(denn) ‚meine (Lebens)welt‘
wird ohnehin (nicht nur verändert,
sondern endend) untergehen. – ‚Meine‘ Geschichte/n zumal ‚diesseits des Futurum exaktuns‘ (eine Wesentlichkeit, dass/falls/ob
nicht vergessen [ist], wer erinnert wird) / innerraumzeitlich relevant /
wirksam![]() ] Kinder und/oder sonstige Hervorbringungen /toledot/
] Kinder und/oder sonstige Hervorbringungen /toledot/ ![]() , auch solche / physische, die
einem (gar von Königinnen) ‚geammt‘ werden, zu bekommen / fördern / ‚haben‘ ändert und beseitigt eigene Endlichkeiten nicht
basal – nicht einmal ‚post hume‘ Erinnerungen
/ Erwähnungen leisten anderes / mehr als … wissen Sie schon?
, auch solche / physische, die
einem (gar von Königinnen) ‚geammt‘ werden, zu bekommen / fördern / ‚haben‘ ändert und beseitigt eigene Endlichkeiten nicht
basal – nicht einmal ‚post hume‘ Erinnerungen
/ Erwähnungen leisten anderes / mehr als … wissen Sie schon? ![]() Abb.nursery-birland-kinderfrauengruppe-kinderwagen??
Abb.nursery-birland-kinderfrauengruppe-kinderwagen??
 Etwas, bis jemand, zum
Feiern / Freuen / Hoffen/ Gemeinsamen (gebraucht/gefunden). [Siengestanz mit zwar anatomisch kaum vermeidlich( gar zum Mädchen-Dienste im Graf Yoster Haushalt
qualifiziert)er Kniebeuge; die aber zumal/zumindest
selbst nicht einmal, und schon gar nicht als solche oder knicksend, bemerkt /
gedeutet / gemeint / gesollt / gewollt / verwendet] ??Dialektil(en) von Schwarz und/oder\aber Weiss/Silber als Dualismen
‚grau‘. ??
Etwas, bis jemand, zum
Feiern / Freuen / Hoffen/ Gemeinsamen (gebraucht/gefunden). [Siengestanz mit zwar anatomisch kaum vermeidlich( gar zum Mädchen-Dienste im Graf Yoster Haushalt
qualifiziert)er Kniebeuge; die aber zumal/zumindest
selbst nicht einmal, und schon gar nicht als solche oder knicksend, bemerkt /
gedeutet / gemeint / gesollt / gewollt / verwendet] ??Dialektil(en) von Schwarz und/oder\aber Weiss/Silber als Dualismen
‚grau‘. ??
Revolutionär / ‚Revisionär‘ / Gemeinsam / ‚Gleichheitlich‘ /
Bürgerlich ‚emanzipiert fortgeschritten‘: ‚Knien‘ sei/wurde abgeschaftt – also
gibt es, gar so viele, ‚Moralverluste‘ / Rechtsverstöße-!/?-Frageverbote
 [Andere weden dafür ‚Knie
zu beugen‘ entlohnt – Askese-Libertinismusfalle drohen Totalitärem der/des/vo
‚mehr oder minder‘]
[Andere weden dafür ‚Knie
zu beugen‘ entlohnt – Askese-Libertinismusfalle drohen Totalitärem der/des/vo
‚mehr oder minder‘]  Nicht was manche jetzt / wider dächten: Kaum Befreiungsfortschrittm
dass, und bereits ‚falls‘, Frau Damenhosen tragen muss. Auch und gerade
technische Fortschritte werden gerne übersätzt: so haben etwa Schmutz- und
Staubabsauganlagen respektive Gebläse Eignungsgrenzen, nicht nur unter
Laborbedingungen.
Nicht was manche jetzt / wider dächten: Kaum Befreiungsfortschrittm
dass, und bereits ‚falls‘, Frau Damenhosen tragen muss. Auch und gerade
technische Fortschritte werden gerne übersätzt: so haben etwa Schmutz- und
Staubabsauganlagen respektive Gebläse Eignungsgrenzen, nicht nur unter
Laborbedingungen. 
‚Kontemplatives
Gelächter‘ findet an Grenzenrändern begreifenden Verstehens (H23??) statt – und
sist so selten, sowie (bereiuts daher) empöredmd, dass wenige es überhaupt (als
solches) bemerken und\aber nocht weniger es praktizieren.
Dass
Anima Animus überwältigt (h24#vuka) ist gar nicht so selten wie es scheint, bis
aussehen soll/will. Anima zu überzegen ist nie leichter als (sie) zu überredem –
Animus schon gar nicht.
Abbs.Yoster-schriftsteller-bücher ??
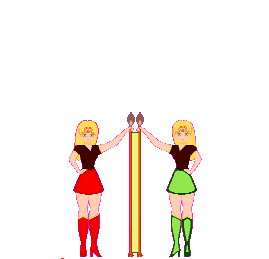 [Gegenwart(sdauer – in der, zumal psychisch normiert/gesund definierten, Regel / häufig, anstatt immer, so erlebt) etwa drei chronologische/chronometrische/physikalische
Sekunden lang andauernd/getaktet]
[Gegenwart(sdauer – in der, zumal psychisch normiert/gesund definierten, Regel / häufig, anstatt immer, so erlebt) etwa drei chronologische/chronometrische/physikalische
Sekunden lang andauernd/getaktet]
Etwas
mehr/anderes als ‚gegenwärtige
drei Sekunden‘, ein ‚ganzes‘ Gelegenheitsfenster-Trippel. 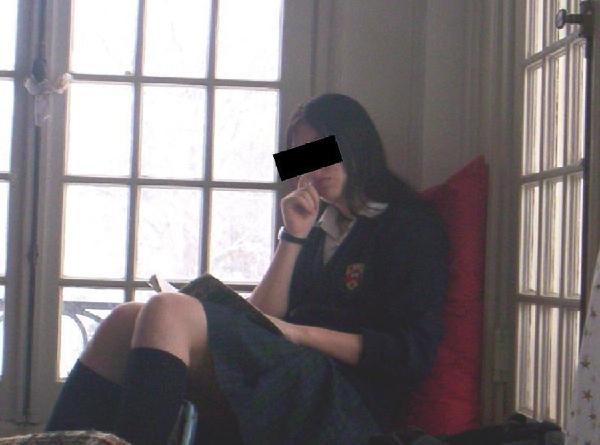 Etwa einer/mehreren ‚geeigneten‘ Alterskohorte/n angehörend („Eulen aus/nach Athen“ – ‚Unter hundert’s
ungleich/widersprüchlich
definierbar/operationalisiert), oder worauf auch immer sonst bezogen? – Andere/r
bis meine Gewohnheiten/‚Komfortzohnen‘-genannte
oder -gescholtene Reaktionen/alef-mem-nun א־מ־ן\Übungen zu ändern / betreten / unter- bis
verlassen? [Window of Oportunity: Gleich gar ‚von innen‘, oder alleine,
bis nicht alleine, anders als ‚von außen‘ an-gesehen] Markgräflicher Selbsteturm
in der Handm und i(in ‚ne)m ‚auktorialen‘/begrenzten Modell
‚als‘/bis des Hochschlosses.
Etwa einer/mehreren ‚geeigneten‘ Alterskohorte/n angehörend („Eulen aus/nach Athen“ – ‚Unter hundert’s
ungleich/widersprüchlich
definierbar/operationalisiert), oder worauf auch immer sonst bezogen? – Andere/r
bis meine Gewohnheiten/‚Komfortzohnen‘-genannte
oder -gescholtene Reaktionen/alef-mem-nun א־מ־ן\Übungen zu ändern / betreten / unter- bis
verlassen? [Window of Oportunity: Gleich gar ‚von innen‘, oder alleine,
bis nicht alleine, anders als ‚von außen‘ an-gesehen] Markgräflicher Selbsteturm
in der Handm und i(in ‚ne)m ‚auktorialen‘/begrenzten Modell
‚als‘/bis des Hochschlosses.  [Der
/dewarim/ דברים – äh Beobachtungen / Begegenungen
– Häufungen
‚Ereignishöfe‘ und (Um-)Regelmäßigkeiten ,haben‘ / korrelieren-mit
Einflüsse/n] Mustererkennungen als/an
Serienen bis in/von Widerholungen
… legen
(Asswoziationen, Gefürchtetes, ‚Gefundenes‘
/ Dafür-Gehaltenes,
Gehofftes, Gesuchtes,
Gewoolltes, Hyperreales) / liegen
nahe: ‚Ergeben/Häufen sich‘ auch (eher) kontingent (als etwa geplant oder vertaktet) zufallendende
Begegnungen, bis zusammentreffende Ereignisse, lokal und/oder (Genesis
1:14 Bereschit) zeitweilig?
[Der
/dewarim/ דברים – äh Beobachtungen / Begegenungen
– Häufungen
‚Ereignishöfe‘ und (Um-)Regelmäßigkeiten ,haben‘ / korrelieren-mit
Einflüsse/n] Mustererkennungen als/an
Serienen bis in/von Widerholungen
… legen
(Asswoziationen, Gefürchtetes, ‚Gefundenes‘
/ Dafür-Gehaltenes,
Gehofftes, Gesuchtes,
Gewoolltes, Hyperreales) / liegen
nahe: ‚Ergeben/Häufen sich‘ auch (eher) kontingent (als etwa geplant oder vertaktet) zufallendende
Begegnungen, bis zusammentreffende Ereignisse, lokal und/oder (Genesis
1:14 Bereschit) zeitweilig?

![]() “I pass thrugh that“ erath “but once:
therefor let me …”
“I pass thrugh that“ erath “but once:
therefor let me …” ![]() Dabei/Dennoch treffen wir Menschen (jedenfalls solche mit/von
denen ich betreffende, bis übergriffig, zu tun habe – mindestens) zweimal.
Dabei/Dennoch treffen wir Menschen (jedenfalls solche mit/von
denen ich betreffende, bis übergriffig, zu tun habe – mindestens) zweimal. ![]() Geringschätzungen, bis Verachtung/en (und/oder gleich gar/zumal Hass) zu
kritisieren/verurteilen, liegt eher nahe – die Konsequenz keine (zumal negativ
diskrimierenden) Unterschiede machen zu dürfen, äh
keine (Entscheidungen respektive Interessen[konflikte]
bis Folgen / Strafen / Urtteile) zu wollen, taren Versuchungen auf Unterschiede, also ‚Wert/e‘
verzischten zu sollen, schon erheblich ‚gnostisch‘ / substanz-
äh materiefeindlich (asketisch/libertinistisch
begründet) / verteilungsparadigmatisch
interresiert.
Geringschätzungen, bis Verachtung/en (und/oder gleich gar/zumal Hass) zu
kritisieren/verurteilen, liegt eher nahe – die Konsequenz keine (zumal negativ
diskrimierenden) Unterschiede machen zu dürfen, äh
keine (Entscheidungen respektive Interessen[konflikte]
bis Folgen / Strafen / Urtteile) zu wollen, taren Versuchungen auf Unterschiede, also ‚Wert/e‘
verzischten zu sollen, schon erheblich ‚gnostisch‘ / substanz-
äh materiefeindlich (asketisch/libertinistisch
begründet) / verteilungsparadigmatisch
interresiert.  Zumal apostolische Warnungen keine (anderen) Menschen zu verurteilen (gerade um Gutachten / dies zuständigen
Gerichtshöfen zuzu… Sie
wissen schon), bis sich selbst zu erkennen / kritisieren (gar anstatt zu vernichten-?), respektive zu begrenzen, äh zu bessern/ תיקון \‚vollenden‘ (er)tragen dies
Unterscheide machen/zulassen
begrümdet/stützend mit. [Markgrafentum der/des Selbste/s – wenn eben erst nach/trotz/wegen ettlichen,
auch/sogar gerade hoheitlichen
Zögerns – eingebaut] Oberste, nordostwärts ‚vermauerte‘, Reihe dreifacher Fenster betreffend, unterbrochen Teile auf-
und er- bis umfassend.
Zumal apostolische Warnungen keine (anderen) Menschen zu verurteilen (gerade um Gutachten / dies zuständigen
Gerichtshöfen zuzu… Sie
wissen schon), bis sich selbst zu erkennen / kritisieren (gar anstatt zu vernichten-?), respektive zu begrenzen, äh zu bessern/ תיקון \‚vollenden‘ (er)tragen dies
Unterscheide machen/zulassen
begrümdet/stützend mit. [Markgrafentum der/des Selbste/s – wenn eben erst nach/trotz/wegen ettlichen,
auch/sogar gerade hoheitlichen
Zögerns – eingebaut] Oberste, nordostwärts ‚vermauerte‘, Reihe dreifacher Fenster betreffend, unterbrochen Teile auf-
und er- bis umfassend.

 [Auch über dem und unter dem Markgrafenturm
Hinausstehendes]
[Auch über dem und unter dem Markgrafenturm
Hinausstehendes]
Aussichten auf,
über und zu: Abstroßungen und-oder-aber
Anziehungen, Böse(s) undזoderזaber
Gut(es), CHeT-חית , Falsch(es) und/oder\aber
Richtig(es),
Gewohntes undוoderוaber Gewolltes, Gewissheit/en-Hoffnungen, Irrtümmer, Lücken undזזoderווaber Lügen,
Nichtwissen undווווoderווaber Unwissen,
Nützliches undווoderווaber Schlechtes,
Resalote, #Schwarz(es)# bis Weises, ‚Selbiges‘, תיקון … Urteilen , Wesentlich(
Gegenwärtig)es,
Zukunften?

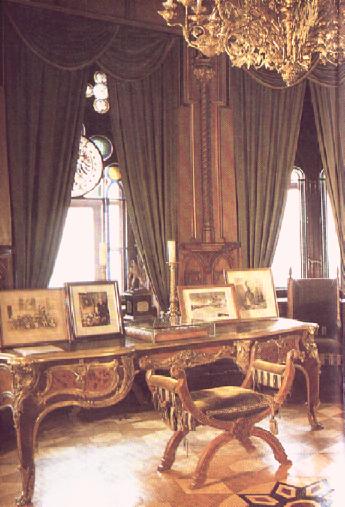


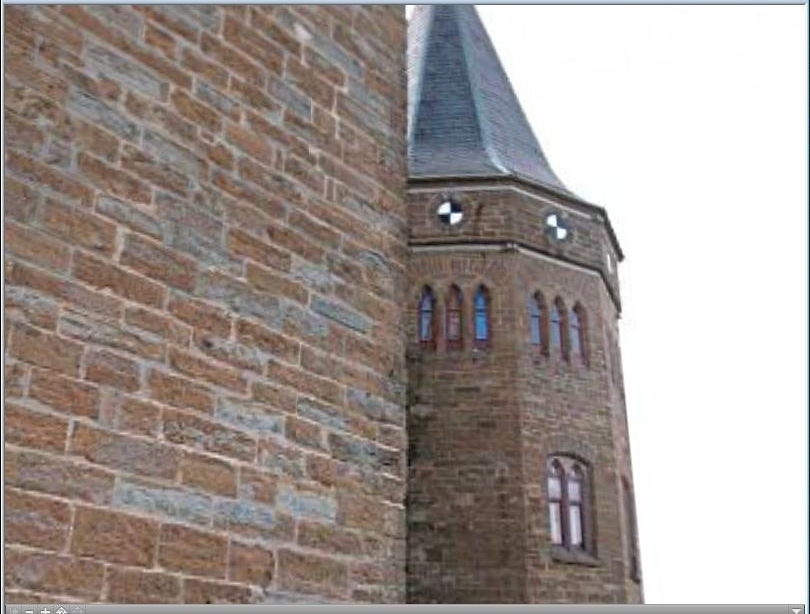
Eine unseres Erachtens
weniger bekannte, wesentliche ‚Abbildung‘ / Semiotik für
/\ von Möglichkeiten(spiel)räume/n
des Interaggierens von ‚(über- bis
außerrazmzeitlichem) Kairos und / mit (innerraumzeitlichem, bis
gegenwärtig verhaltensrelevantem) Chronos‘ brachte #hier![]() Eugen Bisers Ausdrucksweise unserer ‚Freiheitsspielräume
bzw. Freiheitenkorridore‘, repäsentativ für unsere / menschenheitliche
‚Möglichkeitenkorridore‘, gar erheblichst mäandrierende, doch (auch mit Sir
George P.) stets kleinerer Einflüsse als unserer
Interessenbereiche, ein.
Eugen Bisers Ausdrucksweise unserer ‚Freiheitsspielräume
bzw. Freiheitenkorridore‘, repäsentativ für unsere / menschenheitliche
‚Möglichkeitenkorridore‘, gar erheblichst mäandrierende, doch (auch mit Sir
George P.) stets kleinerer Einflüsse als unserer
Interessenbereiche, ein.
 Kaiserliche Hoheit wissen schon. [In asiatisch /
sino-tibetisch strengsten(s geregelten Tee-)Zeremonien
gehört, vorzugsweise jedesmal (indoeuropäisch formuliert) ‚ein‘
anderer / neuer kleiner Fehler (‚Schönheitsfleck‘) / beabsichtigte Abweichung (Asymetrie bis Asynchronität – zumal gegenüber Plänen, Takten,
Formeln
pp. ‚gebrochener Schänheit‘) zur ‚Vollendung‘ –
der / ein Vorzug gebürt / gilt den Methoden ‚der Schule Hillels‘] Es
sind sorry, gar nicht die (äußerlichen /\
innere) Knie
zu erleuchten.
Kaiserliche Hoheit wissen schon. [In asiatisch /
sino-tibetisch strengsten(s geregelten Tee-)Zeremonien
gehört, vorzugsweise jedesmal (indoeuropäisch formuliert) ‚ein‘
anderer / neuer kleiner Fehler (‚Schönheitsfleck‘) / beabsichtigte Abweichung (Asymetrie bis Asynchronität – zumal gegenüber Plänen, Takten,
Formeln
pp. ‚gebrochener Schänheit‘) zur ‚Vollendung‘ –
der / ein Vorzug gebürt / gilt den Methoden ‚der Schule Hillels‘] Es
sind sorry, gar nicht die (äußerlichen /\
innere) Knie
zu erleuchten.  Auch kein noch so
‚Innerliches‘ ist ‚ganz ohne alles Außen‘ zu haben
/ ändern!
Auch kein noch so
‚Innerliches‘ ist ‚ganz ohne alles Außen‘ zu haben
/ ändern! [Kaiserlicher Hoheiten Reverenzen] Auch musikalische Präsentationen können
durch die mathematische Exaktheit (nicht nur
von Cumputerprogrammen) ‚seelenlos‘ / zu präziese
(+berboten) erfolgen.
[Kaiserlicher Hoheiten Reverenzen] Auch musikalische Präsentationen können
durch die mathematische Exaktheit (nicht nur
von Cumputerprogrammen) ‚seelenlos‘ / zu präziese
(+berboten) erfolgen.
Zu den Paradoxa hier zu sein, könnte nämlich ‚Vollendung‘ gehören, gerade ihne
unperfek zu sein/werden.  [Gägnige /
Geläufige Erklärungen erinneren / referieren /sachor/ זכור mit Schönheitsunterbrechung
(zumal des Denkmusters)
/ schiefsthenden Lehrhauswänden, und
gedenken / bewachen, äh bewahren /schamor/ שמור in Freudenbegrenzung, basal immerhin des Leides /churban/ חורבן wegen, namantlich der
Tempelzerstörung(en – mit Konsequenzen wie ‚überallhin tragbarer Heimat‘ als Tora / in Literatur und
immerhin rechtlicher
Beurteilung / Begrenzung gemeinwesentlichen Handelns) bis sogar Unvorstellbarem]
[Gägnige /
Geläufige Erklärungen erinneren / referieren /sachor/ זכור mit Schönheitsunterbrechung
(zumal des Denkmusters)
/ schiefsthenden Lehrhauswänden, und
gedenken / bewachen, äh bewahren /schamor/ שמור in Freudenbegrenzung, basal immerhin des Leides /churban/ חורבן wegen, namantlich der
Tempelzerstörung(en – mit Konsequenzen wie ‚überallhin tragbarer Heimat‘ als Tora / in Literatur und
immerhin rechtlicher
Beurteilung / Begrenzung gemeinwesentlichen Handelns) bis sogar Unvorstellbarem] _Ronja_und_Leonardo_mit_Dame_Trinkhalle_Fussbodenfliesenmuster_Minifiguren-Frauenhaende_zeigen_auf_Kreiseanomalien-Draufsicht-IMG_7572.jpg)
Auch /
Immerhin ‚der Wert‘ des kostbarsten Gefäßes … Sie wissen vielleicht schon.  [Wenige
sehen – von hier oben aus (geneigt)
– in den eigen Burghof]
[Wenige
sehen – von hier oben aus (geneigt)
– in den eigen Burghof] 
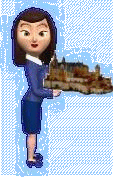 Die ‚obige‘
Turmspitze, selbst, gar noch / wiederum und dawider, bis eigentlich wogegen-? mit Entweder-Oder-Nichtfarben des – versus
doch blauen – ‚sichern‘
Die ‚obige‘
Turmspitze, selbst, gar noch / wiederum und dawider, bis eigentlich wogegen-? mit Entweder-Oder-Nichtfarben des – versus
doch blauen – ‚sichern‘ ![]() Wappenschilds vorläufig verrammelt …
Wappenschilds vorläufig verrammelt …  [Noachidischer (‚Regen‘- äh Bundes-)Bogen – hinreichend verpönt / missbraucht]
[Noachidischer (‚Regen‘- äh Bundes-)Bogen – hinreichend verpönt / missbraucht]
 [Überwindbarkeiten definitive jedebfalls]
[Überwindbarkeiten definitive jedebfalls]
An meinem, zumindest beinahe
‚zu persönlich( werdend)en‘, Beispiel ![]() O.G.J.‘s unter diesem ‚mundfesten‘
oberbegrifflichen Turmdach ‚zusammenge- bis auseinander-fassend‘:
O.G.J.‘s unter diesem ‚mundfesten‘
oberbegrifflichen Turmdach ‚zusammenge- bis auseinander-fassend‘:
![]() Was ich [O.G.J.] kann, (mir jedenfalls ein- bis ausbildete) Sie,
Euerr Gnaden (spätestens / immerhin) folglich nicht
unbedingt selbst / alleine machen müssten: „Mich in der, bis gar über die ‚Geschichte des (eben nicht allein meiner! Plural-ups)
Denken(s)‘ hin und her, vor, zurück, links. rechts, auf
und ab bewegen,
Was ich [O.G.J.] kann, (mir jedenfalls ein- bis ausbildete) Sie,
Euerr Gnaden (spätestens / immerhin) folglich nicht
unbedingt selbst / alleine machen müssten: „Mich in der, bis gar über die ‚Geschichte des (eben nicht allein meiner! Plural-ups)
Denken(s)‘ hin und her, vor, zurück, links. rechts, auf
und ab bewegen,  [Bei
gutem Mondlichte] wie ich gerade ‚lunalustig‘ / gestimmt bin (oder ‚wir‘ sogar zu werden
‚finden‘).“
[Bei
gutem Mondlichte] wie ich gerade ‚lunalustig‘ / gestimmt bin (oder ‚wir‘ sogar zu werden
‚finden‘).“ ![]()
![]() Was mich [O.G.J.] interressieret, zumindest ‚motivational‘-genannt; also
am-antriebigsten ‚übertragen‘
gefürchtet: „Herrschaftsausübungen
des und/oder der, über den undװaber
die, Menschen.“
Was mich [O.G.J.] interressieret, zumindest ‚motivational‘-genannt; also
am-antriebigsten ‚übertragen‘
gefürchtet: „Herrschaftsausübungen
des und/oder der, über den undװaber
die, Menschen.“ ![]() ‚Restriktive
Gewalt‘ ist bei Weitem nicht Ihr wirksamstes Mittel – nur das teuerste. [‚Politik‘
insbesondere / wesentlich dadurch definiert, dass sie eine Vielzahl, zumal Menschen, gewaltsan
kontroliert elementar betrifft]
Reicht, so viele wie mäglichm oder einem
wichtig, durchaus schon?
‚Restriktive
Gewalt‘ ist bei Weitem nicht Ihr wirksamstes Mittel – nur das teuerste. [‚Politik‘
insbesondere / wesentlich dadurch definiert, dass sie eine Vielzahl, zumal Menschen, gewaltsan
kontroliert elementar betrifft]
Reicht, so viele wie mäglichm oder einem
wichtig, durchaus schon?

 Allegorisch
/ Emblematisch erkennbare, ‚markgräfliche‘ Turmspitze links im Foto unter jenen des höchsten Turms der Anlage. [Zwar kaum
ein
Allegorisch
/ Emblematisch erkennbare, ‚markgräfliche‘ Turmspitze links im Foto unter jenen des höchsten Turms der Anlage. [Zwar kaum
ein ![]() r/echter Menschenfreund, doch
‚kyn(ologisch)‘
r/echter Menschenfreund, doch
‚kyn(ologisch)‘ ![]() genug Sympathien / Freudigkeit auf einzelne(s) zu beschränken, sowie dritte Kathegorien zuzulassen
genug Sympathien / Freudigkeit auf einzelne(s) zu beschränken, sowie dritte Kathegorien zuzulassen
![]() – kein rein zynischer Menschenfeind
/ Schöpfungsvernichter
sein/werden
zu
müssen]
– kein rein zynischer Menschenfeind
/ Schöpfungsvernichter
sein/werden
zu
müssen] 
[Noch eine weitere Seite / Blickrichtungen vom Flaggenturm der Tauglichkeiten, über / als / an / auf Sinnfragen:
Des Werdens Kaiserturm lassen … Euer Gnaden bestimmen(!)
das ‚ wo, wie und was‘ … Eurerseits] Formen des Fluches (Genesis
3:17 בראשית) / ‚Grüßens / Servierens /
Verpacktseins‘ von bis zwischen Hochachtung
und Verachtung \ Segens (Genesis
2:23 בראשית) ändern sich / wir Menschen zwar durchaus ‚inhalts‘-korreliert verteilungsparadigmatisch – sind/werden so
aber weder das einde,
noch das ‚andere’ / weitere CHeT-‚davon‘-חית los!
 sic!/?/-/.-Buttlerette
präsentiuert: Oben, gleich unterm Dach, um diese Trias der Türme / Fragen
– Grenzen, Sinn und Werden – verläuft bekanntlich jeweils eine – ist / verdeutlicht es der Denken Obergegruiffe? –
Reihe von Öffnungen ganz herum. – Exemplarisch
hier nachstehend zu spezifizierende, also
definierte, Verhaltensweisen ‚von Menschen‘ repräsentierend/benannt:
sic!/?/-/.-Buttlerette
präsentiuert: Oben, gleich unterm Dach, um diese Trias der Türme / Fragen
– Grenzen, Sinn und Werden – verläuft bekanntlich jeweils eine – ist / verdeutlicht es der Denken Obergegruiffe? –
Reihe von Öffnungen ganz herum. – Exemplarisch
hier nachstehend zu spezifizierende, also
definierte, Verhaltensweisen ‚von Menschen‘ repräsentierend/benannt:
 (Als / Von
/ Weder, äh Wegen
/ Zu) welcher Art(en) ‚Achtung‘ Ihre Reverenz (jeweils / ‚stets‘) gehört, sei keiner (davon /
Person) anzusehen – noch zwingt ‚Erleben‘ / Essen dazu, dies
/ (Sie) so wie (wem) schmeckend anerkennend
/ bekennend / mustererkennend
mitzuteilen / zu ‚partikularisieren‘ versus zu verallgemeinen. [‚Als‘-Struktur
des Erkennens: ‚Perfektionistisches‘ und
‚Hoheitliche Unzulänglichkeiten‘ als Vorwürfe
/ Diagnosen ‚geglaubt‘, äh
‚dietrologia‘-servierte Bezeichnungen (für
manche sogar überraschend) unabhängig von des so Behaupteten /
Befürchteten / Erhofften ‚Vorliegens‘, wirksam ups propagierbar bis ablehnbar]
(Als / Von
/ Weder, äh Wegen
/ Zu) welcher Art(en) ‚Achtung‘ Ihre Reverenz (jeweils / ‚stets‘) gehört, sei keiner (davon /
Person) anzusehen – noch zwingt ‚Erleben‘ / Essen dazu, dies
/ (Sie) so wie (wem) schmeckend anerkennend
/ bekennend / mustererkennend
mitzuteilen / zu ‚partikularisieren‘ versus zu verallgemeinen. [‚Als‘-Struktur
des Erkennens: ‚Perfektionistisches‘ und
‚Hoheitliche Unzulänglichkeiten‘ als Vorwürfe
/ Diagnosen ‚geglaubt‘, äh
‚dietrologia‘-servierte Bezeichnungen (für
manche sogar überraschend) unabhängig von des so Behaupteten /
Befürchteten / Erhofften ‚Vorliegens‘, wirksam ups propagierbar bis ablehnbar]
Ein zuminedest insofern
durchaus anderes Beispiel, dass es über
imidividuelle, gleichwohl typische und gar
wählbare, Verhaltensweisen einzelner hinausgeht ‚diskutiert‘ Staatsversagen-Genanntes – mit zumindest nicht weniger
deutlichen Folgewirkungen
begrifflich-denkerischer Wahlenmtscheidungen wie/was genannt/gesehen/gegessen wird.
Gravierendste charakterliche ‚Schwäche‘/Stärk(ung)en-?: „Perfektionismus, mit heftigen Haupt- und Nebenwirkungen.“ דקדוק Daledzu wirft Jörg Lohr ein/vor:
 Genügt
es mir, (oder) um zu
empören? [‚Heftiger
Schlag‘ in English:
‘bashing‘] #olaf#jojo Neben / Zu G.P.s
Einsichten grammatikalischer Reverenzen bis musikalischer / Tee-zermonieller
Vollendungen durch ‚Seele‘ / Symetriebrechungen / Vertaktungsfehlerabsichten
Genügt
es mir, (oder) um zu
empören? [‚Heftiger
Schlag‘ in English:
‘bashing‘] #olaf#jojo Neben / Zu G.P.s
Einsichten grammatikalischer Reverenzen bis musikalischer / Tee-zermonieller
Vollendungen durch ‚Seele‘ / Symetriebrechungen / Vertaktungsfehlerabsichten![]() #jojo סליחה Perfektionistinnen seien Fanatiker – ‚ideale Männer‘
auch!
#jojo סליחה Perfektionistinnen seien Fanatiker – ‚ideale Männer‘
auch!  Disziplinfachleute gefragt-!/? [Wer von sich Perfektion verlangt, macht sich
unglücklich; und wer von anderen Perfektion erwartet, wird enttäuscht] Lückenmanagement
‚unabgewandt‘ Ideale
bis Ziele beibehalten.
Disziplinfachleute gefragt-!/? [Wer von sich Perfektion verlangt, macht sich
unglücklich; und wer von anderen Perfektion erwartet, wird enttäuscht] Lückenmanagement
‚unabgewandt‘ Ideale
bis Ziele beibehalten. 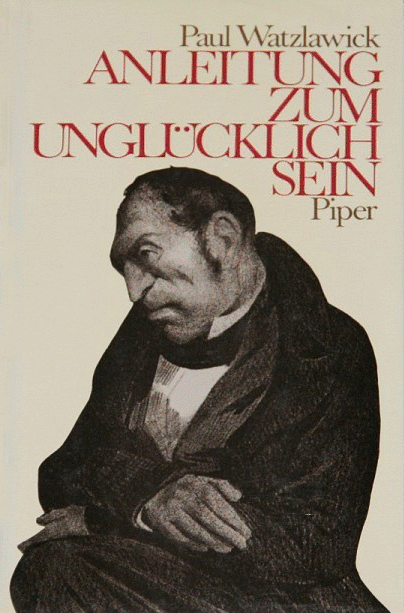
„Erfolgsbremse Perfektionismus
Perfektionisten leiden
[und lassen/machen leiden; O.G.J. kritisch ‚trotz‘ Sir
George]. Sie
sind nie zufrieden.
Sie verschwenden
Energie [sic! und sonstige Resourcen; O.G.J. ‚Scönheit‘ bis ‚Vollendung‘ zulassend]
mit Nebensächlichkeiten, denn
selbst die sollen perfekt gelingen. Perfektionisten können nur schwer Kompromisse schließen.
Sie verzetteln sich, werden nie fertig
[eben so wie diese Homepage; O.G.J.‘s]. Wenn dadurch Abgabetermine
verpasst werden, hat das böse Folgen [denn Gemeinwesen
steuern stets über / mittels (mehr oder minder ausdrücklich
gesetzte/n) Fristen; O.G.J. mit Martin
Buber nur ein
‚Geheimnis‘ ![]() der
Alternative/n zur summenverteilungsparadigmatischen,
‚ständigen Knappheit erträglicher
Lebenszeit‘ verratend: Vertiefung (statt Verlängerungsversuchungen)]. Meist scheitern sie an ihren
hochgeschraubten Ansprüchen – und
stellen prompt ihre ganze Person [bis ‚das Leben‘; O.G.J.] in Frage. Perfektionisten können
sich selbst [sic!] über Erfolge nicht freuen.
»Es hätte ja noch besser sein können [nein, müssen!; O.G.J. mitleidend].« Der Perfektionist wird sich selbst
zum Feind. Er lässt andere nicht an sich heran.
der
Alternative/n zur summenverteilungsparadigmatischen,
‚ständigen Knappheit erträglicher
Lebenszeit‘ verratend: Vertiefung (statt Verlängerungsversuchungen)]. Meist scheitern sie an ihren
hochgeschraubten Ansprüchen – und
stellen prompt ihre ganze Person [bis ‚das Leben‘; O.G.J.] in Frage. Perfektionisten können
sich selbst [sic!] über Erfolge nicht freuen.
»Es hätte ja noch besser sein können [nein, müssen!; O.G.J. mitleidend].« Der Perfektionist wird sich selbst
zum Feind. Er lässt andere nicht an sich heran.
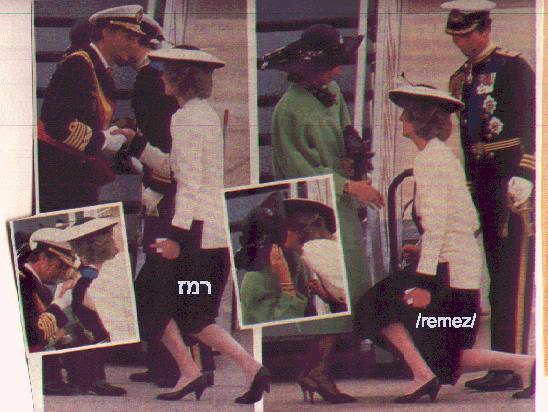 [Hinweise רמזים auf Perfektionismus(neigungen)
liefern, unter anderem, Tendenzen zum/des Auseinandersortierens (gar statt Zusammenordnens) vor/ohne Klärung/Beachtung zumal
aktueller Wesentlichkeitenhierachien]
[Hinweise רמזים auf Perfektionismus(neigungen)
liefern, unter anderem, Tendenzen zum/des Auseinandersortierens (gar statt Zusammenordnens) vor/ohne Klärung/Beachtung zumal
aktueller Wesentlichkeitenhierachien]  Immer noch/nur mehr Desselben, gar
Vertrauten, hilft eher selten
– außer es wurde gar bnicht
versucht / überzeugend gewollt.
Immer noch/nur mehr Desselben, gar
Vertrauten, hilft eher selten
– außer es wurde gar bnicht
versucht / überzeugend gewollt. 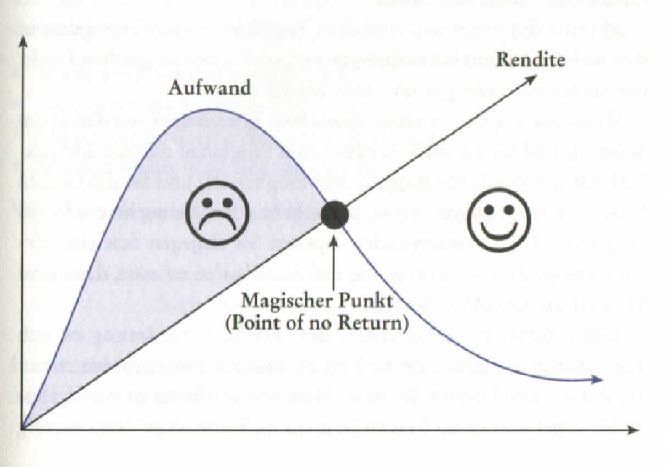 [Abnehmende Grenznutzen-Kurfen sogar/gerade bewährter Verfahrensweisen – widersprechen (nur פשע bis פשט / begrenzen allerdings) Vereinfachungen / Übertreibungen
/ Unterforderungen]
[Abnehmende Grenznutzen-Kurfen sogar/gerade bewährter Verfahrensweisen – widersprechen (nur פשע bis פשט / begrenzen allerdings) Vereinfachungen / Übertreibungen
/ Unterforderungen] 
Aber:
Nobody
ist perfect! Wenn Sie zum Perfektionismus
neigen, entwickeln Sie mehr Gelassenheit im Umgang mit
sich und anderen [Hinweise
dazu].“ (siehe
etwa auch: ‚Spielen Sie Ihre Stärken aus! Wie Sie das richtige [sic! ‚zufür/zu Euer Gnaden
passende‘; O.G.J. zumal Menschen für unterschiedlich haltend] Spielfeld finden, am Ball bleiben und erfolgreich [sic!]
werden‘, hier in sprachlicher Komprimierung der bekanntesten Erfolgstrainings des
FOCUs-Magazins, 2004, S. 54 f.;
verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
 [דרש – Was immerhin intellektuelle
(i.q.S.)
von autoritären/fanatischen Persönlichkeiten
unterscheiden mag]
[דרש – Was immerhin intellektuelle
(i.q.S.)
von autoritären/fanatischen Persönlichkeiten
unterscheiden mag] 
 [ÖkonomInnen hingegen, gleich gar am/vom ‚Institut für Wesentlichkeit‘ … finden
Zeit/en]
[ÖkonomInnen hingegen, gleich gar am/vom ‚Institut für Wesentlichkeit‘ … finden
Zeit/en] 
Antwort-Wache [zumal bei/gegen/wegen/für Perfektionismen,
Fanatismen etc.] die Kunst des
Scheiterns/Lückenmenagements.  [KoHeLeTs
[KoHeLeTs ![]() Wächterin präsentiert]
Wächterin präsentiert]
Denn längst nicht alle Eigenschaften sind / werden
in so beliebiger Art und Weise ‚tollerabel‘, dass überhaupt nichts gegen ‚Defizitte‘-Nennbares,
bis gar kompensativ daran vorbei / über Mängel
hinweg, unternommen werden kann,
oder vernünftigerweisen nicht dürfe, da /
falls / weil dies (mangels Talent / Idiocharisma / Geschlecht / Kapital pp.) bestenfalls ‚mittelmäßige Aussichten‘
– eben auf / in Richtung Vollkommenheit (oder wenigstens
diesbezügliche Stärke-Training, bis ups Überkompensationen)
– gäbe. 
[Freiin Marie bemerkt,
was die Vorherrschaft der Dummheit
erhält]
 Doch hoffentlich sind/werden
Mängel an ‘gentleness‘ Gelassenheit/en, respektive
gefehlt habende weise / intelligente Distanzen (wenigstens
eines ‚räumlichen‘/hunorigen Wahrnehmungsabstandes sich selbst gegenüber), keine notwendige,
da (in/aus einer weiteren
Sichtweise / Denkrichtung) immerhin eine mögliche,
bis manchmal sogar und\aber immerhin für/als
Stärke
Doch hoffentlich sind/werden
Mängel an ‘gentleness‘ Gelassenheit/en, respektive
gefehlt habende weise / intelligente Distanzen (wenigstens
eines ‚räumlichen‘/hunorigen Wahrnehmungsabstandes sich selbst gegenüber), keine notwendige,
da (in/aus einer weiteren
Sichtweise / Denkrichtung) immerhin eine mögliche,
bis manchmal sogar und\aber immerhin für/als
Stärke ![]() hinreichende (statt deterministisch erzwingende), Voraussetung / Kräftequellen um zu entwickeln / (‚Sonder‘-)Begabungen (an)erkennen:
hinreichende (statt deterministisch erzwingende), Voraussetung / Kräftequellen um zu entwickeln / (‚Sonder‘-)Begabungen (an)erkennen:
![]() aspektische Stückwerkscharketer/e des Vorfindlichen, bis
inkremantalistisch Möglichen(mee/hrs);
aspektische Stückwerkscharketer/e des Vorfindlichen, bis
inkremantalistisch Möglichen(mee/hrs);
![]() Mut/e zu
/des Lückenmanagment/s: gar Effektivitäten
(Wesentliches) der Effizienzs (optimal organisiertem Fluß) vorziehend;
Mut/e zu
/des Lückenmanagment/s: gar Effektivitäten
(Wesentliches) der Effizienzs (optimal organisiertem Fluß) vorziehend; ![]() kompromisshafte, bis achtsame,
Rücksichtnahmen zumal auf Fehlerqualitäten;
kompromisshafte, bis achtsame,
Rücksichtnahmen zumal auf Fehlerqualitäten; ![]() die Totalität/en des
Antitotalitarismus / (gar /chadasch/ חדש
erneuernden) Vollendens;
die Totalität/en des
Antitotalitarismus / (gar /chadasch/ חדש
erneuernden) Vollendens; ![]()
![]() «Nein» zumal /lo/; … Vergebungs(- gleich gar anstatt Entschuldigungs)bedarf.
«Nein» zumal /lo/; … Vergebungs(- gleich gar anstatt Entschuldigungs)bedarf.
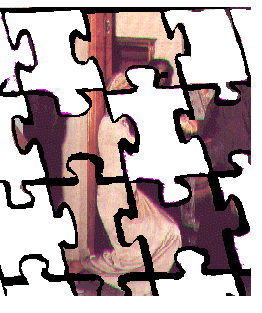 [… Dinge, Ereignisse und\aber sogar ups
teilnehmend Beobachtende eher dreifach
qualifiziert aufhebbar, denn ewig unabänderlich
bis auflösungspflichtig sind/werden]
[… Dinge, Ereignisse und\aber sogar ups
teilnehmend Beobachtende eher dreifach
qualifiziert aufhebbar, denn ewig unabänderlich
bis auflösungspflichtig sind/werden]
![]() Was ich/wir [O.&G.J.] ‚wolle/n‘:
„Eher von, im Leben(slauf) erfahren
respektive teilnehmend beobachten, ‘gentle‘-Freundlichkeiten
Was ich/wir [O.&G.J.] ‚wolle/n‘:
„Eher von, im Leben(slauf) erfahren
respektive teilnehmend beobachten, ‘gentle‘-Freundlichkeiten ![]()
![]() [‚Ein Schelm, wer etwas Arges dabei demkt‘] weitergeben, bis zu mehren, als bereits erlebte, gar masslose Lasten plus kontrasmaximale
Leiden
[‚Ein Schelm, wer etwas Arges dabei demkt‘] weitergeben, bis zu mehren, als bereits erlebte, gar masslose Lasten plus kontrasmaximale
Leiden ![]()
![]() [anstatt
[anstatt auf (‚Niemand verletzt mich
ungestraft‘-)Sätzewahrheit zu bauen] zurück zahlen.“ ![]() – So bleibt das (immerhin /tichon
äh tikun olamaot/ תיכון׀תיקון עולמות) nämlich – bei, und sogar
wegen, aller Mühe/n, den Reaktionen, vielerlei
Unbequemlichkeiten, heftigsten Widerständen usw. – deutlich weniger (an beliebig dehnbare) Arbeit.
– So bleibt das (immerhin /tichon
äh tikun olamaot/ תיכון׀תיקון עולמות) nämlich – bei, und sogar
wegen, aller Mühe/n, den Reaktionen, vielerlei
Unbequemlichkeiten, heftigsten Widerständen usw. – deutlich weniger (an beliebig dehnbare) Arbeit. ![]() [‚Strumpfband‘ des bevorzugten Ordens – gar ein/als Satz,
der nicht nur grammatikalisch so aussieht wie einer]
[‚Strumpfband‘ des bevorzugten Ordens – gar ein/als Satz,
der nicht nur grammatikalisch so aussieht wie einer] 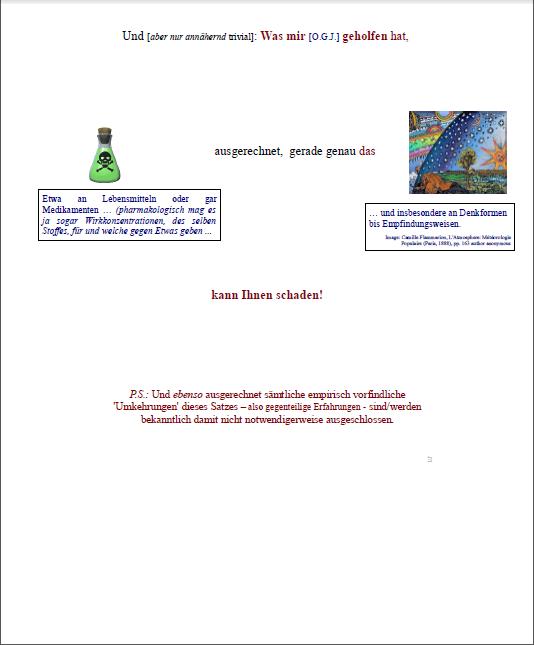 Aber
ja: s/Sie brauchen sollen uns nicht zu folgen. – ‚Ausgerechent und gerade wer/was uns helfe
kann/mag Ihnen schjaden!‘
Aber
ja: s/Sie brauchen sollen uns nicht zu folgen. – ‚Ausgerechent und gerade wer/was uns helfe
kann/mag Ihnen schjaden!‘
 Auf dem, und für manchen, Weg hinauf/herauf von der
Person zur Persönlickeit, finden
sich bekanntlich, heir (im
Markgrafenturn
Auf dem, und für manchen, Weg hinauf/herauf von der
Person zur Persönlickeit, finden
sich bekanntlich, heir (im
Markgrafenturn nicht) verborgene Wendeltreppemläufe. – Doch immerhin
teils/manchen auch …  [Alarmeinsatzrutschstange auf Erden – bereits/noch gegenwärtig משיח myself כנגדו]
[Alarmeinsatzrutschstange auf Erden – bereits/noch gegenwärtig משיח myself כנגדו]
Zu den
gängigsten Übeln gehört die Denkform:
„Da/Wenn andere (zumal, ‚eigene Leute‘. oder ‚das/mein Ego‘)
nicht (gar ‚denken‘) tun, was ich will
oder müße, äh ‚für alle richtig‘-
bis ‚nötig‘- /
‚wahr‘-halte – fragen diese nicht
nach Gott(esfurcht / Vernunftenwahrheit) – schon gar nicht vor meinem (einzigem/basalen Theorem); (bei) dem ich Vertragstreue schwöe /
dem wir uns – meines Erachtens, äh überzeugten
Gewissheitenwissens – verpflichtet habe/n, zum zu …“ Sie/Euer Gnaden erahnen schon (elementartste) Überleben(sfragen bis Un/Heils-Problemstellimgen).
 [Towers des Können- & Dürfens-Dopelflughafens]
D/Was ‚herunter-sprechen‘ kann/könnte also heißen:
[Towers des Können- & Dürfens-Dopelflughafens]
D/Was ‚herunter-sprechen‘ kann/könnte also heißen:
 [Wir hatten Komplexitäten
– im Griff]
[Wir hatten Komplexitäten
– im Griff]
‚Perfektionismus-Bäshing‘ (mehr oder weniger wovon Askese-Libertinismus-Fragen, zumal des Grammatik /dikduk/ דקדוק Pedanterie Masshaltens) und selbst gerade wesentliche ‚Idealisten-Wertschätzungen/Ideale-Bedienungsanleitung‘
 verfehlen,
mit/unter Intellektualität (im enger qualifizierten Sinne) Gemeintes/Repräsentiert(e Personen, Dinge und Ereggniss)e,
viel zu zuverlässig.
verfehlen,
mit/unter Intellektualität (im enger qualifizierten Sinne) Gemeintes/Repräsentiert(e Personen, Dinge und Ereggniss)e,
viel zu zuverlässig.  [Zu Geheimnissen/Folgen stets
‚als‘-struktur allen Erkennens gehört, dass/was bis wann/ob ein anderes Wort (nicht) aus der ‚Denkempfindens-Falle,
einmal für etwass/jrmand gefundener/verwendeter Begrifflichkeit/en bis Sichtweise‘, hilft]
[Zu Geheimnissen/Folgen stets
‚als‘-struktur allen Erkennens gehört, dass/was bis wann/ob ein anderes Wort (nicht) aus der ‚Denkempfindens-Falle,
einmal für etwass/jrmand gefundener/verwendeter Begrifflichkeit/en bis Sichtweise‘, hilft]
 [Inntelligenzen/Weisheit
sind nicht weniger nahe überlappend mit Intellektualität/‚spirituell-genanntem Denken‘ verbunden als Utopien/Ideale
– ohne eins und
dasselbe zu sein/werden]
[Inntelligenzen/Weisheit
sind nicht weniger nahe überlappend mit Intellektualität/‚spirituell-genanntem Denken‘ verbunden als Utopien/Ideale
– ohne eins und
dasselbe zu sein/werden]
Der/Des Intellektuellen ‚Kritik‘ – ‚das eine und/oder andere (spätestens ‚ästhetische‘)
Problem, mit den Dingen
und Ereignissen wie sie sind/werden
/ mit allem‘ zu haben – wird
allgemein, von/bei den (vielen) anderen ‚nicht-(derart-)intellektuellen‘ Leuten, als negativ
empfunden, obwohl (bis ‚gerade weil‘) es einem der höchsten Aus-/Eindrücke / intensivsten Forme(l)n von Liebe entspringt
– dass ‚Intellektuelle‘ gar nicht anders als
mißdeutbar können (zu empfinden brauchen).  []
[]
Hauptschwierigkeit bleibt wohl, das (fehlende
/ verstellend abgedunkelte) Entsetzen, äh Erwachen, der/des
Intellektuellen: dass die weitaus meisten anderen gar nicht gnau so
veranlagt/begabt sind alles
auch so zu halten/erleben. 
Namentlich
J.O. y G. dem wir hier,
E.R.W. 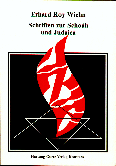 zitierend, weitgehend folgen, hat
es eher deutlicher heraus gearbeitet. – Was wir (zumindest aus Respekt vor menschlichen Entscheidungsfreiheiten)
zitierend, weitgehend folgen, hat
es eher deutlicher heraus gearbeitet. – Was wir (zumindest aus Respekt vor menschlichen Entscheidungsfreiheiten) nicht etwa
voraussetzend erwarten/zur
‚Pflichtlektüre‘ erklären, sondern ‚technologisch‘ verkürzt ‚vorgelesen‘, bis verlinkt, finden.
 Denn ‚solange lebt unsere
Hoffnung auf Erden‘, dass kein falsches
‚entweder oder
Denn ‚solange lebt unsere
Hoffnung auf Erden‘, dass kein falsches
‚entweder oder
– zwischen/von Geistigkeit/Vita
contempplativa/Denken und
![]() [verteilungskonfrontiert] Materie/Vita
activa/Handeln‘ –
[verteilungskonfrontiert] Materie/Vita
activa/Handeln‘ –
mehr am
‚Unterwegs Nachdenken/Studieren‘ verhindern muss.
 So unterscheiden sich / wir, namentlich durch
Wegweiseunktionen qualifizierte,
Furchten von überwältigenden (panisch/lähmenden) ‚Schrecken
vor den Ängsten‘ – wishing you
‘to (be able to) think in front oft the tiger‘.
So unterscheiden sich / wir, namentlich durch
Wegweiseunktionen qualifizierte,
Furchten von überwältigenden (panisch/lähmenden) ‚Schrecken
vor den Ängsten‘ – wishing you
‘to (be able to) think in front oft the tiger‘.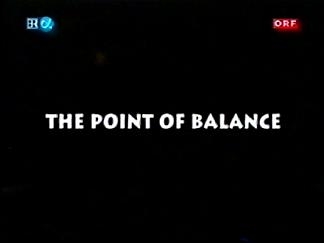

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sie haben die Wahl: |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Goto project: Terra (sorry still in German) |
|
|||
|
Comments and suggestions are always
welcome (at webmaster@jahreiss-og.de) Kommentare und Anregungen
sind jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss-og.de) |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
* |
|
|
|||
|
|||||
|
by |