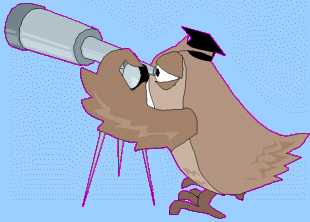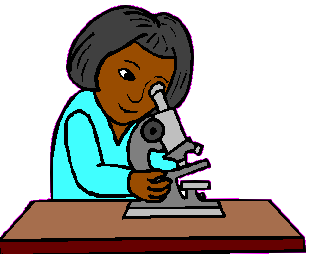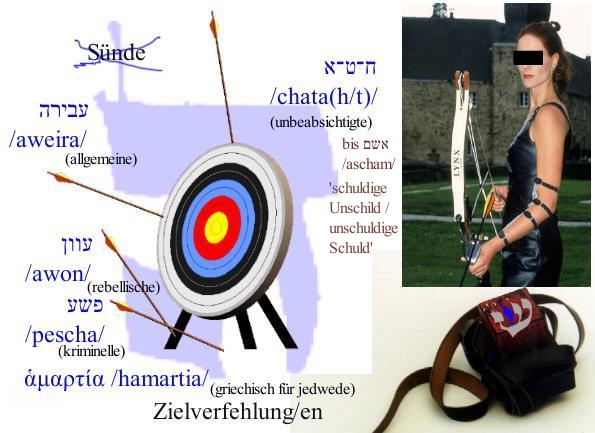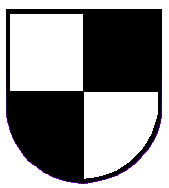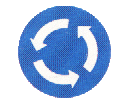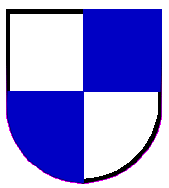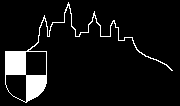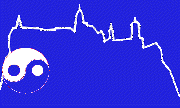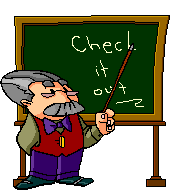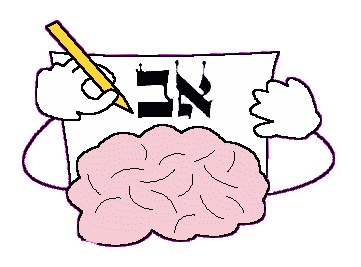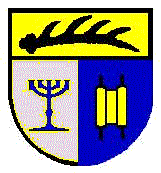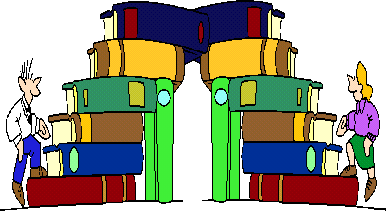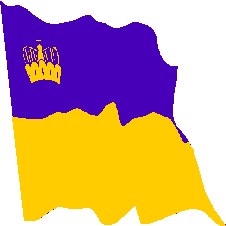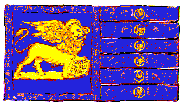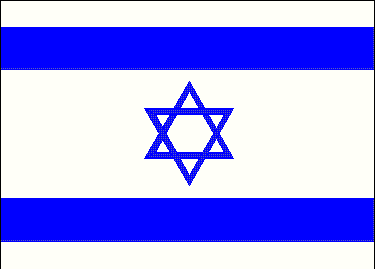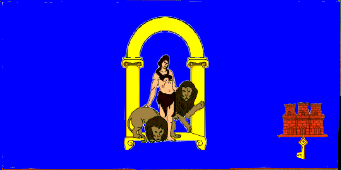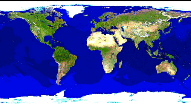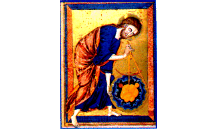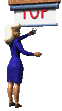‚Worte‘,
gar Ausdrücke, zumal
mancher ‚Achtsamkeiten‘ 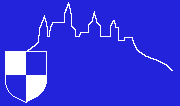 namentlich:
MiLoT
Ha-KeSeM מילות הקסם
namentlich:
MiLoT
Ha-KeSeM מילות הקסם
|
[Kompetent: „Weil ich [hier E.G.B. bis Wa.Le. – Historie mittels Semiotik] täglich Worten auf den Grund gehe und dort oft etwas ganz anderes vorfinde, als ich abtauchend vermutete.“ Hervorhebende Verlinkungen stets O.G.J.] Hübsch-/hässlich-!/?/-/. |
ק־ס־ם ‚Charme‘,
gar ‚Herzen‘ gewinnender ‚Zauber‘. quf/kof-samech-mem |
[Niemand geringeres als immerhin G’tt bereute undווaber vergibt sichווIhnen Menschen (gemacht זז erhalten) zu haben / gerade Sie, Euer Gnaden, zu wollen] |
Direkt über der Notwendigkeiten-Hallen und gleich unter dem wichtigsten und größten Saal des ganzen Hochschlosses gelegen, nahezu die gesammte Länge und Breite des Bedürfnisflügels der Achtsamkeiten ‚einnehmend, bis ausmachend‘, zwischen Burghof, Verhalten, Eignungen, Werden. Sinn und Erfahrung/en, eindrücklich über der Antreibe Bastion. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Die Fensterreihe unter den spitzbogigen, auch beider Türme, betreffend] |
|
[Innen, burghofseitig änderte sich, für diese heute gut gesicherte Schatzkammer, |
zwar auch hier (doch nicht wie ein Papiermodell seitenverkehrt vermeint) die Anzahl der Türen, gar zum jetzigen strategisch unaisweichlichen Portal der, einst wesentlich flächengrößeren, Schlossküche unterm ganzen Grafensaal, bis in des Vorfindlichen Verhalten hinein/hinüber] |
Die ups ehemalige
Schlossküche dieser |
|
|
|
|
|
 [Nordwestlich / oben links quer im
Grundriss mit beiden großen Türmen lag einst größte der Schlossjüchen, heute
weitgehend von der/als Schatzkammer genutzt – wäjrend due nordöstlich daneben
liegende Dienerschaftshalle nun als Küche fungiert – und
hier als unvermeidlicher Verhaltensraum ‚symbolisiert‘
…]
[Nordwestlich / oben links quer im
Grundriss mit beiden großen Türmen lag einst größte der Schlossjüchen, heute
weitgehend von der/als Schatzkammer genutzt – wäjrend due nordöstlich daneben
liegende Dienerschaftshalle nun als Küche fungiert – und
hier als unvermeidlicher Verhaltensraum ‚symbolisiert‘
…]  ‘
‘Sorry‘, jaein/‚Apfelkuchen‘: /slicha/ סליחה ![]() wir
wir ![]() sind
(gerade
in Wesentlichem) nicht etwa/
sind
(gerade
in Wesentlichem) nicht etwa/nur
gleicher/deckungsfähig komplementärerer Meinung/en,
(gar spontan/routiniert) passenden Empfindens bis (widerspruchslos miteinander
vereinbarer) Überzeugtheit,
sondern einigen uns (insofern
‚nur‘, wenn/falls total dann antitoralitär?/!) in Angelegenheiten/Verhaltensfragen
der Vertragstreue
auf das was wir tun & lassen.
‘Salutations‘
zwar kaum ausweichlich,
doch wahrscheinlich haben zumal Milady die
Qual der Wahl(en welche/wem/was/wie).  [Notwendigkeiten – die jene, die Bemerktes ‚regeln wollten‘ / politisch ‚ein- oder aufbrachten‘ nach
‚Niederlage / Verlierern (äh nichtrechthaberisch
qualifizierter Prophetie/Sozuialkritik;
vgl. ‚Sollbruchstellen‘-Logiken) aussehen
lassen‘, zumindest indem Gesolltes, bis Gewolltes, gar Getanes/Versäumtes,
mit/unter anderen Begrifflichkeiten bekannt/getarnt, bis durchaus plausibel
respektive zur Norm, gemacht – sind/werden
eher handhabbar/akzeptiert, auch falls ‚diese rote Linie‘/Gewissheit
rein ‚nur/immerhin‘
Probleme (im engeren/denkerischen Sinne), oder hyperreal( verhofft)e, Verhaltensfragen
betrifft/sucht] Klangvoll
scheppernde Rüstungsgüter/Worte/Dinge beeindrucken am/von/statt einer, der vorräumlich(
rot)en,
Zwischenwände.
[Notwendigkeiten – die jene, die Bemerktes ‚regeln wollten‘ / politisch ‚ein- oder aufbrachten‘ nach
‚Niederlage / Verlierern (äh nichtrechthaberisch
qualifizierter Prophetie/Sozuialkritik;
vgl. ‚Sollbruchstellen‘-Logiken) aussehen
lassen‘, zumindest indem Gesolltes, bis Gewolltes, gar Getanes/Versäumtes,
mit/unter anderen Begrifflichkeiten bekannt/getarnt, bis durchaus plausibel
respektive zur Norm, gemacht – sind/werden
eher handhabbar/akzeptiert, auch falls ‚diese rote Linie‘/Gewissheit
rein ‚nur/immerhin‘
Probleme (im engeren/denkerischen Sinne), oder hyperreal( verhofft)e, Verhaltensfragen
betrifft/sucht] Klangvoll
scheppernde Rüstungsgüter/Worte/Dinge beeindrucken am/von/statt einer, der vorräumlich(
rot)en,
Zwischenwände. 
 Innen - wohl( schwarz )verhängte, Denk(- bis rote, zumindest aber Tresor)wand- (zur/der, hier
sogar/immerhin semiotischen, Schatzkammer).
Innen - wohl( schwarz )verhängte, Denk(- bis rote, zumindest aber Tresor)wand- (zur/der, hier
sogar/immerhin semiotischen, Schatzkammer). 

Rote Linien – hier (erdgeschossgrundrisslich)
links und rechts, nein
westlich und östlich der Schatzkammer,
‚wandartig‘ hochgezogen/verhüllt – an, hinter, vor und gar von
denen Warn- bis Alarmierungsstufengeschrei, wo nicht sogar andere Handlungen,
ausgelöst werden sollen, bis müssen; und/oder wo automatische Messsysteme dies (nicht
ganz so zuverlässig wie Hunde, oder gleich gar
Gänse, doch eher unbestechlicher/undifferenziert) tun.
 Offenstehende Türe bei und mit vergitterten
Fenstern: Wo dereinst Speisen zubereitet. Ihnen/uns
gegenwärtig/allegorisch
Schätze serviert werden.
Offenstehende Türe bei und mit vergitterten
Fenstern: Wo dereinst Speisen zubereitet. Ihnen/uns
gegenwärtig/allegorisch
Schätze serviert werden.  [Draußen bekanntlich vielfältig vielzahlig drinnen bis ungeheuerlich
auch]
[Draußen bekanntlich vielfältig vielzahlig drinnen bis ungeheuerlich
auch] 
Das zu
denken und zu empfinden, bis zu tun
(respektive einem Reiz / Sendenden zu
verweigern), ‚was unter einem
Ausdruck/Eindruck verstanden gemacht/gesollt wird‘, ist so ziemlich (ein
– anstatt: genau) das Gegenteil-pro-dim dessen was ‚Gehorsam‘ – als/wo/wem dies
genaues, bis kritisches Zuhören bezeichnend/praktizierend – gewesen-je-inf. 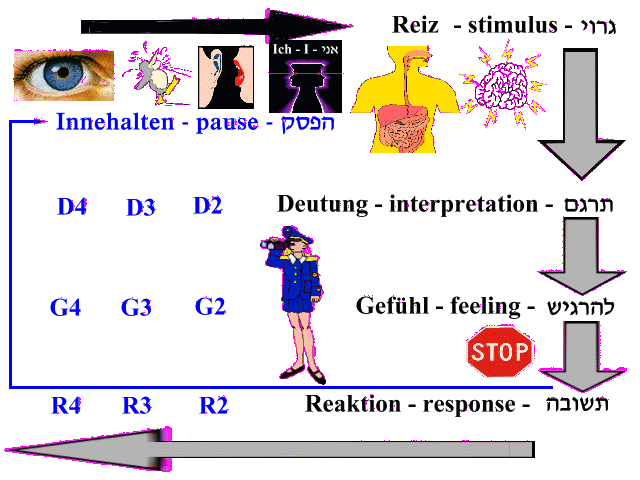
Dass sich zu ver- respektive überhaupt, gar/zumal selbsterelativierend,
zu beugen, und insbesondere falls/wenn/wieso/wo Knicksen / Knien (denkerisch / physisch / real l /
sichtbar / sprachlich / tuend / virtuell / vorgeblich – wie auch immer), schwer falle –
erwarten, kennen, unterstellen, vermuten und verstehen
/ wollten wir
durchaus (diesen
Aspekt nicht vereinzigend oder
verlangend).
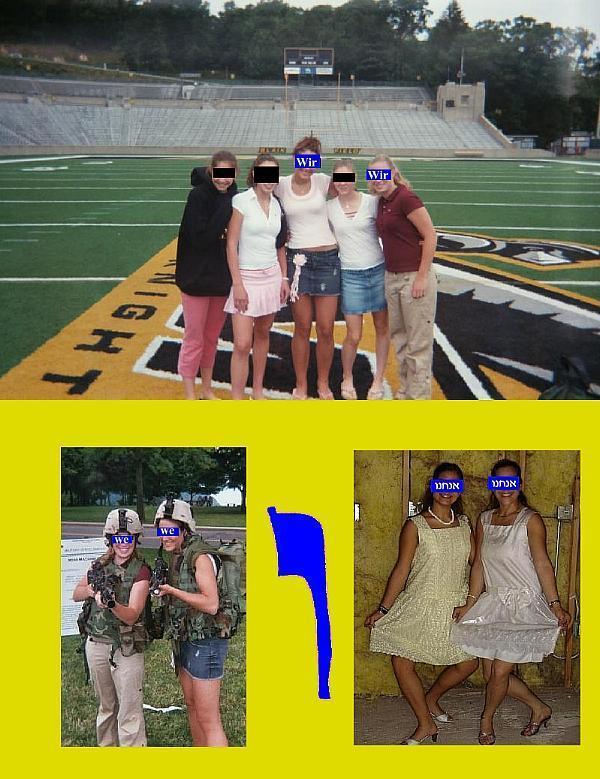 [Darum und zwischen -dem
wie Entweder-scharz--Oder-weiß/e- was empfangend-genannt/sendend-gemeint- mag es-H25 zwar Verhaltensvarianten geben] Und (welche( Drei (Blüte, Frohsinn, Glanz – Glauben, Hoffnung, Liebe –
ja, nein, unreduziert) erweisen Ihre/Ihnen Revenezen!/?-H27a#F/A
[Darum und zwischen -dem
wie Entweder-scharz--Oder-weiß/e- was empfangend-genannt/sendend-gemeint- mag es-H25 zwar Verhaltensvarianten geben] Und (welche( Drei (Blüte, Frohsinn, Glanz – Glauben, Hoffnung, Liebe –
ja, nein, unreduziert) erweisen Ihre/Ihnen Revenezen!/?-H27a#F/A 
Gerade סְלִיחָה weil/dass
wir Vergebungen (bis einschließlich Bereitschaft/en zu, zumal
weder dur4ch Vergessen noch durch beliebige Widerholungen desselben Ver- äh
Vorgehens, qualifizierter – etwa anstatt
willkürlich, gleichgültig beliedbiger, inflationärer, vorgeblich behaupteter.
Verlangbar-eingeklagter, hyperrealer pp.)
Entschuldigungen (SLiCHa- סליחה gleich gar von – zumal bedauerlichen / schlimmen / kriminellen – Sachverhalten
– ob eher mitverursacht oder wie auch immer zusammengefallen-H25h;
zudem H13-Irrtümer/Fehler-H27c von, und ‚über‘, Mensch für möglich bis
wahrscheinlich-H24‘Ostteil haltend) vorziehen
– bedeutet eher ups-höhere
Verletzbarkeiten und Täuschungsbeendigungsbereitschaft,
als gängig( inflationär)es Geplapper (gemurmelt suggeriert/verlangt: Unsere/Meine
Lust (auf- bis abschreckend-H29, warnend/erinnernd, anmutig/ermunternd,
kontrastmaximal, reizend, werbend, nachfragend, hoffend, liebend/hassend) zu mahnen/anzubieten
droht sich/Grazien in arroganten-ich-per (wofür auch immer sonst
noch gehaltenen, nicht nur klugen/weisen) Grenzen-H33 zu halten. #hierfoto  [Sie-innen – diese drei
Grazien – warteten-innen#Gartenbank
mit dem Servieren – wir-H33 mit dem Essen-H24a] #jojo Oder/Und basdaler: ‚Es ()
tun&tu () leind‘ – Sklaven bitten nicht um Entschuldigung, sondern um Strafe.
[Sie-innen – diese drei
Grazien – warteten-innen#Gartenbank
mit dem Servieren – wir-H33 mit dem Essen-H24a] #jojo Oder/Und basdaler: ‚Es ()
tun&tu () leind‘ – Sklaven bitten nicht um Entschuldigung, sondern um Strafe.
#hierfoto 
 Manche verwechseln/verkaufen/verzaubern Markt-Kritik und Staatskritik mit
Abschaffungsversprechen/Schrecken ökonomischer
Modalität.
Manche verwechseln/verkaufen/verzaubern Markt-Kritik und Staatskritik mit
Abschaffungsversprechen/Schrecken ökonomischer
Modalität.  [Begreifendes (haptisches/anschaulisches
bis begriffliches/semiotisches) Verstehen von Mauern (auch nur
jenen diese Hoschschlosses, oder blos
seiner Küchen, äh mur dirser erdgeschosslichen
Schatzkammer) verteilt werder eindeutig noch alle(s)
vollständig/restlos in/zwischen/unter -Entweder: Innen(ansichten/Bewusstheiten)-
[Begreifendes (haptisches/anschaulisches
bis begriffliches/semiotisches) Verstehen von Mauern (auch nur
jenen diese Hoschschlosses, oder blos
seiner Küchen, äh mur dirser erdgeschosslichen
Schatzkammer) verteilt werder eindeutig noch alle(s)
vollständig/restlos in/zwischen/unter -Entweder: Innen(ansichten/Bewusstheiten)-  -Oder: Aussen(fassaden- – allenfalls Mauern weitgend hinreichend
von Nichtmauern – soweit/sofern solche des/im Denken/empfindens … Sie,
Euer Gnaden wüssten schon?)]
-Oder: Aussen(fassaden- – allenfalls Mauern weitgend hinreichend
von Nichtmauern – soweit/sofern solche des/im Denken/empfindens … Sie,
Euer Gnaden wüssten schon?)]
 Diesseits
und jhenseits, eben abgesehen von der (mehr
oder minder geachteten – äh unverstellten, be- bis entkleideten pp.
‚Küchen-Ab-Fälle‘) Fassaden
Aussen-, Ober-, Unter- und Innenseiten sind/werden
(auch - drinnen) hier unten östliche und
westliche von roter Bedeutung/en.
Diesseits
und jhenseits, eben abgesehen von der (mehr
oder minder geachteten – äh unverstellten, be- bis entkleideten pp.
‚Küchen-Ab-Fälle‘) Fassaden
Aussen-, Ober-, Unter- und Innenseiten sind/werden
(auch - drinnen) hier unten östliche und
westliche von roter Bedeutung/en.  [‚Über/Nach/Hinter‘
des Daseins-/Verhaltems-Prachttreppe erkennbarer
Kaiserturm gegenüber Bischifstuermen bis unters
Ergeschoss vorhandenm anstatt immer/von überall für alle sichtbar /ajin/] Manche
erlauben bis lieben/ertragen Umwendungen.
[‚Über/Nach/Hinter‘
des Daseins-/Verhaltems-Prachttreppe erkennbarer
Kaiserturm gegenüber Bischifstuermen bis unters
Ergeschoss vorhandenm anstatt immer/von überall für alle sichtbar /ajin/] Manche
erlauben bis lieben/ertragen Umwendungen. 
Auch burghofseitig
und gerade verhaltensfaktisch bleibt
‚Vertragstreue‘/Selbst-Beschränkung
ein/des ‚Geschehens‘/Aktionssubjekts ups-äußerliche Angelegenheit; manche überrascht/empört eher noch mehr,
dassw/wie Gewissheiten, Irrtümer, Loyalitäten,
Oposition, Unfähikeiten/Unmöglichkeit (zu Nennendes) und somstige
Gesinnungsfragen ‚innerlich-motivational‘, zumal
sanktionsrelewant/Reaktionen-beeinflussend (gar eher ‚Strafmaße/Deutungen‘ als
‚Geschicke/Sachverhalte‘ beeinfluussend), dazu und/oder dagegen, doch vom
Geschehenen unterschiedbar bleiben (‚eigentlich müssten‘, anstatt dies immer zu
werden, oder wahrnehmender Unterscheidung zu bedürfen).  [‚Aussen‘ hinter der ‚mittleren‘ der
Fensterreihen auf Burghofhöhe, unterm Grafensaal und seinen Türmen: Loyalität und
Opposition (zudem nicht einmal diese immer unvereinbare Gegensätze) kann bis
wird äußerlich verborgen, Vertragstreue bleibt/wird jedoch immerhin äußerlich
beobachtbar]
[‚Aussen‘ hinter der ‚mittleren‘ der
Fensterreihen auf Burghofhöhe, unterm Grafensaal und seinen Türmen: Loyalität und
Opposition (zudem nicht einmal diese immer unvereinbare Gegensätze) kann bis
wird äußerlich verborgen, Vertragstreue bleibt/wird jedoch immerhin äußerlich
beobachtbar]
מִילָה
nf. word, expression, logo, term
nf. circumcision (comp. Abraham)
Das,
wenn auch zu häufig allein auf seine eine Seite als ‚Wort‘ reduzierte,
hebräische /dawar/ דבר damit
also die gemeinte ‚Sache‘ / der genannte ‚Gegenstand‘ gehört zwar ebenfalls,
doch eben nicht allein, zu den Bedeutungsreichweitenhöfen einer jeden Äußerung gar Ausdrücklichem, bis zumindest
Eindrücklichem.
 [/milot/ מילות – der oben balkon- bis terrassenartige ‚Altan‘ des, immerhin derart eindrücklichen Bischofsturms, dass er ins heutige Silhouetten-Wappen
[/milot/ מילות – der oben balkon- bis terrassenartige ‚Altan‘ des, immerhin derart eindrücklichen Bischofsturms, dass er ins heutige Silhouetten-Wappen
![]() der ehemaligen ‚zollerischen’ Residenzstadt
der ehemaligen ‚zollerischen’ Residenzstadt ![]() Hechingen unter
der Burg aufgenommen, drückt hier nämlich mehr/anderes, als immerhin Worte,
aus]
Hechingen unter
der Burg aufgenommen, drückt hier nämlich mehr/anderes, als immerhin Worte,
aus]
 [die zweitunterste Fensterreihe betreffend]
[die zweitunterste Fensterreihe betreffend]
 [‚Innen‘, gar
nicht so selten, von/durch Marktstände(n verstellt bis) inflationiert]
[‚Innen‘, gar
nicht so selten, von/durch Marktstände(n verstellt bis) inflationiert]  Manche (jedenfalls asiatischen) Verbalsprachen,
insbesondere sino-tibetische, inklusive kantonesisch oder mandarin, verfügen bekanntlich über ähnlich viele Ausdrucksmöglichkeitsvarianten bereits für/von ‚Entschuldigung‘
/ SLiCHaH wie Inuit (auch als ‚Eskimo’ diskriminierte Menschen indogener Ethnien
der Nordpolarregion) ‚Schnee‘ zu differenzieren haben – während und wogegen/dabei
(jedenfalls
manchmal/mancherorts, bis göobal/universal oder ‚begleitende‘/begleitete) nonverbale
Verbeugungs-Gesten eher
obligatorisch/‚einheitlicher‘ scheinen, bis wirksam, sind/werden.
Manche (jedenfalls asiatischen) Verbalsprachen,
insbesondere sino-tibetische, inklusive kantonesisch oder mandarin, verfügen bekanntlich über ähnlich viele Ausdrucksmöglichkeitsvarianten bereits für/von ‚Entschuldigung‘
/ SLiCHaH wie Inuit (auch als ‚Eskimo’ diskriminierte Menschen indogener Ethnien
der Nordpolarregion) ‚Schnee‘ zu differenzieren haben – während und wogegen/dabei
(jedenfalls
manchmal/mancherorts, bis göobal/universal oder ‚begleitende‘/begleitete) nonverbale
Verbeugungs-Gesten eher
obligatorisch/‚einheitlicher‘ scheinen, bis wirksam, sind/werden.
[Und nach ‚außen‘ bekanntlich kaum weniger heftig ausgebeult – eifern אליעזר manche den Knix/Reverenzen vegzuverbalisieren]
áL÷ Hi. aufmerksam hinhören (auf: ìàÆ oder ìÀ)
áLÆ÷Æ Aufmerksamkeit /keschew/
מק laugh
ספד klagen, (be)trauern
 [Wichtiger Ausdruck – gar (auch) von ‚Innerlichkeit/en‘
– können alle semiotischen ‚Zeichen‘/Symbole, namentlich etwa Kleider und Gesten (längst nicht auf verbalsprachliche beschränkt) werden,
und sein. –
In dem einst als Küche
eingerichteten Räumen, des hier analog
verwendeten Baudenkmals, ist ja schon
länger ‚s/eine Schatzkammer‘
untergebracht]
[Wichtiger Ausdruck – gar (auch) von ‚Innerlichkeit/en‘
– können alle semiotischen ‚Zeichen‘/Symbole, namentlich etwa Kleider und Gesten (längst nicht auf verbalsprachliche beschränkt) werden,
und sein. –
In dem einst als Küche
eingerichteten Räumen, des hier analog
verwendeten Baudenkmals, ist ja schon
länger ‚s/eine Schatzkammer‘
untergebracht] ![]() Dummer
Vorverurteilungen ist kein Ende, Mädels/Männer.
Dummer
Vorverurteilungen ist kein Ende, Mädels/Männer.
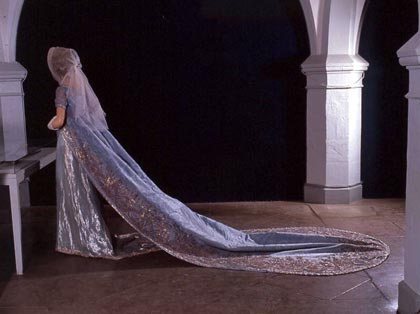
![]() Worte – also
nicht nur, oder erst damit mehr oder
minder zutreffend repräsentiert
ausdrückbares, Verhalten
– selbst und gerade solche der
Achtsamkeit,
Worte – also
nicht nur, oder erst damit mehr oder
minder zutreffend repräsentiert
ausdrückbares, Verhalten
– selbst und gerade solche der
Achtsamkeit,
sind immerhin manchmal sogar (wenigstens kleine,
bis erhebliche – doch kaum allein hinreichende) Taten,
sogar mehr oder minder aufmerksame; 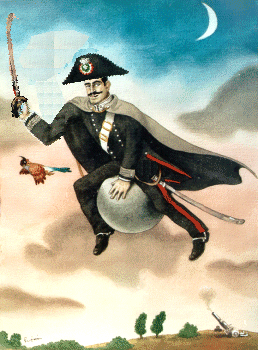 [Promot scheitern Versuchungen Sprache/n zu begrenzen / verbieten – entsprechend
heftig]
[Promot scheitern Versuchungen Sprache/n zu begrenzen / verbieten – entsprechend
heftig]
sind jedoch auch geeignet den/die Andere/n bis sich selbst,
gar erheblich, und in vielerlei Hinsichten, zu
stärken, bis zu missachten, zu verletzen und zu manipulieren. – Immerhin beleidigt zu
viel Höflichkeit (gar im Unterschied zu falscher Entschleunigung / ‚Entschuldigung‘)
niemanden, und erzwingt nichts.  [Zumal, durch erhöhte Respektsdistanz qualifizierte (doch
auch bloß/immerhin ‚brave‘), Artigkeit
– nicht einmal verpflichtet / bewirkt auf Beleidigt-sein / Empörung zu verzichten]
[Zumal, durch erhöhte Respektsdistanz qualifizierte (doch
auch bloß/immerhin ‚brave‘), Artigkeit
– nicht einmal verpflichtet / bewirkt auf Beleidigt-sein / Empörung zu verzichten]
#jojo
 [Sprachlich verstellter Korridorraum der/durch
Wort-Waffen Grammaticas vom Burghof der Schlossküche, äh Schatzkammer. Zum und
Mit Altansalon, äh Personalzimmer und Zwiegesprächem] Abb.
Waffebrüstungssammlung
[Sprachlich verstellter Korridorraum der/durch
Wort-Waffen Grammaticas vom Burghof der Schlossküche, äh Schatzkammer. Zum und
Mit Altansalon, äh Personalzimmer und Zwiegesprächem] Abb.
Waffebrüstungssammlung  Eben ‚hinter‘ der hier (ebrnfalls) offen stehenden Türe angehend.
Eben ‚hinter‘ der hier (ebrnfalls) offen stehenden Türe angehend. 
Durchaus im Widerspruch zu Menschen entblößen(d denütigen) s/wollenden ‚Sei-spontan‘-Paradoxien, zumal ‚intuitiv daherkommender Authentitizitätsforderung‘ ist bis wird, auch aufgesetzte, konzentrierte, bemüht( gepanzert)e – eben keineswegs willkürliche, sondern errungene, und insofern ‚beherrschte‘ (bis inklusive daher, äh drunten, als ‚oberflächliche‘ / ‚äußerliche‘ zu diffamieren versuchte/‚nötige‘) – Höflichkeit, ähnlich wie auch nicht immer (oder nur weil jemand diese selbst nicht bemerkt bzw. so empfindet) ‚mühelose‘ Achtsam- und Aufmerksamkeiten, dennoch bis deswegen eine ‚echte‘ und ‚richtige‘. Noch nicht einmal ‚Strategeme der List‘ anzuwenden ist notwendigerweise (auch und gerade explizit apostolisch/griechisch zitiert) verwerflich: So läßt es sich etwa keineswegs verbieten, den/die Anderen für das zu loben, was sie an einem nicht mögen, etc.pp.
[Abbs. Ansicht/Zeichnung vom Hof her]



![]() Pferd, Hengst /sus/ סוסה Stute /susah/
Pferd, Hengst /sus/ סוסה Stute /susah/
Worte bzw. Formen, insbesondere konzeptionellen und emotionalen Denkens,
vermitteln 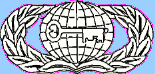 durchaus
– womöglich sogar inhaltlich/substanziell/essbar ‚Gold aus immerhin Silber‘ wickelnd –
zwischen Bedürfnissen drunten und Taten zumal ‚draußen‘ respektive Unterlassungen
oder Verfehlungen, auch, selbst
und gerade liebevoller Achtsam- bzw. der Aufmerksamkeit/en überhaupt.
durchaus
– womöglich sogar inhaltlich/substanziell/essbar ‚Gold aus immerhin Silber‘ wickelnd –
zwischen Bedürfnissen drunten und Taten zumal ‚draußen‘ respektive Unterlassungen
oder Verfehlungen, auch, selbst
und gerade liebevoller Achtsam- bzw. der Aufmerksamkeit/en überhaupt.
Nein, nicht einmal drüben des höchsten Sinn-Turmes am basalsten ausgebeulte Gefahren, vor allem drohender Beliebigkeit und Verfügbarkeiten, ihres - der jeweiligen Worte bis Gesten, eben als und da leere, doch eingeführte und verwendet werdende Formen –inflationären, masslosen Gebrauchs – namentlich befördert vpn, gar erzieherischen, Höflichkeits-Trainingseinübungen ständiger bis verselbstverständlichter Verwendung solcher Zeichen – verschwinden; auf Seiten der siesendenden/Verwendenden, durch ihres Charms oder Ungeschicks – von dessen, gar mit Ehrlichkeit verwechselten/vermischten, Spontanitäten und Authentizitäten (senderseitig) allerdings (empfängerseitig) recht bis (gar erstaunlicherweise) ganzunabhängig möglichen bis nötigen – hBetrachtung und Bewertung durch die Behavioreme/Verhaltensweisen wahrnehmenden Rezipienten.
Diese Leute sind, zumal falls sie Macht über, oder wenigstens Einfluss auf, insofern ‚ihre‘ sendenden Gegenüber haben nzw. s/wollen, sogar für Schmeicheleien – und nicht etwa nur harten Argumenten, oder angemessenen Respektsbezeugungen bis artigem Bitten gegenüber – empfangsbereit (und zwar, im Unterschied zu so manch vorherrschendem Verständnis von ‚empfänglich‘, ohne, dass mit solch ausgeübterer Wahrnehmungssensitivität bereits etwas über der Affizierung Wirkungsrichtung/Deutung, Bewertung und die Reaktion darauf predeterminiert oder entschieden).
Dazu, und gar etwas zur Ermunterung jener, die mit und
in Worten und/oder . Gesten weniger elegant, bis überzeugend, wirken (können
und/oder/aber wollen),
gehört komplementär vervollständigend
auch Matthias Claudius:
«Lerne gerne von andern, und wo von Weisheit,
Menschenglück, Licht, Tugend
etc. geredet wird, da höre
fleißig zu.
Doch traue nicht
flugs und allerdings, denn
die Wolken haben nicht alle Wasser, und es
gibt mancherlei Weise.
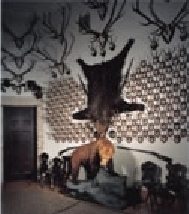 [Anschauungen \ DeWaRim / Sachen analog
[Anschauungen \ DeWaRim / Sachen analog ![]() ungleich Worte / דְּבָרִים / Menschen]
ungleich Worte / דְּבָרִים / Menschen]
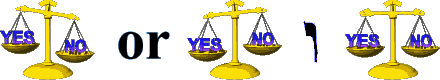
Sie meinen auch, dass sie die
Sache hätten,
wenn sie davon reden können und davon reden.
Das ist aber nicht so. Man hat
darum
die Sache nicht, dass man davon reden kann und davon redet.
 Worte sind nur Worte, und
wo sie sogar leicht und behände dahinfahren, da sei auf deiner Hut,
Worte sind nur Worte, und
wo sie sogar leicht und behände dahinfahren, da sei auf deiner Hut,  [Was viele wollen
sind brave Reverenz/Referenzen, bis dienstbare Gefolgschaft, was sie geboten …]
[Was viele wollen
sind brave Reverenz/Referenzen, bis dienstbare Gefolgschaft, was sie geboten …]
denn die Pferde, die den Wagen
mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes.»  Nicht nur
(droben) mancherlei Lieben, sondern auch
vielfältig vielzahlige Intelligenzen / Weisheit zu konstatieren.
Nicht nur
(droben) mancherlei Lieben, sondern auch
vielfältig vielzahlige Intelligenzen / Weisheit zu konstatieren.
 [Goldenes Evangelium immerhin zu San Marco in Venedig ‚urschriftlich‘ gelagert] ‚Synoptische‘ bis semitische ‚ Forschung‘
nicht notwendigerweise ausgeschlossen.
[Goldenes Evangelium immerhin zu San Marco in Venedig ‚urschriftlich‘ gelagert] ‚Synoptische‘ bis semitische ‚ Forschung‘
nicht notwendigerweise ausgeschlossen. 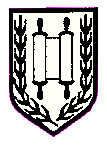
Um exemplarisch
nur einen prominennten Begriff des
(gerade/immerhin
nicht einmal ‚synoptischen‘) johanäischen Evangeliumsprologs aufzugreifen/zu
entblößen: ‚Am Anfang war das Wort, und
das Wort …‘ griechisch steht da bekanntlich jeweils
λόγος /logos/ geschrieben
– was sowohl ‚Wort‘ als auch, zumindest ‚logisch-vernünftiges
Denken‘ repräsentiert/bedeutet; also den gezeigten
Unterschied des Dichtes eindrücklich
kontrastklar zum Ausdruck bringen kann.  [Zu ‚der Zeitenwende‘ wurde übrigens
jpdischerseits alltäglich – zu
Verständigung wohl (auch als widerlegt geletende Auffassungen werdeb ja nicht
nur aus/in der historischen forschung besonders treu be- und ghewahrt) –
weniger Griechisch als Iwrit, und etwas seltener Aramäisch, gebraucht]
[Zu ‚der Zeitenwende‘ wurde übrigens
jpdischerseits alltäglich – zu
Verständigung wohl (auch als widerlegt geletende Auffassungen werdeb ja nicht
nur aus/in der historischen forschung besonders treu be- und ghewahrt) –
weniger Griechisch als Iwrit, und etwas seltener Aramäisch, gebraucht] 
‚Zurückversetzt‘ in/auf Hebräisch
/ in עִבְרִית würde dagegen wohl
der semitische Ausdruck /dawar/ דבר gebraucht werden (gewesen sein können,
bis dürfen), dessen Bedeutungenreichweitenhorizont zwar ebenfalls
‚Wort‘ und\aber doch zugleich auch ‚Gegenstand/Sache‘ umfasst/enthält; den dazwischen gemeinten/gesucht-gefundenen
Unterschied also relativierend oder
verschärfend, als dennoch, eben insgesamt
Gedacht/es, nicht etwa ‚zwingen( können)den‘,
enttarnt. – Doch ![]() [‚zu früh gefreut‘, indoeuropäische
Rechthaberei, so wie Iwrit-Bevorzuger]
[‚zu früh gefreut‘, indoeuropäische
Rechthaberei, so wie Iwrit-Bevorzuger]
auch
talmudisch findet sich der Gedanke (Allegorie bis Behauptung): G’tt habe (allegorische ‚Innerraumzeitlichkeit‘
unterstellend/vergottend) zunächst in ‚das Wort‘, seine Tora, gesehen und – gar gleich
in beiderlei Wortsinnen – ‚danach‘
die Schöpfung begonnen/\ausgeführt, ‚kabbalisiert‘ äh
überliefert. Ebenfalls diese deterministisch-freiheitsfeindliche
Steilvorlage des, gar/zumal ‚gnostischen‘, ‚Geist‘ der ‚Materie‘ vorziehen/überordnen
s/wollenden Versuchs, äh Versehend: Gott menschenartig zu
limitieren/zwingen (den vorgeblich offenkundigen ups Fehler/die
Dämonie der Schöpfung, zumal/zumindest
des/der missglückt-verfehlenden
Menschen / Futirum exaktums, ‚religio/zurück‘ … Sie wissen schon).  [Creazio
ex nihilo/אין סוף ermöglicht (zumal
dadurch ups vernünftig handelnde Verhinderung
des Eintritts ihrer alternativ/ansonsten drohenden
Szenarien) qualifizierte
Prophetie, inklusive Deutung/Verwendung von
Apokalyptischem]
[Creazio
ex nihilo/אין סוף ermöglicht (zumal
dadurch ups vernünftig handelnde Verhinderung
des Eintritts ihrer alternativ/ansonsten drohenden
Szenarien) qualifizierte
Prophetie, inklusive Deutung/Verwendung von
Apokalyptischem]
#hierfoto
_aside_her_husband_Madrid-zimbo-aGB2LDlxW4N.jpg) Sir
Armin warnte/weckt uns, dass auch noch
so kompetent( trefflich)es – also nicht ‚nur,
äh auf ‚jederlei‘, Medien-Niveau – darüber reden/davon wissen nicht
nur durchaus gegebene Einflussmöglichkeiten darauf suggeriert.
Sir
Armin warnte/weckt uns, dass auch noch
so kompetent( trefflich)es – also nicht ‚nur,
äh auf ‚jederlei‘, Medien-Niveau – darüber reden/davon wissen nicht
nur durchaus gegebene Einflussmöglichkeiten darauf suggeriert. _after_her_curtsy_to_the_Emir_Sheikh_Hamad_Bin_Khalifa_Al-Thani_with_Princess_Christina_(R)_and_hisbands_Madrid-Getty131877361.jpg) [Debatten
& Consorten –
nicht etwa, dass ‚Sprache‘ dafür/davon/dazu
bezaubernd, exakter, heilig, logisch-mathematisch präzise, überwältigend, äh überzeugend,vollkommen, zwingend sein/werden (könnte/)müsste – auch Berechnungen bis
Simulationen bleiben (ebenfalls, bis eher) Repräsentationen]
[Debatten
& Consorten –
nicht etwa, dass ‚Sprache‘ dafür/davon/dazu
bezaubernd, exakter, heilig, logisch-mathematisch präzise, überwältigend, äh überzeugend,vollkommen, zwingend sein/werden (könnte/)müsste – auch Berechnungen bis
Simulationen bleiben (ebenfalls, bis eher) Repräsentationen]
Des
Weeiteren (von / wegen / zu Deckungsungleichheiten zwischen Repräsentationen
und Repräsentiertem) bemerkt immerhin die
soziologische Forschung, zumal gesellschaftliche,
Tendenzen
/ Fehlschlüsse:,
Da
/ Wenn
(vergleichsweise ‚offen‘,![]() kontrastierend / eindeutig‘ respektive ‚tabuarm‘ empfunden, äh ‚wissend‘) über und von Etwas
(bis Jmand) geredet,
publiziert etc., bis gemurmelt,
wird,
zu vermeinen
(damit / dadurch immer) hinreichend bestimmenden Einfluss
auf die ‚dementsprechenden‘ Sachverhalte
(zumindest
/ zumeist aber auf die [künftigen] Verhaltensweisen
des jeweiligen und/oder sämtlicher
[unterworfener, äh
gutwillig-wahrhafter] Menschen) zu haben / nehmen.
kontrastierend / eindeutig‘ respektive ‚tabuarm‘ empfunden, äh ‚wissend‘) über und von Etwas
(bis Jmand) geredet,
publiziert etc., bis gemurmelt,
wird,
zu vermeinen
(damit / dadurch immer) hinreichend bestimmenden Einfluss
auf die ‚dementsprechenden‘ Sachverhalte
(zumindest
/ zumeist aber auf die [künftigen] Verhaltensweisen
des jeweiligen und/oder sämtlicher
[unterworfener, äh
gutwillig-wahrhafter] Menschen) zu haben / nehmen.
 [Eher noch
heftiger, als schon vermeintliche Einflüsse auf alles
worüber, für hinreichend kompetent gehalten, geredet werde – erweisen sich / wir
oft Erwartungen, bis Mühen, ‚jenes Empfinden‘ / Gemüts
/ Selbsteverständnis zu ändern, soweit und worauf wir, vermittels Denkweisen / ‚Sprache(n)‘./
Vorstellungswahlen durchaus weitgehende Einflüsse ausüben]
[Eher noch
heftiger, als schon vermeintliche Einflüsse auf alles
worüber, für hinreichend kompetent gehalten, geredet werde – erweisen sich / wir
oft Erwartungen, bis Mühen, ‚jenes Empfinden‘ / Gemüts
/ Selbsteverständnis zu ändern, soweit und worauf wir, vermittels Denkweisen / ‚Sprache(n)‘./
Vorstellungswahlen durchaus weitgehende Einflüsse ausüben]
Nicht etwa, dass immerhin / gerade das was ‚Politiker‘
und ‚Publizisten‘ (als Teilnehmer sogenannt ‚öffentlicher‘, gar in mancherlei Unterschieden etwa
zu ‚wissenschaftlichen‘ oder ‚administrativen‘, Debatten, bis schließlich als Gesetzgeber)
meinen, bzw.
sagen und schreiben, wirkungslos für die /
in den Vorstellungen der ‚Praktiker‘
(vgl. Horst
Baiers drei-Ps) sowie jenen der Bevölkerung/en wäre –
gleichwohl ist/wird es (so wenig sich z.B. Zeitgeist, Rechtslage,
Rechtsauffassungen, Urteil, Moralempfinden und Verhalten entsprechen)
kaum, bis nie, deckungsgleich, und gerade da bleiben Konflikte
zwischen den Orientierungen ‚Denken versus Handeln‘ relevant.
 ????Hier oder E.G.B. Charme/Zauber
Ambivalenzen????
????Hier oder E.G.B. Charme/Zauber
Ambivalenzen???? ![]()
 ‚Sogar‘, bis ‚gerade‘, der Anspruch / die Möglichkeiten der /tora/ תורה sind – jedenfalls solange und soweit in einer
semitischen Sprache verfasst und/oder rezipiert, eben deret-wegen –
davon zu unterscheiden, wie (zumal in vereindeutigenden, bis Bedeutungen singularisierenden, namentlich japhetischen, Alphabeten
geschriebene / gelesene) Texte, Gedanken prinzipiell
festgelegt zu verstehen erzwingen
s/wollen: Da Verstehensschwierigkeiten des /
von Hebräischen/iwrit
‚Sogar‘, bis ‚gerade‘, der Anspruch / die Möglichkeiten der /tora/ תורה sind – jedenfalls solange und soweit in einer
semitischen Sprache verfasst und/oder rezipiert, eben deret-wegen –
davon zu unterscheiden, wie (zumal in vereindeutigenden, bis Bedeutungen singularisierenden, namentlich japhetischen, Alphabeten
geschriebene / gelesene) Texte, Gedanken prinzipiell
festgelegt zu verstehen erzwingen
s/wollen: Da Verstehensschwierigkeiten des /
von Hebräischen/iwrit
zwar auch auf tonale und
Substitutionseigenschaften des Alefbets zurückgehen / beruhen, doch auch aus /
an Eigenschaften semitischer Wortwurzeln und der
Syntax resultieren / anknüpfen können.  Also Jungs?
Also Jungs?
 [Immerhin ‚Schülerinnen‘ und sei/wäre
es der
Sprache]
[Immerhin ‚Schülerinnen‘ und sei/wäre
es der
Sprache] 
‚Die‘ allerdings drei(erlei) zentralen sogenannten ‚Wunderwörter‘ (hebräisch MILOT HA-KESSEM – zumindest, bis gar nicht allein, des Charmes, oder etwa Zwangs, des Beeinflussens) lauten, bis zeigen (sind/werden also nicht etwa notwendigerweise), bekanntlich:
![]()
![]()
מילה
nf. word, expression, logo, term
|
Also weder /dawar/ ד־ב־ר als / für / von ‚Wort‘, äh ‚Ding‘; (ש"ע) מילה,
אבן הבניין
של השפה;
דיבור; שיחה
קצרה; אמירה; צו,
פקודה; ידיעה,
חדשה;
התחייבות,
הבטחה; סיסמה (ש"ע) שמות.
במאגיה,
מילים בעלות
כוח אלוהי
לחולל שינויים. verwendend bei
/ für / gegen / hier / wegen (O.G.J.):
|
![]()
![]()
קסם
nm.
charm, enchantment, fascination, captivation, glamor, glamour, [grace(fullness)? O.G.J. with E.G.B.]
lureravishment, winsomeness; magic, sorcery, spell, witchery, witching

Sogar, nein gerade, für
(diese) Menschen- bis Sachverhalte unverantwortliche Leute laufen erheblichste
Gefahren zumindest für deren mitteilende Darstellungen verantwortlich gemacht
zu sein/werden! – Wie viel mehr für schuldhaft (gleich gar an Auseinandersetzungen,
Störungen pp.) beteiligt gehaltene Personen-!/?/-/.
[![]() Today danced by graceful girls …] Kriegerischer
Schwerttanz heute ‚entschärt‘ durch / seitens hübsche/r Mädchen
‚erscheinender‘ harter Wettbewerb, regelgerecht
vor der Königlichen Tribüne ‚auf- äh durchgeführt‘.
Today danced by graceful girls …] Kriegerischer
Schwerttanz heute ‚entschärt‘ durch / seitens hübsche/r Mädchen
‚erscheinender‘ harter Wettbewerb, regelgerecht
vor der Königlichen Tribüne ‚auf- äh durchgeführt‘. 
|
תודה TODA! |
בבקשה BeWAKASCHA! |
סליחה SeLICHA! |
|||
|
תּוֹדָה (thanks, gratitude; thank you) [קשה – hard, difficult, tough, formidable, gordian, foul, labored, laborious, grueling, heavy,
gruelling; stiff, firm, gruff, horny, ironbound, leathery, petrosal, petrous,
rigid, rugged, scirrhous; severe, serious] |
בְּבַקָּשָׁה (please,
I ask / beg you,
kindly – interjection: gladly; why not,
O.K.) בַּקָּשָׁה (request, application, plea, wish, desire, appeal,
invocation, obtestation, solicitation, suit, supplication, behest) |
סְלִיחָה (pardon, forgiveness,
remittal, condonation; penitential prayer) סָלִיחַ (pardonable,
forgivable, excusable, atonable, atoneable – even: CHeT-זז׀ח) |
 [Denken, Knie, Köüfe.
Oberkörper und Spracjhen ließen sich weitgehende einzeln kombinierbar/kürzend
begereifen, äh beugen] Die Erzieherin, ach ja derzeit heiße/tut das
‚Influenzerin‘ macht es vor.
[Denken, Knie, Köüfe.
Oberkörper und Spracjhen ließen sich weitgehende einzeln kombinierbar/kürzend
begereifen, äh beugen] Die Erzieherin, ach ja derzeit heiße/tut das
‚Influenzerin‘ macht es vor. ![]()
![]()
![]()
![]()
‚Höfischkeiten’ – courteousness [אדיבות],
politeness
[נימוס; אדיבות], good manners [נימוס, דרך-ארץ], plus: mannerliness/ Manierlichkeit
, propriety/Anstand/Sitte, breeding/Erziehung/Aufzucht,
civility
[אדיבות], cordiality [לבביות], courtesy [מחוות
נימוס, אדיבות], debonairness [עליזות;
אדיבות], gallantry [אבירות; אומץ; גבורה;
שפע גינונים], gentleness
[עדינות;
רכות; נועם
הליכות;
אצילות;
מתינות],
compliment/bouquet [להחמיא
מחמאה,
קומפלימנט].
![]()
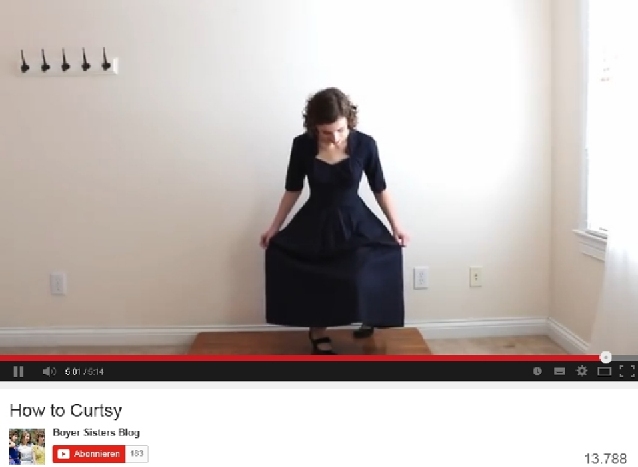 [Als/Für/In/Von höfischen Zeremonien seien bis
sind negere Formen des Raumverhaltens protkollarisch entwickelt und vorgegeben]
Verbalsprachen stellen werder die
einzige. Noch die wesentlichsten Gesten bereit – auch wo ‚akustische3r Ton‘
bedeutsam-
[Als/Für/In/Von höfischen Zeremonien seien bis
sind negere Formen des Raumverhaltens protkollarisch entwickelt und vorgegeben]
Verbalsprachen stellen werder die
einzige. Noch die wesentlichsten Gesten bereit – auch wo ‚akustische3r Ton‘
bedeutsam-
[Gerade/Immerhin
,die Heilsarmee’ hat es trotz, bis eben wegen, ihres Namens ‘Salvation Army’ kaum an Versöhnungs-
und Vergebungsbemühungen fehlen lassen] ‚Aus‘ Eurer / Ihrer /
meiner / seiner ‚Entstehungs‘-Zeit ‚heraus‘ zu können / kommen
falle eher selten leicht.  Thanks תודה /toda/ Dank,
weder immer leicht (vom ,nächs[s]t[ehend]en’ Begrifflicjkeitenfeld
abzugrenzen) noch stets gleich – und schon gar nicht nur gut bis
recht gemeint(e Beziehungspflegeversuche) respective gemacht(er
Knicks-Ersatz-Wahrnehmung/en).
Thanks תודה /toda/ Dank,
weder immer leicht (vom ,nächs[s]t[ehend]en’ Begrifflicjkeitenfeld
abzugrenzen) noch stets gleich – und schon gar nicht nur gut bis
recht gemeint(e Beziehungspflegeversuche) respective gemacht(er
Knicks-Ersatz-Wahrnehmung/en).  [‚Wie‘ verschieden sich ‚Dasselbe‘ (wann/wem/wen/wer/wo) anfühlt-!/?/-/. üben zwar die meisten Leute – allerdiongs eher exemplarisch] Rekordversuchungen.
[‚Wie‘ verschieden sich ‚Dasselbe‘ (wann/wem/wen/wer/wo) anfühlt-!/?/-/. üben zwar die meisten Leute – allerdiongs eher exemplarisch] Rekordversuchungen. 
להודות
v. to thank; confess, admit; plead (law)
[Um 1920 knixte diese junge
Heilsarmistin bei der Vorstellung ihrer neuen
Dienstbekleidung zeitgenössisch brav erwartbar, bis angemessen artig] Curtesying female Salvation Army member.

Request בבקשה /bewakascha/: Das, in einer Schreibweise optisch בְּבַקָּשָׁה na klar von rechts her, zweite ![]() massoretisch-bestimmte (unterstreichungsstrichartig aussehende) Vokalzeichen בַ patach ַ unter dem nun oft als wet ב gesprochenen otijot erklingt, wie in diesen Sprachen zumeist
danach, manchen manchmal eher als ups o-Laut (vom ׇ
ist Ähnliches ja eher/ohnehin bekannt, bis gegenwärtig normiert), oder wird eben als a-Laut aufgefasst; ohnehin סְלִיחָה verändern sich
/ ändern Menschen grammatikalische Regeln – doch zumindest in/von Israel werden Sie verstanden, wie (falsch
bis richtig – wem auch immer) es Euer Gnaden mit/bei/um bet-qo/uf-schin
ב־ק־ש bis gar blosem/leerem/hartem ק־ש (,Stroh’) halten/empfinden mögen.
massoretisch-bestimmte (unterstreichungsstrichartig aussehende) Vokalzeichen בַ patach ַ unter dem nun oft als wet ב gesprochenen otijot erklingt, wie in diesen Sprachen zumeist
danach, manchen manchmal eher als ups o-Laut (vom ׇ
ist Ähnliches ja eher/ohnehin bekannt, bis gegenwärtig normiert), oder wird eben als a-Laut aufgefasst; ohnehin סְלִיחָה verändern sich
/ ändern Menschen grammatikalische Regeln – doch zumindest in/von Israel werden Sie verstanden, wie (falsch
bis richtig – wem auch immer) es Euer Gnaden mit/bei/um bet-qo/uf-schin
ב־ק־ש bis gar blosem/leerem/hartem ק־ש (,Stroh’) halten/empfinden mögen.
לבקש
v. to ask; beg; seek, look for; wish
x
בקשה
nf. request, application, plea, wish, desire, appeal,
invocation, obtestation, solicitation, suit, supplication, behest
להקשות
v.
to make difficult; harden, ![]() stiffen, make hard; ask difficult questions; be stubborn
stiffen, make hard; ask difficult questions; be stubborn
x
להקיש
v.
to knock, beat, drum; type (on keyboard); infer, analogize; compare
x
להתקשות
v. to
harden, toughen; find difficult, have difficulties; be cruel
x
קש
nm.
straw, chaff, mulch
x
לנקוש
![]()
v. to
knock, strike, beat; ensnare, snare
x
הוקש
v. be
beaten, drummed; typed (on keyboard); be inferred, analogized; compared
x
הוקשה
v. be
made difficult; be difficult; be hardened, stiffened
x
לקשות
v. to
harden, solidify, be hard; be difficult
Abb, Klemmsteindigurentrias-Duenstmädchen??[Wenigstens eine/n Knix – Höflichkeitsparadoxa sehen
glöeichzeitig nach mehr (etwa: Ablehnung, Achtung, Angebot, Apell,
Besänftigung, Bitte, Distanz, Disziplin, Drohung [zumindest auch anders zu können/tun], Freiheit, Flehen, Frieden,
Gedpld, Gefolgschaft, Gnade, Liebe, Lücke, Mühe, Mut, Nähe, Pause, Respekt,
Rücksicht, Suvewränität, Treue,
Unterwerfung, Verlegenheit, Verschwendung, Vertrauensvorschuß, Wahrnegnunbg, Wohlgefühl, Wutkompensation, Zuneigung, Zustimmung – nicht selten irgendwo zwisch
polaren ‘Gegenteilen’ gemischt und ,Dasselbe’ wechselseitig unterschiedlich
erlebt / gedeutet / erinnernd / verwendet) aus(-/eindrückend) als Zeichen-Gesten ,sind’; und/aber der Repräsentationen/Symbole ,Wirkungen’
dennoch weniger (namentlich/zumindest; weniger
eindeutig) bleiben als wonach ,dren’ jeweilige
Deutungsreflexe / Verwendungen (noch so überzegend, bis
überrwältigt, oder gar konsensual)
aussehen/,veranlassen’] Solle denn ,wie/wozu Übergriffiges, äh יְשׁ (sendend) gemeint gewesen sei’ (oder gar ‘beabsichtigt war’ –beobachtend/urteilend) dämpfen
oder verschärfen,,wie/dass es יְשׁ / was gemacht, bis wechselseitig
(empfamgemd und\aber zumindest
,verarbeitend’) erlebt/erinnert
werde’-!/?/-/.  Entschuldigungen, überhaupt /slicha/ סליחה , unterschieden ,sich’/wir durchaus von Vergebung(sbitten zumal wechselseitig überhaupt
erfüllbaren, bis wirksam akzeptiert)en, und gleich gar von deren/wessen? Ausdrücken/Wirkungen! [Ohne Anwendungen restriktiven Zwangs erscheint,
bis erschien, zwar immerhin ein ‚erreichter‘/gezeigter Knicks bewirkbar]
Ihre//Wessen? zumal
‚falsche/n, bis wahre/n
Motiv-Gründe‘
bleiben übrigens sogar/gerade verborgen, wenn sie selbst (und/oder wer auch immer) welche,
respektive diese, ablehnt / bekennt / bemerkt.
Entschuldigungen, überhaupt /slicha/ סליחה , unterschieden ,sich’/wir durchaus von Vergebung(sbitten zumal wechselseitig überhaupt
erfüllbaren, bis wirksam akzeptiert)en, und gleich gar von deren/wessen? Ausdrücken/Wirkungen! [Ohne Anwendungen restriktiven Zwangs erscheint,
bis erschien, zwar immerhin ein ‚erreichter‘/gezeigter Knicks bewirkbar]
Ihre//Wessen? zumal
‚falsche/n, bis wahre/n
Motiv-Gründe‘
bleiben übrigens sogar/gerade verborgen, wenn sie selbst (und/oder wer auch immer) welche,
respektive diese, ablehnt / bekennt / bemerkt.
Excuse סליחה /slicha/ ,mögen Euer
Gnaden verzeihen?`: Entschuldigen / apology gehört
durchaus zu lexikalisch/wörterbüchlich
anerkannten  [Manche bemerken / behaupten / deuten, dass simo-tibetische
Sprachen – jedenfalls namentlich Kamtonesis und Mandarin. #jmlich viele verschieden
differenzierende Begrifflichkeiten für / von ‚Entschuldigung‘ verwenden (können,
bis dürtfen) wie dies Inuit für ‚Schnee‘,
respektive nomadische Ethnie ‚Sand‘ betreffend tun (um
indogen zu überleben)]
[Manche bemerken / behaupten / deuten, dass simo-tibetische
Sprachen – jedenfalls namentlich Kamtonesis und Mandarin. #jmlich viele verschieden
differenzierende Begrifflichkeiten für / von ‚Entschuldigung‘ verwenden (können,
bis dürtfen) wie dies Inuit für ‚Schnee‘,
respektive nomadische Ethnie ‚Sand‘ betreffend tun (um
indogen zu überleben)]
Bedeutungsspektrum der semitischen ,Wortwurzel’ ס־ל־ח samech(s Verborgenheitsqualit#ät)-lamed(s Lernerfahrung/en)-chet(s
beinahe Zerrissenheit/en zumal angesichts von Zielereichungsunsicherheiten) – ohne alleine
der/die/das einzige יחיד /jaxid/ sein/werden zu … סלח
סליח
adj. pardonable, forgivable, excusable, atonable, atoneable
לסלוח
v. to forgive, pardon
x
להיסלח
v. be forgiven, pardoned
x
סולח
(>>סֻלַּח)
v. be forgiven
‚Da(s) müssen Sie (schon) entschuldigen‘-Sätze, spätestens aber
Behauptungen / Erwartungen bringen viel
Charakteristisches zum Ausdruck:
Gerade diesen peinlichst entblößten Verrat (auch) noch/doch er-leutern zu
sollen, äh zu wollen, grenzt nahe an Ansinnen
einen Witz zu erklären – ‚nur‘, dass/soweit es k/einer ...

[Ach wieder so ein
böswillig, unverständlich verstörendes Missverstanden-Werden, meines
kommunikationsunwilligen Denkens] ![]()
Wer vermeint
– auch nur/immerhin wechselseitige – Vergebung
erzwingen zu können (auch nur Verzeihung / Entschuldigung [dafür/wofür] fordern zu dürfen/nüssen/sollen) – wird daher/schuldhaft, spätestens ob pandemisch
begeistert breiter Zustimmungen, jene/jede
Drohung ‚übersehen‘: Ich befürchte nämlich, sollte gar ich es überleben, noch gefährlicher/asozialer zu werden, als ich mich / Menschen bereits jetzt einschätze.Punkt  [Jedes der
NichtwissbarkeitsPrinzipien – nicht allein Gnadenangelegenheiten, bekanntlich zu einem, inzwischen immerhin,
‚Recht(sanspruch auf justiziable
Prüfung)‘ verbogen
erscheinende ‚Verpflichtung‘ (zur/der ‚Nächstenliebe‘ – Verzweckung um selbst welche ver- äh erlangen un-zu können, äh falls, bis da
wechselseitig, alle darauf angewiesen) – wird/ist
von/bei/durch Erzwingungsmacht verobjektiviert /
in seinem dazu befähigenden Wesenskern verfehlt, bis (von
mehr desselben Müssens) gestört/verstört/zerstört- Ausfallschritte mit/wegen
Maschinengewehr]
[Jedes der
NichtwissbarkeitsPrinzipien – nicht allein Gnadenangelegenheiten, bekanntlich zu einem, inzwischen immerhin,
‚Recht(sanspruch auf justiziable
Prüfung)‘ verbogen
erscheinende ‚Verpflichtung‘ (zur/der ‚Nächstenliebe‘ – Verzweckung um selbst welche ver- äh erlangen un-zu können, äh falls, bis da
wechselseitig, alle darauf angewiesen) – wird/ist
von/bei/durch Erzwingungsmacht verobjektiviert /
in seinem dazu befähigenden Wesenskern verfehlt, bis (von
mehr desselben Müssens) gestört/verstört/zerstört- Ausfallschritte mit/wegen
Maschinengewehr]  Reverenzen/Referenzen (inklusive ups-äußerlicher Respektsbezeugungen / salutations) sind erzwingbar, äh vernünftig, bis werden genügen ‚müssen‘ – auch
‚nur‘/immerhin ‚entschuldigende‘/duldende/kooperative Vergebungen
bleiben (hingegen auch bis
gerade obwohl ausgesprochen/symbolisiert) verweigerbar/frei.
Reverenzen/Referenzen (inklusive ups-äußerlicher Respektsbezeugungen / salutations) sind erzwingbar, äh vernünftig, bis werden genügen ‚müssen‘ – auch
‚nur‘/immerhin ‚entschuldigende‘/duldende/kooperative Vergebungen
bleiben (hingegen auch bis
gerade obwohl ausgesprochen/symbolisiert) verweigerbar/frei.
 [So
manch(
Zusammenhängend)es erscheint zwar manchen
willkürlich …]
[So
manch(
Zusammenhängend)es erscheint zwar manchen
willkürlich …]
Mehr noch
verstellen/verkennen omnipräsent inflationär gemurmelte Duldungs- bis Rache-verzichts-Apelle beide wesentlich( existenzgewissentlich)e Richtungen verzeihenden Vergebens (jene, gar seltener überhaupt
bemerke, eigener Existenz bis Verhaltensnotwendigkeiten,
wie jene der/des Ungeheuers der
Anderheit/en).  [… stellen/beantworten aber
eher
‚kulturelle‘ bis Bildungsfragen] סליחה ist es erst/schon
Sittenverfall, dass äh falls Formen-Wandel erkennbar?
[… stellen/beantworten aber
eher
‚kulturelle‘ bis Bildungsfragen] סליחה ist es erst/schon
Sittenverfall, dass äh falls Formen-Wandel erkennbar?
 „Knicks – und sag danke“. [(Wohl
nicht allein) Jenes
eine kleine Gedichtbändchen enthält bekanntlich allerlei Dankbarkeiten, ein ausdrücklicher Knicks, über
seinen ‚äußerlich( so auch illustriert abgebildet)en‘ Titel hinaus, findest sich darin סליחה hingegen gerade nicht] Abb, Shrly
Temple??? Des ‚Handschlags‘ womögliche Gleichheit(serscheinung – Analogie und
Symbolik) verbindet sich oft, bis unauffällig, ‚leicht‘ mit, bis zu, allerlei
Ungleichheiten.
„Knicks – und sag danke“. [(Wohl
nicht allein) Jenes
eine kleine Gedichtbändchen enthält bekanntlich allerlei Dankbarkeiten, ein ausdrücklicher Knicks, über
seinen ‚äußerlich( so auch illustriert abgebildet)en‘ Titel hinaus, findest sich darin סליחה hingegen gerade nicht] Abb, Shrly
Temple??? Des ‚Handschlags‘ womögliche Gleichheit(serscheinung – Analogie und
Symbolik) verbindet sich oft, bis unauffällig, ‚leicht‘ mit, bis zu, allerlei
Ungleichheiten.

Why do we say: 'Thank you very much' and mot
'Thank you very dreck'? – Ja, warum heißt es eigentlich:
‚denk you very Matsch‘ und nicht ‚Thank you very
Dreck‘?
װUnd: «‚Bitte‘ flieg von meiner Lippe!»
SaFaH שפה – Noch eines der vielleicht (jedenfalls gegenüber dem ‚seinen zumindest Töchtern
ein Beim zum Stolpern zu stellen’) סליחה
vergleichsweise gnädigen Formulierungs-Ergebnisse,
der Denkweise von/in ‚Wunder‘-Begriffen
oder Charm קסם quf-samech-mem (charm, enchantment,
fascination, captivation, glamor, glamour, lure, ravishment, winsomeness;
magic, sorcery, spell, witchery, witching) eng zusammenhängender, gar
‚Zauberwörtern‘ (der gar Fremd-Motivation) und der faktischer Rede- bis Verhaltensweise die
drei, namentlich sich selbst, dazu abverlangen zu
müssen, oder zu wollen. – Aber entschuldigen Sie, oder auch nicht: Auf, womöglich
für ‚natürlich‘ /
,selbstverständlich’ gehaltene, einen etwa
spontan alternativlos überwältigende, authentische Gefühlszustände
ver- bzw. angewisen
zu sein/werden; ist/wird noch weitaus hinterhältigerer
Manipulation zugänglich, als womöglich sogar aufgesetzte/instrumentelle bzw. antrainierte/inszenierte/wandungsbereite ‚um-zu‘ Höflichkeit/en.
[Ups-Hoppela,
wie bitte: ‚Ich entschuldige mich weder für meine Existenz,
noch für mein beabsichtigtes Verhalten’? – Meine Bedürfnisse
nach, bis Bitten um, zumal Ihre/Eure Vergebung sind/wären, auch deren Gewähr, oder
Ablehnung, bedeuten/betreffen, qualifiziert wesentlich anderes
als Schuld-Fragen, gleich
gar zu streichen / beendigen / aufzulösen / abzuschaffen / zu vergessen]  װAber:
‚Da/Dann müssen(!) Sie/du (schon, bis
sogar ‚bitter schön‘) entschuldigen!‘
Hört/Sieht wer, sich überhaupt (selbst[ distanziert], dabei zu? Spätestens wer
Nachsicht/en, bis sogar Vergebung/en,
einfordert/reklamiert? – Klar kann Macht (wer dies will) auf Worten, Formen
usw. bis bestimmten Taten (des/der Gegenüber/s – z.B.
‚Gefühlsäusserungen‘ inklusive) bestehen, und zumal – gar eher
willkürlich oder vernübftig –
darüber bestimmen: wann, bis wem/wofür, sie welche anerkennt, oder verweigert –
doch eher selten nur mit – zumal all- bis
wechselseitig – erwünschten Folgen.
װAber:
‚Da/Dann müssen(!) Sie/du (schon, bis
sogar ‚bitter schön‘) entschuldigen!‘
Hört/Sieht wer, sich überhaupt (selbst[ distanziert], dabei zu? Spätestens wer
Nachsicht/en, bis sogar Vergebung/en,
einfordert/reklamiert? – Klar kann Macht (wer dies will) auf Worten, Formen
usw. bis bestimmten Taten (des/der Gegenüber/s – z.B.
‚Gefühlsäusserungen‘ inklusive) bestehen, und zumal – gar eher
willkürlich oder vernübftig –
darüber bestimmen: wann, bis wem/wofür, sie welche anerkennt, oder verweigert –
doch eher selten nur mit – zumal all- bis
wechselseitig – erwünschten Folgen.
 Abgelegen erscheinende Aspekt
bleiben dennoch welche. [Gerade soweit/wo סְלִיחָה Ausdruck für/vom Bedauern bis Reue (oder gar
mehr) – bleiben Repräsentationen
vom Repräsentierten verschieden/zu unterscheiden] Auch Beschwichtigungseinflüsse, ‚Ehren/Freundlichkeiten‘
und Provokationswirkungen ‚veranlassend‘.
Abgelegen erscheinende Aspekt
bleiben dennoch welche. [Gerade soweit/wo סְלִיחָה Ausdruck für/vom Bedauern bis Reue (oder gar
mehr) – bleiben Repräsentationen
vom Repräsentierten verschieden/zu unterscheiden] Auch Beschwichtigungseinflüsse, ‚Ehren/Freundlichkeiten‘
und Provokationswirkungen ‚veranlassend‘.
Wesentliche Irrtümer bleiben:
Entschuldigung(skmivkse,
äh Höflichkeiten / ‚Rückzug‘ – zumal wegen
Vorstehendem / Nachstehendem) für Ansprüche-mindernd(e Streitverzichte / devot ‚reinigend‘ demütigend), für falsch/schlecht oder etwa für überflüssig/Verschwendung, äh für zwingend, halten zu müssen. Wobei auch/bereits erzwungene,
oder inflationär verbrauchte (äußerlich[
arogante / bloße / erpresste / formelle /
leere / mühelose / routinierte / verbale / vortäuschend]e Sprachformen), eben
nicht ‚umsonst‘ sind/werden
(nicht
einmal empfangsseitig, in allen
Bedeutungshorizontreichweiten von Kostenaspekten).
 Na gut – vielleicht ‚verga/ebe‘ ich immerhin Ihnen meine Existenz-!/?-/.
Na gut – vielleicht ‚verga/ebe‘ ich immerhin Ihnen meine Existenz-!/?-/.
 [/slicha/ סליחה-Geheimnisverrat: Solange (zumal) Gehandelt-habende und/oder
sich/andere-Betroffen-empfindende sich nicht jeweils ups (qualifiziert) selbst
vergeben (tun), hilft diesen überhaupt nichts
/ niemand (namentlich weder
[/slicha/ סליחה-Geheimnisverrat: Solange (zumal) Gehandelt-habende und/oder
sich/andere-Betroffen-empfindende sich nicht jeweils ups (qualifiziert) selbst
vergeben (tun), hilft diesen überhaupt nichts
/ niemand (namentlich weder Opfer /
Entschädigung / Artigkeiten, noch Ästhetisches, bis ‚Grazie‘ / ‚Heilsgüterzusagung‘
/ Wahrheit oder Rache bis Strafenvollzug)] Grenzenränder
von Bereitschaften versus Weigerungen: Dir/mir/uns (tzumal meine) Existenz, bis ‚dem‘ Gemeinwesen seine, zu vergeben –
liegen aktivierbar nahe hinter und vor diesbezüglichen (überhaupt) F#higkeiten / Lernerlaub-, äh -bedürfnissen.  [Ich weiß gar nicht, ob es – außer Euch/Ihnen – etwas gibt, das überhaupt keine Nachteile hat; zwar kann mein
Dasein/Agieren für verfehlt, bis verwerflich, gehalten werden
oder es sein, doch erleichtere
dies weder Dein/mein noch andere/r
Leben חיים] Knicksen
und Weitergehen – fällt ja gar nicht
leicht, je mehr Anlass …, äh
welcher Seite auch immer,
...
[Ich weiß gar nicht, ob es – außer Euch/Ihnen – etwas gibt, das überhaupt keine Nachteile hat; zwar kann mein
Dasein/Agieren für verfehlt, bis verwerflich, gehalten werden
oder es sein, doch erleichtere
dies weder Dein/mein noch andere/r
Leben חיים] Knicksen
und Weitergehen – fällt ja gar nicht
leicht, je mehr Anlass …, äh
welcher Seite auch immer,
...  [Gar
nicht so wenige bemängeln ‚gnädig zu sein/werden‘ um begadigt
werden zu können, bis bemäkeln Gnade
nicht ‚hirokratisieren‘/verlangen zu können] Gnade und Verzeihen sind zwar nicht dasselbe, bekommen und haben jedoch
teilweise verdächtig viel miteinander zu tun.
[Gar
nicht so wenige bemängeln ‚gnädig zu sein/werden‘ um begadigt
werden zu können, bis bemäkeln Gnade
nicht ‚hirokratisieren‘/verlangen zu können] Gnade und Verzeihen sind zwar nicht dasselbe, bekommen und haben jedoch
teilweise verdächtig viel miteinander zu tun.
Vergebung ![]() Vergeblichkeit/Verschwendung
Vergeblichkeit/Verschwendung
![]() Vergessen
Vergessen ![]() Verjährung
Verjährung ![]() Versöhnung
Versöhnung ![]() Rettung
Rettung ![]() Liebe/Lernen
Liebe/Lernen ![]() Erlösung
Erlösung
![]() Erinnerung:
Erinnerung:
Wir, jedenfalls ich,
vergebe/n, (‚inzwischen‘ / ‚versühnt‘ – zumal
nicht gleich, oder nur, ohnehin geliebten Menschen/Personen/Wesen)
sogar überraschen mögend, gerne – zumal
Fehler!  Bekenntnis: Bei/בּ\Mit der
Existenz, spätestens aber ‚dem (jeweiligen)‘ Verhalten, von ‚Anderheiten/Gleichheit‘ fällt mir dies
eher schwerer! [Der Vorschlaghammer
jedoch: Nicht erst ‚nach katastrophalen, bis
in/von pandemischen, Krisen‘ ggäbe/gibt es erheblichen, gar wechselseitig(
individuell ungleich)en, gemeinwesentlichen Vergebungsbedarf (‚handzuhaben‘-zu-müssen – namentlich
unbefriedigt, äh-ups unerfüllt/verbal bleibenden)
– Hauptschwierigkeit bleibt, dies/en
einfordern/‚erhalten‘ zu s/wollen, gar zu
vermeinen jedes/ein/das ‚Nichtwissensprinzip‘
(anderen
/ Gott / Realitäten / sich) verordnend
erzwingen zu müssen
/ können / dürfen] Gemeinwesen / Hoheiten / Macht gegenüber
bleiben Vergebungsfragen,
nicht erst dann noch virulenter,
wenn/weil und soweit diese
sich unhöflich bis unzureichend verhalten – oder dafür/wogegen gehalten werden!
Bekenntnis: Bei/בּ\Mit der
Existenz, spätestens aber ‚dem (jeweiligen)‘ Verhalten, von ‚Anderheiten/Gleichheit‘ fällt mir dies
eher schwerer! [Der Vorschlaghammer
jedoch: Nicht erst ‚nach katastrophalen, bis
in/von pandemischen, Krisen‘ ggäbe/gibt es erheblichen, gar wechselseitig(
individuell ungleich)en, gemeinwesentlichen Vergebungsbedarf (‚handzuhaben‘-zu-müssen – namentlich
unbefriedigt, äh-ups unerfüllt/verbal bleibenden)
– Hauptschwierigkeit bleibt, dies/en
einfordern/‚erhalten‘ zu s/wollen, gar zu
vermeinen jedes/ein/das ‚Nichtwissensprinzip‘
(anderen
/ Gott / Realitäten / sich) verordnend
erzwingen zu müssen
/ können / dürfen] Gemeinwesen / Hoheiten / Macht gegenüber
bleiben Vergebungsfragen,
nicht erst dann noch virulenter,
wenn/weil und soweit diese
sich unhöflich bis unzureichend verhalten – oder dafür/wogegen gehalten werden!
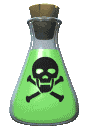 [(‚Fairness /
Verhältnismäßigkeit‘) oder, bis ‚aber‘ (immerhin ‚Transparenz‘ des/von Verwaltungshandeln/s zu erwarten – ist/wird zwar hyperreal verbreitet / verkündet / vermeint / vermisst / versprochen, jedoch
vergiftet, äh verdorben): Verstünden / Deuten, bis akzeptieren / diagnostizieren wir, dass Hoheit (zu) viel Arbeit haben – verstehen
manche, wer nicht ‚motivierbar ‘: zum
dritten Mal aufgefordert werden zu
dürfen/wollen, die bereits abgegebene Erklärung abzugeben (zu haben)]
[(‚Fairness /
Verhältnismäßigkeit‘) oder, bis ‚aber‘ (immerhin ‚Transparenz‘ des/von Verwaltungshandeln/s zu erwarten – ist/wird zwar hyperreal verbreitet / verkündet / vermeint / vermisst / versprochen, jedoch
vergiftet, äh verdorben): Verstünden / Deuten, bis akzeptieren / diagnostizieren wir, dass Hoheit (zu) viel Arbeit haben – verstehen
manche, wer nicht ‚motivierbar ‘: zum
dritten Mal aufgefordert werden zu
dürfen/wollen, die bereits abgegebene Erklärung abzugeben (zu haben)]
 ‘Right
or wrong it’s‘
not ‚my country‘ aber ob ich ihm/wem/wie gehöre(n darf/kann/muss/soll/will) ist/sei/wird nicht gefragt! – Warnt doch bereits KpHeKLeT welch zweifelhaftes Interesse, dass/falls/weil Behören /
Herrschende / InfluenzerInnen, äh
‚Medien‘ / ‚Populismen an‘ einem … Sie wissen schon.
‘Right
or wrong it’s‘
not ‚my country‘ aber ob ich ihm/wem/wie gehöre(n darf/kann/muss/soll/will) ist/sei/wird nicht gefragt! – Warnt doch bereits KpHeKLeT welch zweifelhaftes Interesse, dass/falls/weil Behören /
Herrschende / InfluenzerInnen, äh
‚Medien‘ / ‚Populismen an‘ einem … Sie wissen schon.
Wir
entschuldigen/verzeihen hingegen kaum, undװaber wenn, dann keinerlei (auch/zumal
kein noch so richtiges) Verhalten (allenfalls
Wesen, namentlich
Menschen, die unseres Erachtens abweichend
oder unzulänglich, bis falsch, handelten, respektive eher Abstände mehrend ‚uns bei/von
diesen‘); zudem, vielleicht noch schlimmer wirkend / schockierender:
Nichts
davon mit Vergehen
oder/durch/als Vergessen verwechselnd,
oder (durch
seine
Wiederholungsvarianten / Vermeidungsstrategien) ersetzend, bis
voraussetzungslos (nicht einmal von
meiner/unserer Gegenwart) erlösend.  Erlösung/en, ja
wovon denn bitte? – von Ihrem Dasein,
Euer Gnaden? oder nur/immerhin von meinem? [So richtig
heftig geht שי/Es\יש bereits bei Verwechslungen, bis Gleichsetzungen, von ‚Erlösung/en‘ mit ‚Vergebung‘,
oder gleich gar Bevorzugungen von Errettung / Befreiung – zu Lasten / ganz ohne Vergebung
/ Versöhnung(stage –
Erlösung/en, ja
wovon denn bitte? – von Ihrem Dasein,
Euer Gnaden? oder nur/immerhin von meinem? [So richtig
heftig geht שי/Es\יש bereits bei Verwechslungen, bis Gleichsetzungen, von ‚Erlösung/en‘ mit ‚Vergebung‘,
oder gleich gar Bevorzugungen von Errettung / Befreiung – zu Lasten / ganz ohne Vergebung
/ Versöhnung(stage – ![]() Yom Kipur יוֹם
כִּפּוּר auf Erden / gar
unter Lebenden), her: Hier sind wir bekanntlich so
‚a-sozial‘, uns weder für/gegen unsere (zumal Raum
bis Ressourcen einnehmende, bis ärgern könnende) Existenz,
noch gegen/für unser (gar von Erwartungen, zumal
unerfüllbaren – auch/zumindest eigenen) abweichendes Aussehen, bis (in der
erfolgten Art und Weise beabsichtigtes,
auch-‚Handeln‘-genanntes)
Verhalten, zu entschuldigen;
sondern wir bitten,
zumal mit-בּ Reverenz auch – allerdings ergebnisoffen – Euer Gnaden / Sie, um ‚Vergebung
von Schuld‘! Erpressen nicht einmal (
Yom Kipur יוֹם
כִּפּוּר auf Erden / gar
unter Lebenden), her: Hier sind wir bekanntlich so
‚a-sozial‘, uns weder für/gegen unsere (zumal Raum
bis Ressourcen einnehmende, bis ärgern könnende) Existenz,
noch gegen/für unser (gar von Erwartungen, zumal
unerfüllbaren – auch/zumindest eigenen) abweichendes Aussehen, bis (in der
erfolgten Art und Weise beabsichtigtes,
auch-‚Handeln‘-genanntes)
Verhalten, zu entschuldigen;
sondern wir bitten,
zumal mit-בּ Reverenz auch – allerdings ergebnisoffen – Euer Gnaden / Sie, um ‚Vergebung
von Schuld‘! Erpressen nicht einmal (unsere/meine, Eure, Ihre, Deine …
G‘ttes) Versöhnung / Trennung wegen
unserer(! ob) ausweichlich /oder\
vermeidlich gewesenen (etwa unbeabsichtigten, unachtsamen,
missverständlichen/verstandenen, ungeschickten pp. sowie zahlreicherer weiterer,
gleich gar ‚aus- oder beglichener‘, bis sogar irreparablerer – gleich gar, zumal intersubjektiv, anerkannter) Fehler/Irrtümer (ups-unserer- äh meinerseits) –
oder wenigstens/immerjin keine ‚monetären Schuldenerlasse‘, bis überhaupt Haftungsverzicht/e, erzwingen s/wollend] ‚Redet ihr noch miteinander, oder haft ihr schon geerbt?‘ 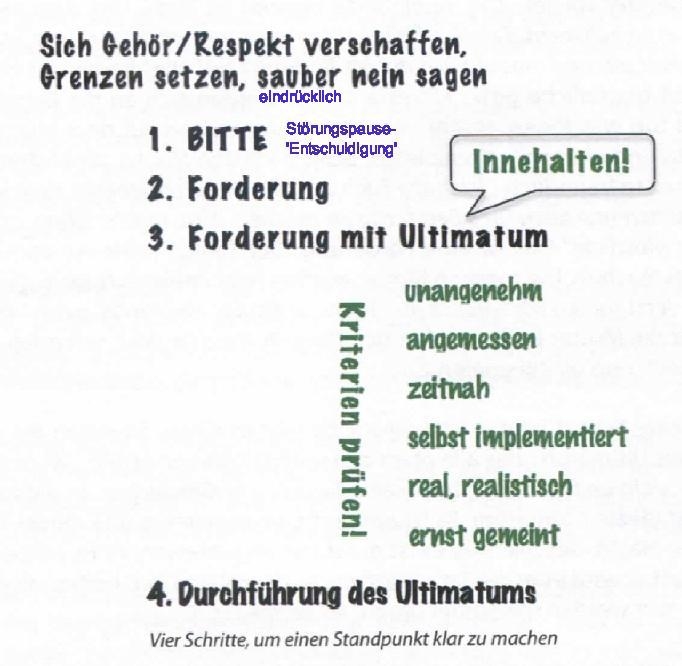 [Eher noch ernsthafter/heftiger, dass (und wie bereits, oder eher, die Vorstellung
der Möglichkeit: falls) ‚es kein
richtiges Verhalten gibt‘, gleich gar
[Eher noch ernsthafter/heftiger, dass (und wie bereits, oder eher, die Vorstellung
der Möglichkeit: falls) ‚es kein
richtiges Verhalten gibt‘, gleich gar
kein einziges/singulär(immer und überall korrekte)s da so
erwartetes, bis immerhin gesetzeskonformes/zulässiges. – Sondern: In manchen (kaum jemals allen 49, zumeist nicht einmal all den wechselseitig/gemeinsam aktuell reflektierten, etwa bis zu
fünfzehn modalen davon) Hinsichten, mehr oder minder (vieler
Menschen Erachtens/Empfindens)
zutreffend /
angemessen / duldbar-erträglich wirkend verwendbare Alternative( Rocklängen
bis Faltunge)n-Mehrung; die gleichwohl, bis ‚leider‘, nur zu gerne (gleich gar ‚motivational‘ rechthaberisch,
äh) reduktionistisch/vereinfacht … Euer
Gnaden ahnen schon länger]  Kampf
oder Knicks?-weder die einzigen, noch überhaupt wechselseitig ausgeschlossene,
Alternativen. [Zumindest das ‚Futurum
exactum‘ widerspricht jeder
‚Fliegenschiss‘-These/Positivem-Negativem Denken (wieviel
mehr Gutes/Schlechtes im Leben des/der
Einzelnen, der sozialen Figuration/en
bis/gegenüber Menschenheit insgesamt geschehe/n):
Verbrechen/Ereignisse sind/werden nicht
einmal/gerade bei und durch Vergebung unrelativierbar, was (zumal über
‚damals‘ beteiligte Personen hinausgehend unterschiedlich, jeweils betreffend)
geändert werden kann
& darf – sind Sichtweisen/Deutungen/Erzählungen, bis/also Wiederholungen eines Geschehens]
Kampf
oder Knicks?-weder die einzigen, noch überhaupt wechselseitig ausgeschlossene,
Alternativen. [Zumindest das ‚Futurum
exactum‘ widerspricht jeder
‚Fliegenschiss‘-These/Positivem-Negativem Denken (wieviel
mehr Gutes/Schlechtes im Leben des/der
Einzelnen, der sozialen Figuration/en
bis/gegenüber Menschenheit insgesamt geschehe/n):
Verbrechen/Ereignisse sind/werden nicht
einmal/gerade bei und durch Vergebung unrelativierbar, was (zumal über
‚damals‘ beteiligte Personen hinausgehend unterschiedlich, jeweils betreffend)
geändert werden kann
& darf – sind Sichtweisen/Deutungen/Erzählungen, bis/also Wiederholungen eines Geschehens]  Möglicherweise/n
brauche ich ja nicht (immer), doch kann und darf ich Menschen (‚jedenfalls‘
für ihr wegen eines Verhalten/s) ver-
äh beurteilen, ohne sie
dabei/dafür/dazu/deswegen verachten zu ,üssen (gar eher in Gegenteilen
qualifiziert) und eventuell ist ‚sie‘ (Würde) ja, auch/doch
deskriptiv, unantastbar-!/?
Möglicherweise/n
brauche ich ja nicht (immer), doch kann und darf ich Menschen (‚jedenfalls‘
für ihr wegen eines Verhalten/s) ver-
äh beurteilen, ohne sie
dabei/dafür/dazu/deswegen verachten zu ,üssen (gar eher in Gegenteilen
qualifiziert) und eventuell ist ‚sie‘ (Würde) ja, auch/doch
deskriptiv, unantastbar-!/?
Prompt – zumal/gar bei Verwendungen / Auslegungen Apostolischer Schriften – den veritablen Vorwurf tradierend, solch – zumal unbeendbar anhaltende – ‚Vertöchterung / Versöhnung‘ (erinnernd was vergeben / gesühnt, bis wem was, gar warum, nicht erlassen) wäre verwerflich nachtragend / irgendwie aufzulösen oder ab-/auszusitzen.
 [Wäre denn, gleich gar zuvor, ein zuständiges Gericht zu finden, das ‚auch nur‘ die
gewünschte (Rechts-)Auffassung
teilt, Euer Gnaden] ‚Hat so (wie
empfundend erinnerlich erlebt) sein dürfen‘ vergibt (sic? – na ja:
erleichtere / zeigt anerkennend) sich/anderen die eigene und deren Existenz, ‚versöhnt‘
(auch nicht ‚passiv‘, jedoch
aus- und eindrücklich)
mit sich selbst, bis, in Fällen von unerzwingbaren
Wechselseitigkeiten, mit … Sie ahnen, äh wissen,
schon – wem/was.
[Wäre denn, gleich gar zuvor, ein zuständiges Gericht zu finden, das ‚auch nur‘ die
gewünschte (Rechts-)Auffassung
teilt, Euer Gnaden] ‚Hat so (wie
empfundend erinnerlich erlebt) sein dürfen‘ vergibt (sic? – na ja:
erleichtere / zeigt anerkennend) sich/anderen die eigene und deren Existenz, ‚versöhnt‘
(auch nicht ‚passiv‘, jedoch
aus- und eindrücklich)
mit sich selbst, bis, in Fällen von unerzwingbaren
Wechselseitigkeiten, mit … Sie ahnen, äh wissen,
schon – wem/was.
Jemandem der/die mich angegriffen / geliebt / verletzt hat – würde, bis werde, ich zwar vielleicht vergeben wollen (was können nicht notwendigerweise … Euer Gnaden wissen schon); jedoch in/seitens sozialer Figurationen denen ich angehöre, und/oder zugehören will, könnte/müsse ich allenfalls/zwar, zudem erheblich teurer, ‚Anträge stellen‘ (Anerkennung/Ablehnung, Erinnerung/Vergessen, Hilfe, Lernen, Rache, Vergebung/Vergeltung & Co. – gleich gar zu ändern) deren Ausbleiben/Entscheidung unabwendlich ebenfalls (emergentes, geradezu ‚überindividuelles‘) Verhalten (zumal mir ‚gegenübermächtig‘ – sogar/gerade mein Verhältnis mit/zu scheinbar bis tatsächlich ‚Verursacht-Habenden‘ bestimmen wollend, und immerhin beeinflussen könnend bis dürfend) bleibt/wird.
 Schwierig genug
das/dem/denen/der zu vergeben der/die mich be- bis getroffen haben/hat (ersetze
wann, wer-?, erleichtere einem wasm wie-?, zwinge/berechtige wozu?) – doch kaum weniger
‚meine/unsere‘ Absichten, Angehörigen, Ansichten,
Aussagen, Aussehen, Gemeinschaft/en, Gottheit, Ideale, Ideen, Kinder,
Lebensgrundlagen und sonstige Hervorbringungen Verachtenden / Verletzenden-!/? [Obwohl,
bis weil – ‚es so gewesen sein durfte wie
erlebt‘ – weder sich noch
andere, oder Erinnerungen, (namentlich
böse / falsche / irrige / schädliche / verhasste) vernichten zu s/wollen – gehört zu den Königsdisziplinen inner- und zwischenmenschlicher
Beziehungsrelationen] Gleich wie zuvor
‚dem‘ ob gar nicht oder etwa gerade ein- bis wechselseitig
Vergebenen (Ding, Wort Ereignis – respektive dafür Gehaltenem / dazu [ursächlich] bis so
Erklärten) sind/werden Beziehungsrelationen
nie (unabwendlich anders, gar ups
Vernunftfaktoren bis Weisheit / TiKuN zugänglicher)!
Schwierig genug
das/dem/denen/der zu vergeben der/die mich be- bis getroffen haben/hat (ersetze
wann, wer-?, erleichtere einem wasm wie-?, zwinge/berechtige wozu?) – doch kaum weniger
‚meine/unsere‘ Absichten, Angehörigen, Ansichten,
Aussagen, Aussehen, Gemeinschaft/en, Gottheit, Ideale, Ideen, Kinder,
Lebensgrundlagen und sonstige Hervorbringungen Verachtenden / Verletzenden-!/? [Obwohl,
bis weil – ‚es so gewesen sein durfte wie
erlebt‘ – weder sich noch
andere, oder Erinnerungen, (namentlich
böse / falsche / irrige / schädliche / verhasste) vernichten zu s/wollen – gehört zu den Königsdisziplinen inner- und zwischenmenschlicher
Beziehungsrelationen] Gleich wie zuvor
‚dem‘ ob gar nicht oder etwa gerade ein- bis wechselseitig
Vergebenen (Ding, Wort Ereignis – respektive dafür Gehaltenem / dazu [ursächlich] bis so
Erklärten) sind/werden Beziehungsrelationen
nie (unabwendlich anders, gar ups
Vernunftfaktoren bis Weisheit / TiKuN zugänglicher)! 
Wesentliche Vernachlässigung gängiger Versöhnens/Vertöchterns, äh Vertröstungen: Die irrige Vorstellung/Erwartung
‚es sei, werde bis
müsse, danach/dadurch, so wie
zuvor (gewesen/empfunden – namentlich
‚Fehler‘, ‚Schuld‘,
‚Lernen‘ & Co. vergessend/ungeschehen),
weitergehen‘ – 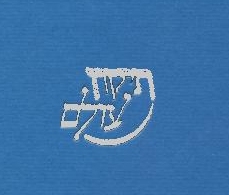 [/tikun/
repräsentiert sowohl
‚Heilung/Reperatur‘ als auch ‚Vollendung/Kritik‘ תיקון]
[/tikun/
repräsentiert sowohl
‚Heilung/Reperatur‘ als auch ‚Vollendung/Kritik‘ תיקון]
was
nicht nur (schlimm genug) jedem
‚Besser-Werden‘ von (geheilten
/ getreennten) Beziehungsrelationen, ‚im Wege
steht‘, sondern auch deren so wesentliche
Unterbrechungsnotwendigkeiten, und sogar Beendigungslegitmäten, zu
verhindern behauptet / vermeint / /verspricht / trügt.  [C(o)urtesy of the unwedding ‘bride‘ to her
ex-husband: Manche Menschen sind/waren eher ‚trotz‘ (aller), als etwa wegen (bestimmter),
ihren/Eurer Eigenschaften
/ Verhaltensweisen
erfreut, bis befreundet, und/oder einander (wie auch immer)
verbunden]
[C(o)urtesy of the unwedding ‘bride‘ to her
ex-husband: Manche Menschen sind/waren eher ‚trotz‘ (aller), als etwa wegen (bestimmter),
ihren/Eurer Eigenschaften
/ Verhaltensweisen
erfreut, bis befreundet, und/oder einander (wie auch immer)
verbunden]
Ab- bis Anstandshöfe(vergrößerungen
/ Respektsdistanzen) sind/werden besser
als ihr ‚gnostischer‘ – Ausdehnung/Schöpfung für
die schuldhaft ursächliche
Voraussetzung / Ermöglichung allen Übels
haltender –
Ruf!  [She, the instructor, knows better – how to curtsy] Sieht man
doch/ja!
[She, the instructor, knows better – how to curtsy] Sieht man
doch/ja!
#jojo-tabelle
 Dieses, Eures, Ihres Hochschlosses
Erdgeschoss im / nach Westen des Handels- bis
Unterschiede(machen)s Burghofes wo Erfahrungentüre,
Tugendenturmportal und Schlossküchenkorridor der heutigen
Schatzkammer beieinander liegen.
Dieses, Eures, Ihres Hochschlosses
Erdgeschoss im / nach Westen des Handels- bis
Unterschiede(machen)s Burghofes wo Erfahrungentüre,
Tugendenturmportal und Schlossküchenkorridor der heutigen
Schatzkammer beieinander liegen.  [Nicht
alleine, erst grammatikalisch / lexikalisch gehen ‚Vergebung/en‘
sehr oft ‚Verfehlung/en‘ oder
aber ‚Ver-Führung/en‘
voraus – außer bei / von jenen,
die sich und/oder einander (bis uns) die / ihre Existenz/en
nicht zu verzeihen wünschen, vermögen oder nicht dulden / erlauben, äh (Dich / mich / sich)
davon erlösen / retten müssen]
[Nicht
alleine, erst grammatikalisch / lexikalisch gehen ‚Vergebung/en‘
sehr oft ‚Verfehlung/en‘ oder
aber ‚Ver-Führung/en‘
voraus – außer bei / von jenen,
die sich und/oder einander (bis uns) die / ihre Existenz/en
nicht zu verzeihen wünschen, vermögen oder nicht dulden / erlauben, äh (Dich / mich / sich)
davon erlösen / retten müssen]  Schief stehende Wände / Zeichen. [‚Kawummmm‘ da fordert(e doch, noch) jemand Vergebung ein] Nicht-Wissbarkeits-Prinzipien
– schon gar nicht vorher (
Schief stehende Wände / Zeichen. [‚Kawummmm‘ da fordert(e doch, noch) jemand Vergebung ein] Nicht-Wissbarkeits-Prinzipien
– schon gar nicht vorher (wissbar), ebend-!/?/-/.  Nachstehend
keine Schreibfehler eingeklammert! [Abergläubige versus Glaubende, Christen
versus Nichtchristen, Gojim versus Juden – und/oder nicht] An einem Fluss – manche erzählen, es sei
(gegenwärtig / immerschon) ‚der Niel‘ – treffen ein Frosch und ein
Skorpion aufeinander; wechselseitig blockierend können sie einander daran
hindern. ihre ja gemeinsame Interessenlage, den Fluss zu überqueren, zu
realisieren: Blockieren / Verhindern, was beide für vorteilig bis mötig halten.
Jedenfalls schlägt der Skopion vor, der Frosch solle ihn auf seinen Rücken
nehmen um mit ihm den Fluss zu durchschwimmen. – Da empört-sich / lächelt der
Frosch ablehnend: ‚Damit Du mich unterwegs stichst, und ich sterbe!‘ Doch der Skorpion erwidert: ‚Wenn ich Dich unterwegs
tötem würde, müsste ich ja selbst ertrinken!‘ (Und
kann sich Drohungen damit wozu er in der Lage wäre. Sollte der Frosch versuchen
ins Wasser zu kommen, ‚getrost‘ sparem-) ‚Ein
Argument‘ das der Frosch schließlich einsieht, und so schließen beide einen
entsprechenden Pakt. Der Skorpion darf aufsteigen, und der Frosch schwimmt mit
ihm los. – Doch mitten im Fluss spürt er plötzlich den Giftstich in seinem
Rücken, und wendet sich sterbend dem Skorpion zu: ‚Ja
warum denn, jetzt ersäuft Du doch …‘ – ‚Ja‘ gurgelt der absaufende
Skorpion: (einige stellen dem/seinem letzten Satz ebenfalls ein ‚Ja aber‘ voran); ‚Wir sind
hier im Nahen Osten …‘ [Oder ist/sei dort gar Jerusalem] Exodus /
schemot – oder:
sind/werden auch Einflüsse ‚auf
Anzahlen / Geschlecht / Namen von
Todeslisten‘ begrenzt-!/?/-/.
Nachstehend
keine Schreibfehler eingeklammert! [Abergläubige versus Glaubende, Christen
versus Nichtchristen, Gojim versus Juden – und/oder nicht] An einem Fluss – manche erzählen, es sei
(gegenwärtig / immerschon) ‚der Niel‘ – treffen ein Frosch und ein
Skorpion aufeinander; wechselseitig blockierend können sie einander daran
hindern. ihre ja gemeinsame Interessenlage, den Fluss zu überqueren, zu
realisieren: Blockieren / Verhindern, was beide für vorteilig bis mötig halten.
Jedenfalls schlägt der Skopion vor, der Frosch solle ihn auf seinen Rücken
nehmen um mit ihm den Fluss zu durchschwimmen. – Da empört-sich / lächelt der
Frosch ablehnend: ‚Damit Du mich unterwegs stichst, und ich sterbe!‘ Doch der Skorpion erwidert: ‚Wenn ich Dich unterwegs
tötem würde, müsste ich ja selbst ertrinken!‘ (Und
kann sich Drohungen damit wozu er in der Lage wäre. Sollte der Frosch versuchen
ins Wasser zu kommen, ‚getrost‘ sparem-) ‚Ein
Argument‘ das der Frosch schließlich einsieht, und so schließen beide einen
entsprechenden Pakt. Der Skorpion darf aufsteigen, und der Frosch schwimmt mit
ihm los. – Doch mitten im Fluss spürt er plötzlich den Giftstich in seinem
Rücken, und wendet sich sterbend dem Skorpion zu: ‚Ja
warum denn, jetzt ersäuft Du doch …‘ – ‚Ja‘ gurgelt der absaufende
Skorpion: (einige stellen dem/seinem letzten Satz ebenfalls ein ‚Ja aber‘ voran); ‚Wir sind
hier im Nahen Osten …‘ [Oder ist/sei dort gar Jerusalem] Exodus /
schemot – oder:
sind/werden auch Einflüsse ‚auf
Anzahlen / Geschlecht / Namen von
Todeslisten‘ begrenzt-!/?/-/.
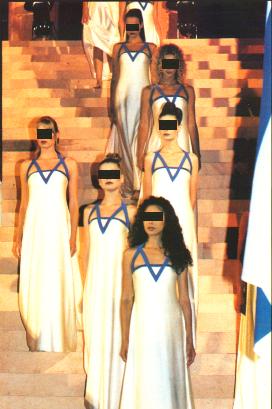
|
Vergebung, existenzielle
(namentlich ,der
/ von Sünde/n’) – da(ss)/falls Gnosis ohnehin irrt! – Dies וו zu
,bemerken‘?
Verschließen, und\aber sogar (allerlei) verstellen, können & dürfen, bis ups sollen (jedenfallls aber tun‘s), einander / sich so manche manches. [Praktizierte Gnade, Ehr-Furchten, /meschiach/ מְשִׁיחַ etc. oft mühsamer und wirksamer als immerhin / nur / überhaupt Ausgesprochene/s]
|
[Krrmthese: Nicht, dass Mängel bis Verfehlungen,
oder dafür-Gehaltenes, nötig respektive alle
Enttäuschungen, ‚Nachtragbarkeiten‘ und zumal Verletzungen abwendlich währen] |
· Absichten bis Achtsamkeeiten (zumal ‚gute‘, das Vorkommen anderer wird kaum bestritten); · /ascham/ אשם (unabwendliche/n, gar teils wandelbaren Bedarfs, ‚Stoffwechsel‘ bis etwa Tod [sonst {aspektisch} Modales / {empirisch hervorbringbar / vorfindlich} Mögliches / {Verteilungs-mehr oder minder} Wahrscheinliches wie] Alter, Erfahrungen / Erkenntnissn, Irrtümer, Krankheiten, Lernen, Risiken, Unfällen, Ungeheuern, Ungerechtigkeiten, Unsinn, Unwissen, Versagen, ‚Zufällen‘ und-ups Zwängen); ·
Askese und/versus
Libertinismus (Syndrom/e – ‚dem/den/der [jeweils] Bösen‘); ·
Berechtigungen (gleich
gar exekutierten: eigentümlichen,
fremden, hoheitlichen, kollidierenden und würdigen – eben nicht erst autoritativen, urheberlichen, oder letztlich/nur anderes/sich
für tauglich / weise / wissend Haltenden
bis Weisenden)
zumal versus ‚deren‘ Bestreitungen; · Beziehungsrealtionen (zumal dies / Dich / mich / Notwendiges / uns / Zutreffendes [nicht] zu ändern / beachten / brauchen / dulden / mögen / wollen); · C; ·
Dass/Wenn/Wie Menschen. Dinge,
Ereignisse und sogar Personen vergessen, die und obwohl sie ihnen wichtig (nicht
nur sein/werden sollten) ·
· Debatten, /dewarim/ Grammatik; · ??Dualismen (Entweder--Oder-Verteilungen), gar/gerade der Gnosis (sic! Existenzverachtung/en bis Vernichtungsbemühen – falls / soweit / wo Gnade – bei / trotz Verbrechen[smaxima] – eine Option-!/?) Vereinfachungen, zumal von vertrauten abweichende oder gehasste/geliebte Komplexitäten widerlegende; · Eltern, Kinder, Partner/innen und andere nahestehende Bezugsgruppenangehörige und Hierarchien (zumal G’tt, bereits gOtt und Realitätenvorstellungen), eignen ‚einander‘ / sich besonders naheliegend als Konflikte / Projektionsflächen / Tatpersonen / Verdächtig, äh für / gegen hier gelistete und weitere Rettungsfragen, Schuldangelegenheiten, Trennungen, Verbrechen, Verletzungen und Versöhnung / Vertraegen / Wiederaufnahmen oder Zerteilungen von Relationen; · Fehler (zumindest, bis zunächst, eigene und dafür / dagegen Gehaltene/s wahrnehmend); · Feinden / Freunden / Sophrosyne (bis Gemeinwesen) – Todfeinden, Partei(…)en (Vereinbarungen, Personen und Persönlichkeiten / Individuen, Kompromissen und Interessen[gleich- und -verschiedenheiten]); · ‚Gegenüberkräfte/n‘, Hilfen, Oppositionen und Widerspruch / Zustimmungen (nicht harmloser); · Grenzenränder(erlebnisse/n: anderheitliche, CHeT, dualistische, … ungerechte, unverstandene);
· Gutachterliches /schamai/ Pedanterie/n;
· Handlungen (Denken, Empfinden, Reden, Tun und Unterlassen inklusive (manch) anderem Verhalten); · /he(i)/ Lücken הא gar bis Hyperrealitäten / Überbietungen; · Leiden(schaf[f/t]en); · Können, Lassen – Künsten, Resonanzen, Schönheit/en & Co.; · Provokationen (aggressive / wütende, arrogante, kriminelle, stressige, devote, überzeugende / überzeugte, alefbetische / grammatikalische / sprachenliche, didaktische, ‚vergottende‘ & Co.); · Störungen (von außen, von innen, von Gewissheiten, von Kontemplation/en, von Vereinbarungen / Vertragserfüllungen – auch bis gerade erwünschte / erforderliche); ·
Unangenehmes / · Unterschiede / Urteile (nicht erst/nur hoheitliche, oder ‚falsche‘ / ‚vorausgehende[r Erwartung / Sorgen]‘); · Vorschriften auskosten / beeinflussen / deuten / einhalten / hassen / lieben / machen / updaten / ‚verletzen‘ / verstehen (von mpt,ativ Vorgegebenem); · Wandel und Wiederholung/en; ·
Wogen nichts – als
Darstellung(sänderung /
Ausdrucksformen),
Deutungen (Gefühls- bis
Reflexeänderung/en)
respektive Sichtweisenwahlen
– · Zusammenhänge und Zweifel – bis Zwänge, äh Zorn. |
#olaf
 [Ideale bis Modellvorstellung/en]
[Ideale bis Modellvorstellung/en]
Klemmsteinmodell (desselben) im Burghof am Michaelstrakt ‚vor‘ Türen der Anderheit/en, der
Erfahrung(en Balkon(, des Tugendenturms und dieser Schlossküchekorridor heutigen Schatzkammerzugangs]
 Aus
dem
Balkonzimmer der Adjutant(z)en, äh Deutungen, droben drüben im
Hauptgeschoss, heraus. [Ausgerechnet der Freiheitenturm zu erahnen – ein
Schelm, wer sich was dabei/dagegen denke]
Aus
dem
Balkonzimmer der Adjutant(z)en, äh Deutungen, droben drüben im
Hauptgeschoss, heraus. [Ausgerechnet der Freiheitenturm zu erahnen – ein
Schelm, wer sich was dabei/dagegen denke]  Umd, gleich gar vom Seil aus, nach
limks/nordwärts Vorstellungenprachttreppe am(vom/zum Dasein am Überzegtheitenwehrhaus
entlang.
Umd, gleich gar vom Seil aus, nach
limks/nordwärts Vorstellungenprachttreppe am(vom/zum Dasein am Überzegtheitenwehrhaus
entlang. 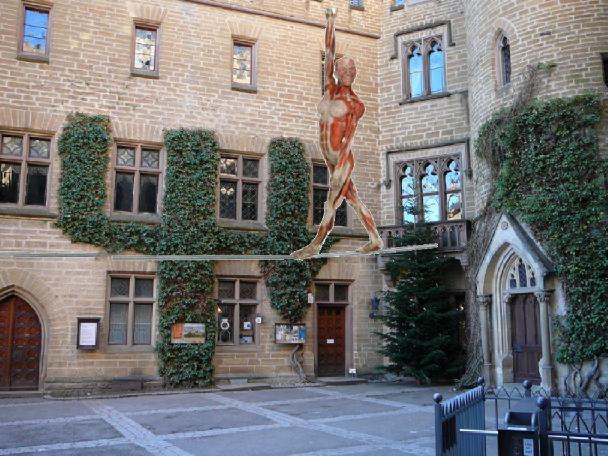
Nicht einmal Erfahrung(swissenschaft/en) und also Erketnisse reich aus/hin!

Dass / Falls / Inwiefern / Wem weder für Fakten, oder dagegen. Gehaltenes, noch die(/deren ‚Abbildungen‘ / Repräsentationen / Symbole respektive Dinge, Ereignis)se Menschen- bis Sachenverhalte/n ‚derart‘/entscheidend wesentlich sind/werden – sondern (inwieweit / insofern ‚nur‘) wie Erlebnisse (als / der / des / von Verhaltenssubjekte/n/s) gegenwärtig deutend, respektive eben gerade dies bestreiten s/wollend oder ‚übersehend‘, oder was auch immer sonst. Wozu verwendend verstanden.
Zimal manche/wir am und im Grunde bei/von Begrifflichkeiten öfters wesentlich anderes finden (vgl. E.G,B. bis Wa.Le.) als abtauchend erwartet/verlangt vermutet. Abb.klemsteine-tauchboot
Abbs.seiltanz-figur-und-mödchen sehend auf prachttreppe-und-wehrhaus
Treppe leuchtet vor Wehrhauswestmauer der Beziehungsrelationen 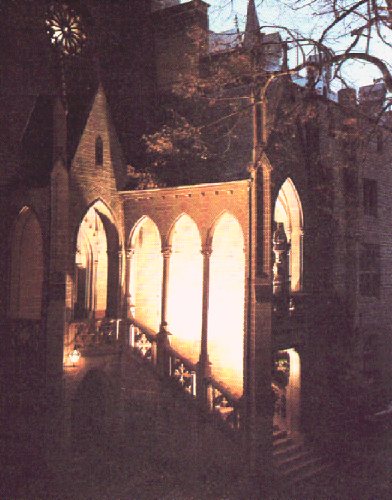
Schatzkammer. S4
#olaf-jojo
 [Zwar Seilwinde/Flaschenzug
darüber/droben im Dachgeschoss der Weisheit/en]
[Zwar Seilwinde/Flaschenzug
darüber/droben im Dachgeschoss der Weisheit/en]
Gar nicht so wenige Leute,
die Vergebung schätzen, und/oder gar mit Entschuldigung gleichsetzen, sind bzw. werden entsetzt, derartige höchste Zwecke, äh sichtbare Ergebnisse, tätiger Liebe, oder gar Reue, nicht (erst) viel weiter
droben/höherrangig anzutreffen – was gleich mehrere Grundlagen
berührt, bis
betrifft / kränkt.  [Kronleuchterablass droben, des/für/im Grafensaal, von darüber bedienbar –
doch keine Rettungswinde
im/am/aus/in SAR-Hubschrauber]
[Kronleuchterablass droben, des/für/im Grafensaal, von darüber bedienbar –
doch keine Rettungswinde
im/am/aus/in SAR-Hubschrauber]
#jojo Geradezu erwartungsentsprechend
meinte Rabbi Kushner, jedenfalls zunächst/fügsam, keine passende hebräische
Begrifflichkeit für diese Schlüsselangelegenheit zu haben/kennen, und
doch: 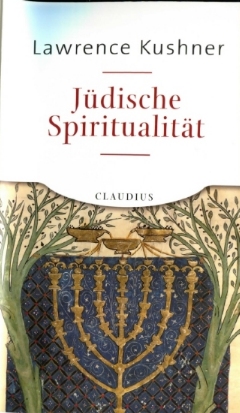 Was das - gar ein brauchbares -
Was das - gar ein brauchbares -
Vergebungskonzept angeht vgl. immerhin
La.Ku. teschuwa/Umkehr)
Als Robert Jesus mit [in die Themenliste des christlich-jüdischen Zwiegesprächs zweier Freunde] aufnehmen wollte, fühlte ich [La.Ku.] mich anfänglich im Nachteil, bis mir die Teschuwa einfiel.
- תשובה answer / Umkehr, Sinnesänderung
#jojo Zwar entschuldigen wir hier allenfalls Existenzielles (Beschuldigen. Wegem äh wider ‚der Gnosis‘ Erlösungskonzeptionen aus/von alef-mem-nun, Änderungen, Fehlern, Furchten, Grenzen, Materie, Raeumen, Sexualitäten, Stoffwechsel, Unterschieden, Vergebungsbedarf, Verträgen, Zeiten), doch vergeben wir Euch/Ihnen/uns Handlungen, bis sonstiges Verhalten, überraschend gerne, anstatt Alles oder automatisch bis ‚auf Kommando‘/dekretierbar/spontan (und eher noch seltener/weniger erwartungsgemäß aussehend/auswirkend).
Beachtlich auch falls oder
gar, dass wer (und sei es auch angeblich ‚nur‘,
anstatt etwa ‚immerhin‘) einen Rechtsanspruch
erfüllt bekommt, deswegen nicht notwendigerweise
auf jedwede Dankbarkeit zu verzichten hätte.  [Zumal/Zumindest Zivilisationen stellen transparente, (statt:
[Zumal/Zumindest Zivilisationen stellen transparente, (statt: simple,
natürliche
pp.) ups begrenzte
Verfahren / Verfassungen
bereit Ansprüche erfüllt / Beiträge abverlangt zu bekommen (weder alle noch immer)]
 Öffentliche/Private/Verheimlichte
Vorführungen nicht etwa ausgeschlossen, doch eher noch weniger zwingend.
[Nein, Macht/Unterwerfung
verlangt (nicht einmal immer/jedwede)
weitaus mehr (etwa an Aufopferung/Aufwand, Erniedrigung/Abstand,
Fügsamkeit//Gefolgschaft,
‘fuckability‘/Befruchtbar- äh Freiwilligkeit, Leiden, Verbreitungen/‘Werbung‘, Widerstreben/Willigkeiten, Zuneigung/Anbetung …) als, mehr oder
minder, weitergehende, formelle Äußerlichkeit/en,
bis ‚Hingabe‘-genannte Auslieferung] Sich Selbste,
ersatzweise-? Andere,
Anderen (#h dem
Prinzipiellen/Wirklichen, der Sache) ausliefernd-!/? /
hingegeben-!?
Öffentliche/Private/Verheimlichte
Vorführungen nicht etwa ausgeschlossen, doch eher noch weniger zwingend.
[Nein, Macht/Unterwerfung
verlangt (nicht einmal immer/jedwede)
weitaus mehr (etwa an Aufopferung/Aufwand, Erniedrigung/Abstand,
Fügsamkeit//Gefolgschaft,
‘fuckability‘/Befruchtbar- äh Freiwilligkeit, Leiden, Verbreitungen/‘Werbung‘, Widerstreben/Willigkeiten, Zuneigung/Anbetung …) als, mehr oder
minder, weitergehende, formelle Äußerlichkeit/en,
bis ‚Hingabe‘-genannte Auslieferung] Sich Selbste,
ersatzweise-? Andere,
Anderen (#h dem
Prinzipiellen/Wirklichen, der Sache) ausliefernd-!/? /
hingegeben-!? 
סליחה Euer Gnaden mögen entschuldigen/verzeihen Eure/Ihre kostbare Aufmerksamkeit (hierfür / empörend) zu gebrauchen-!/?
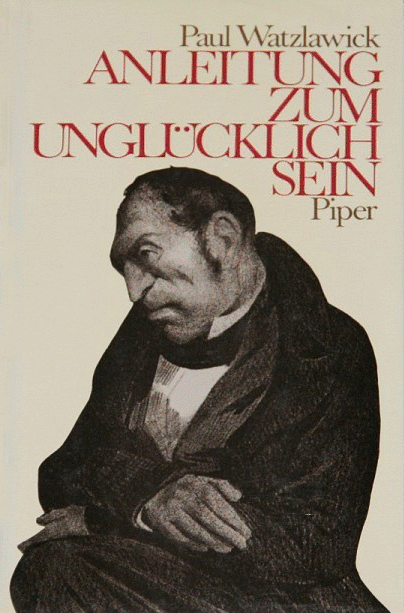 ‚Sei-spontan‘-Paradoxien
dienen dazu, wenigstens aufforderndes ‚Bitten um‘ / ‚Befehlen‘ eine/r
gefällige/n. bis nötigen, gar ‚selbstverständliche/n‘, Erwartung (soweit
nicht gleich Schikane /
Mrkt-Breirkrms-Möglichkeit), wo nicht auch gerade (ups-etwas-kostende)
Dank(barkeit/en – knicks-peinlichst) zu meiden! –
Es könne ja wohl nicht angehen, dass/wenn sogar Freunde/Liebende darum gebeten werden müssen/wollten:
Sich nach des/der Anderen (zumal Frau
ihrem) Befinden, Erleben
etc. zu erkundigen, oder dies (zumal bei
manchem Mann ‚erstmal‘) zu unterlassen – zumal sie spüren,
äh wissen,
müssten / gefälligst zu beachten täten ‚wie es einem
geht‘, ‚was jemand gerade wie braucht‘ etc. pp.; vgl. insbesondere auch die einschlägige
Liste der zehn ‚dümmsten‘ Fehler kluger Leute.
‚Sei-spontan‘-Paradoxien
dienen dazu, wenigstens aufforderndes ‚Bitten um‘ / ‚Befehlen‘ eine/r
gefällige/n. bis nötigen, gar ‚selbstverständliche/n‘, Erwartung (soweit
nicht gleich Schikane /
Mrkt-Breirkrms-Möglichkeit), wo nicht auch gerade (ups-etwas-kostende)
Dank(barkeit/en – knicks-peinlichst) zu meiden! –
Es könne ja wohl nicht angehen, dass/wenn sogar Freunde/Liebende darum gebeten werden müssen/wollten:
Sich nach des/der Anderen (zumal Frau
ihrem) Befinden, Erleben
etc. zu erkundigen, oder dies (zumal bei
manchem Mann ‚erstmal‘) zu unterlassen – zumal sie spüren,
äh wissen,
müssten / gefälligst zu beachten täten ‚wie es einem
geht‘, ‚was jemand gerade wie braucht‘ etc. pp.; vgl. insbesondere auch die einschlägige
Liste der zehn ‚dümmsten‘ Fehler kluger Leute.
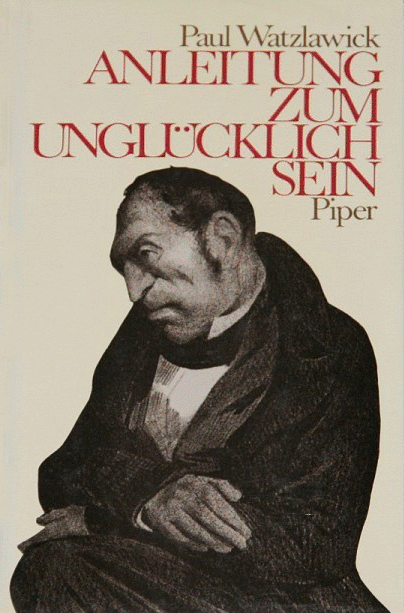 Eher noch weitergehende:
‚Würdest Du mich
lieben – würdet Du gern (Knoblauch essen)‘-Denkmuster, äh Empfindungsformen, belegen und illustrieren jenes – gar vorherrschende – summenverteilungsparadigmatische
/ Opfer-verbrauchs(-Nutzen-Miss-)Verständnis, bereits von (verbindlich-uneinseitigen)
Partnerschaften, bis sogar (oder eben gerade dem, was für) Liebe (gehalten – an deren
Stelle verfehlt/verlangt/verwendet
gewollt/gesollt und/bis
aufgebraucht/kompensiert/substituiert – wird).
Eher noch weitergehende:
‚Würdest Du mich
lieben – würdet Du gern (Knoblauch essen)‘-Denkmuster, äh Empfindungsformen, belegen und illustrieren jenes – gar vorherrschende – summenverteilungsparadigmatische
/ Opfer-verbrauchs(-Nutzen-Miss-)Verständnis, bereits von (verbindlich-uneinseitigen)
Partnerschaften, bis sogar (oder eben gerade dem, was für) Liebe (gehalten – an deren
Stelle verfehlt/verlangt/verwendet
gewollt/gesollt und/bis
aufgebraucht/kompensiert/substituiert – wird).
 «Der Frosch stellt sich das alles ganz einfach vor, wenn nur die
Anderen
nicht wären, die offenbar nicht so wollen, wie er will.
Einfach die Kugel holen, das wird
schwierig für den Frosch. Man muss(!) ‚Bitten können‘ und ‚Dankbar sein(!)‘ . So löst sich
ein Problem [sic! manche Aufgabe; O.G.J. sozio-logisch zumindest der Duldung
durch andere bedürftig] leichter. ....
Obwohl nicht jeder Froschkönig auf die Knie fallen
muss, und die ‚wahren‘ Märchen weniger albern
enden.» (Ergebnis/Forschungssumme topologischer Erzählungsanalyse;
zumal verlinkende Hervorhebungen, kursiv pp. O.G.J.-Quellenarrogant)
«Der Frosch stellt sich das alles ganz einfach vor, wenn nur die
Anderen
nicht wären, die offenbar nicht so wollen, wie er will.
Einfach die Kugel holen, das wird
schwierig für den Frosch. Man muss(!) ‚Bitten können‘ und ‚Dankbar sein(!)‘ . So löst sich
ein Problem [sic! manche Aufgabe; O.G.J. sozio-logisch zumindest der Duldung
durch andere bedürftig] leichter. ....
Obwohl nicht jeder Froschkönig auf die Knie fallen
muss, und die ‚wahren‘ Märchen weniger albern
enden.» (Ergebnis/Forschungssumme topologischer Erzählungsanalyse;
zumal verlinkende Hervorhebungen, kursiv pp. O.G.J.-Quellenarrogant)
 [Drüben ‚drunten‘
gleich mehrerlei Zwänge
bekannt: hier
unten, bis da droben drüben allerdings eben:]
Man muss nicht mit Liebe ‚erlösen‘, man kann auch mit/aus Wut bis Hass ‚erlösen‘. – Zerstörung, nicht
zuletzt jene bestimmter, anstatt aller, Ketten, Kriegsgeräte, Grenzen etc. kann Erlösungsmittel sein/werden.
[Drüben ‚drunten‘
gleich mehrerlei Zwänge
bekannt: hier
unten, bis da droben drüben allerdings eben:]
Man muss nicht mit Liebe ‚erlösen‘, man kann auch mit/aus Wut bis Hass ‚erlösen‘. – Zerstörung, nicht
zuletzt jene bestimmter, anstatt aller, Ketten, Kriegsgeräte, Grenzen etc. kann Erlösungsmittel sein/werden.  Häufig ist die Schmerzzufügung bzw. Zerstörung
eine begrenzte bzw. gezielte und dosierte; namentlich
in ‚der Heilkunst‘ und Medizin zeigt
sich zwar die Differenz zwischen konventioneller Behandlung (etwa von Handauflegung über Verbandsanlegung
bzw. Drogen- äh Medikamenteneinnahme
oder Bestrahlung bis etwa Verhaltens- respektive Denkformänderung) und operativem Eingriff (also etwa
von Handanlegung zum ‚Schneiden‘, ‚Klemmen‘, ‚Kleben‘, ‚Nageln‘, ‚Sägen‘ und
‚Nähen‘ pp.) weder immer so, dass eines davon schmerzhafter oder besser
sein muss – noch so, dass es stets und für alles diese beiden Richtungen, oder
gar nur einen Weg, gegeben sein/werden müsste, bis
würde – eben dürfe.
Häufig ist die Schmerzzufügung bzw. Zerstörung
eine begrenzte bzw. gezielte und dosierte; namentlich
in ‚der Heilkunst‘ und Medizin zeigt
sich zwar die Differenz zwischen konventioneller Behandlung (etwa von Handauflegung über Verbandsanlegung
bzw. Drogen- äh Medikamenteneinnahme
oder Bestrahlung bis etwa Verhaltens- respektive Denkformänderung) und operativem Eingriff (also etwa
von Handanlegung zum ‚Schneiden‘, ‚Klemmen‘, ‚Kleben‘, ‚Nageln‘, ‚Sägen‘ und
‚Nähen‘ pp.) weder immer so, dass eines davon schmerzhafter oder besser
sein muss – noch so, dass es stets und für alles diese beiden Richtungen, oder
gar nur einen Weg, gegeben sein/werden müsste, bis
würde – eben dürfe.
 Ach
so! [‚Erlösung‘-Genanntes – geradezu
zu fürchten selten, das was viele
dafür halten, bis sich – oder aber anderen
(gar
gemeinsam / summenverteilungsparadigmatisch interessiert)
wovon-? nicht erst
messianisch
Ach
so! [‚Erlösung‘-Genanntes – geradezu
zu fürchten selten, das was viele
dafür halten, bis sich – oder aber anderen
(gar
gemeinsam / summenverteilungsparadigmatisch interessiert)
wovon-? nicht erst
messianisch  oder alleine trunken/nur elysisch ?-davon erwarten/versprechen] Schon gar nicht
mit (zumal/zumindest existenzieller/substanzieller)
Vergebung respektive (zwischenwesentlicher&beziehungsrelevanter)
Versöhnung, oder Interaktionsunterbrechung
bis -beendigung (nicht einmal vermittels Tod [aller ursprünglich
teilnehmend beobachtend beteiligter Lebewesen] für/auf Innerraumzeitlichkeiten
begrenzt ereicht), selbig/identisch.
oder alleine trunken/nur elysisch ?-davon erwarten/versprechen] Schon gar nicht
mit (zumal/zumindest existenzieller/substanzieller)
Vergebung respektive (zwischenwesentlicher&beziehungsrelevanter)
Versöhnung, oder Interaktionsunterbrechung
bis -beendigung (nicht einmal vermittels Tod [aller ursprünglich
teilnehmend beobachtend beteiligter Lebewesen] für/auf Innerraumzeitlichkeiten
begrenzt ereicht), selbig/identisch.

![]() Von einem der beiden zusätzlichen
Von einem der beiden zusätzlichen ![]() Stich-Worte in der dritten
Neuauflage des so basalen Lexikons der jüdisch-christlichen Begegnung(en)
von J.J.P. und Cl.Th. betont
Letzterer, Clemens Thoma in
wesentlicher Ergänzung zu(m/des eher
‚christlichen‘ Sprachgebrauch/s)
Stich-Worte in der dritten
Neuauflage des so basalen Lexikons der jüdisch-christlichen Begegnung(en)
von J.J.P. und Cl.Th. betont
Letzterer, Clemens Thoma in
wesentlicher Ergänzung zu(m/des eher
‚christlichen‘ Sprachgebrauch/s)  [Immerhin-ups
‚geschminkt (bleibend)‘
maximal möglicher Kotau einer/unserer ‚Debütantin‘, im ‚großen weißen Kleid‘, ohne es dabei
zu ruinieren: the so called ‘Texas dipp‘, without
a beer – da/soweit unklar, ob
es sich ‚bei ihr/Dir‘ etwa um die Pilotin oder die Notärztin des
Rettungshubschraubers handelt]
[Immerhin-ups
‚geschminkt (bleibend)‘
maximal möglicher Kotau einer/unserer ‚Debütantin‘, im ‚großen weißen Kleid‘, ohne es dabei
zu ruinieren: the so called ‘Texas dipp‘, without
a beer – da/soweit unklar, ob
es sich ‚bei ihr/Dir‘ etwa um die Pilotin oder die Notärztin des
Rettungshubschraubers handelt] 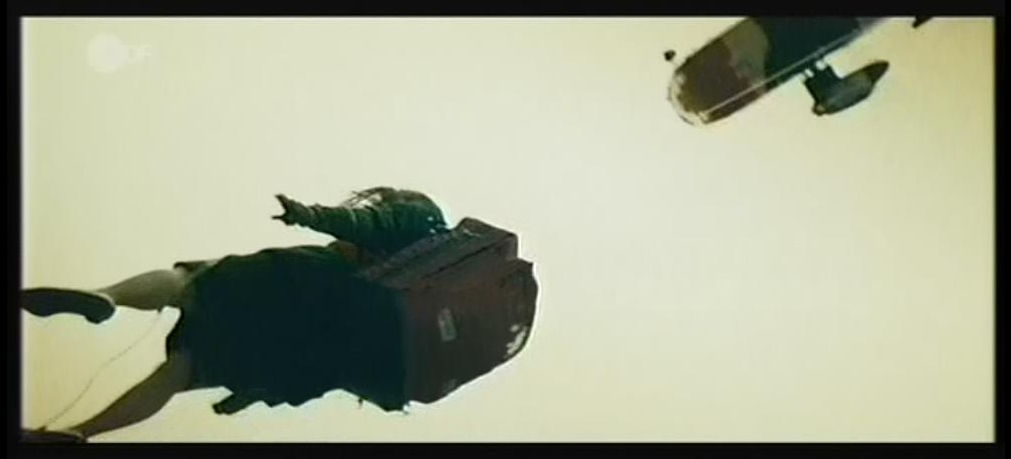 ‚Eschaton/Eschatologie‘:
Unter
‚Eschaton/Eschatologie‘:
Unter ![]() mit
‚Erlösung‘ sei «besonders die
von Gott [sic!
wenn also auch nicht unbedingt ‚ausschließlich‘, oder ‚ohne, bis nur wider, alle menschenseitige ‚Beteiligung‘-!/?
mit
‚Erlösung‘ sei «besonders die
von Gott [sic!
wenn also auch nicht unbedingt ‚ausschließlich‘, oder ‚ohne, bis nur wider, alle menschenseitige ‚Beteiligung‘-!/? ![]() O.G.J. mindestens mit J.J.P. auch
talmudisch nicht etwa allein/zentral
‚passiv‘-wartend verstehend PaRDeS verwendet]
zu erwartende Endgültige [sic? wenn auch kaum in den
Sinnen, ‚dass Sein dem Werden vorzuziehen‘, respektive הויה dies
abzuschaffen/zu vernichten wäre/sei?; O.G.J. anti-gnostisch] und ganzheitliche [sic! im
Unterschied wozu, bitte? O.G.J. ‚sehr lange Dauer‘ (griechische
Vorstellungen) von Zeitlosigkeit (semitischer
Denken) unterscheidend] Neugestaltung
alles Irdischen [sic? soweit/wo – gerade neben, sehr oft ‚übersehener,
bis bestrittener, gar immanenter,
‚Irdischkeit/en‘, nicht auch ‚Erneuerungen/Neuschöpfung/TiKuN der Himmel‘? O.G.J. zudem
wider mythologische These/n ‚ewiger Erde‘ vorsichtig] ,weg von
aller [namentlich
‚inklusive‘ für Fehler gehalten werdender] Sünde [sic!
genauer/eher ‚immun wider Ziel-Verfehlung(sabsichten)en aller Arten‘, als deren alternativlos determinierte Unmöglichkeit / allmächtig-allwissend
totalitär gewaltsame Fehler-Verunmöglichung? O.G.J. gegenwärtig-innerraumzeitlich
Yourselves-messianisch], Bedrohung und Not [sic? namentlich
‚innerraumzeitlich‘ ohne ‚Knappheitenbedarf‘, bis gar ohne
‚Krankheiten‘? O.G.J. gegenübermächtige Hilfen
anerkennend]
O.G.J. mindestens mit J.J.P. auch
talmudisch nicht etwa allein/zentral
‚passiv‘-wartend verstehend PaRDeS verwendet]
zu erwartende Endgültige [sic? wenn auch kaum in den
Sinnen, ‚dass Sein dem Werden vorzuziehen‘, respektive הויה dies
abzuschaffen/zu vernichten wäre/sei?; O.G.J. anti-gnostisch] und ganzheitliche [sic! im
Unterschied wozu, bitte? O.G.J. ‚sehr lange Dauer‘ (griechische
Vorstellungen) von Zeitlosigkeit (semitischer
Denken) unterscheidend] Neugestaltung
alles Irdischen [sic? soweit/wo – gerade neben, sehr oft ‚übersehener,
bis bestrittener, gar immanenter,
‚Irdischkeit/en‘, nicht auch ‚Erneuerungen/Neuschöpfung/TiKuN der Himmel‘? O.G.J. zudem
wider mythologische These/n ‚ewiger Erde‘ vorsichtig] ,weg von
aller [namentlich
‚inklusive‘ für Fehler gehalten werdender] Sünde [sic!
genauer/eher ‚immun wider Ziel-Verfehlung(sabsichten)en aller Arten‘, als deren alternativlos determinierte Unmöglichkeit / allmächtig-allwissend
totalitär gewaltsame Fehler-Verunmöglichung? O.G.J. gegenwärtig-innerraumzeitlich
Yourselves-messianisch], Bedrohung und Not [sic? namentlich
‚innerraumzeitlich‘ ohne ‚Knappheitenbedarf‘, bis gar ohne
‚Krankheiten‘? O.G.J. gegenübermächtige Hilfen
anerkennend]  hin zur ewigen [sic! doch eher (also:
soweit Ziel-Erreichung erträglich) ‚überraumzeitlich‘, semitisch-resch-waw-chet
qualifiziert, anstatt immanent/‚griechisch‘
verteilungsparadigmatisch (abzutrennend-beschränkt) deutend,
gebraucht/gedacht; O.G.J. durchaus mit ‚philosophischer/theologischer-Beweglichkeit‘
über/in Denkensgeschichte …] „Endherrschaft von Gott her“
(Dan 2,44f [vgl.
auch Jer. 31, 31-34])
zu verstehen.» Was also/eben durchaus-ups von
unausweichlichen Versöhnungsfragen, gleich gar mit
gegenwärtig (respektive vorher) Vorfindlichem und damit/daraus
Machbarem, zu unterscheiden wäre/bleibt – jedenfalls, bis ‚zudem/dazu/dawider‘,
nicht durch die Herrschaftsausübung/en mehrerer (bis gar aller)
Menschen über sich/einandere/Dich
ersetzlich/substituiert wäre, oder werden wird.
hin zur ewigen [sic! doch eher (also:
soweit Ziel-Erreichung erträglich) ‚überraumzeitlich‘, semitisch-resch-waw-chet
qualifiziert, anstatt immanent/‚griechisch‘
verteilungsparadigmatisch (abzutrennend-beschränkt) deutend,
gebraucht/gedacht; O.G.J. durchaus mit ‚philosophischer/theologischer-Beweglichkeit‘
über/in Denkensgeschichte …] „Endherrschaft von Gott her“
(Dan 2,44f [vgl.
auch Jer. 31, 31-34])
zu verstehen.» Was also/eben durchaus-ups von
unausweichlichen Versöhnungsfragen, gleich gar mit
gegenwärtig (respektive vorher) Vorfindlichem und damit/daraus
Machbarem, zu unterscheiden wäre/bleibt – jedenfalls, bis ‚zudem/dazu/dawider‘,
nicht durch die Herrschaftsausübung/en mehrerer (bis gar aller)
Menschen über sich/einandere/Dich
ersetzlich/substituiert wäre, oder werden wird. 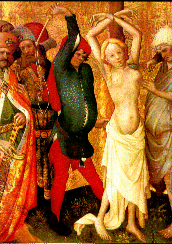 Gleich gar nicht deckungsgleich so manch
omnipräsenten Drohungen, und deren (Hoffnungen – gar
vorzugsweise ‚Leiden, Lasten, Nutzen maximierenden‘) ‚um-zu‘-Rechtfertigung(sversuchung)en,
entsprechend, ‚vom gegenwärtigen Leben / Entscheidungs-Verfahrensweisen erlösend
zu befreien‘. «In der
„Fülle der Zeiten“ [gar ‚Gleichzeitigkeiten‘? O.G.J.] wird es kein malum physicum und
kein malum morale [sic! wobei, und wovon, auch all
die (dreizehn übrigen) Modalitäten nicht auszunehmen / zu ‚übersehen‘ wären; O.G.J.] mehr geben. Als Erlösungsreligionen [sic! doch wohl gerade diesbezüglich, nicht
rückwärtsgerichtet wiederherstellend oder Verlorenes zurücksuchend, sondern
eher ‚übertreffend vollendend‘; O.G.J. zumindest Judentümmer
nicht
brav griechisch-lateinisch auf ‚religio‘ oder Theologie bzw.
Philosophie reduzieren s/wollend] richten Judentum und Christentum ihr
Augenmerk aber nicht nur hoffend auf die Endvollendung und Neuwerdung,
sondern auch auf Vergangenheit und Gegenwart. Die Erlösung hat in der
Vergangenheit begonnen und leuchtet bei ihrem Vordringen in die [sic?
oder aber ‚aus der‘ / ‚von anderswo/auch den Himmeln / außerraumzeotlich
her‘? O.G.J. gänige ‚end‘-Begrifflichkeiten wenigstens unendlichkeitsmathematisch hinterfragend bis transzendierend]
Gleich gar nicht deckungsgleich so manch
omnipräsenten Drohungen, und deren (Hoffnungen – gar
vorzugsweise ‚Leiden, Lasten, Nutzen maximierenden‘) ‚um-zu‘-Rechtfertigung(sversuchung)en,
entsprechend, ‚vom gegenwärtigen Leben / Entscheidungs-Verfahrensweisen erlösend
zu befreien‘. «In der
„Fülle der Zeiten“ [gar ‚Gleichzeitigkeiten‘? O.G.J.] wird es kein malum physicum und
kein malum morale [sic! wobei, und wovon, auch all
die (dreizehn übrigen) Modalitäten nicht auszunehmen / zu ‚übersehen‘ wären; O.G.J.] mehr geben. Als Erlösungsreligionen [sic! doch wohl gerade diesbezüglich, nicht
rückwärtsgerichtet wiederherstellend oder Verlorenes zurücksuchend, sondern
eher ‚übertreffend vollendend‘; O.G.J. zumindest Judentümmer
nicht
brav griechisch-lateinisch auf ‚religio‘ oder Theologie bzw.
Philosophie reduzieren s/wollend] richten Judentum und Christentum ihr
Augenmerk aber nicht nur hoffend auf die Endvollendung und Neuwerdung,
sondern auch auf Vergangenheit und Gegenwart. Die Erlösung hat in der
Vergangenheit begonnen und leuchtet bei ihrem Vordringen in die [sic?
oder aber ‚aus der‘ / ‚von anderswo/auch den Himmeln / außerraumzeotlich
her‘? O.G.J. gänige ‚end‘-Begrifflichkeiten wenigstens unendlichkeitsmathematisch hinterfragend bis transzendierend]
 Endzukunft hintergründig auch in der Gegenwart auf. Christliches
Erlösungsbewußtsein [sic!] steht im Konnex zu jüdischen Erlösungserfahrungen und
-hoffnungen, da [sic! was weder die einzige, noch die entscheidende
Erklärung / Begründung bleiben muss; O.G.J. mit ‚gnostisch‘-denkend
bis ‚antihumanistisch / menschenverachtend‘- angehauchten Determinismusverdachtsmomenten, wie sie teils auch Ka.Ha. und
zumal J.N.R. anführen] die Erlösungstat [sic!] des Juden Jesus sich in Jerusalem
ereignete in einer Zeit, da das jüdische Volk [sic!] schwerste Erniedrigungen und
Beschämungen seitens heidnischer
[sic!] Besatzungsmächte
über sich ergehen lassen mußte. Als jüdischer Märtyrer gab [sic!
allerdings ist beides (gar auch ‚innerhüdich‘ und gleich gar doktrinär)
strittig: sowohl der Tempus der (zudem vollendeten) Vergangenheitsform; als
auch diese Persönlichkeit, welches (gar märthyrerisch gedeuteten), bis
singularisierten, Messias / Gotteskbechts, in/als/namens Jeschua; O.G.J. mit
J.J.P. u. Cl.Th. daselbst] Jesus
sein Leben als Lösegeld „für die Vielen“ hin ( Jes 52,13-53,12). [Gar
‚nicht nur für die, bis anstatt Wenigen/r‘? O.G.J.]
Endzukunft hintergründig auch in der Gegenwart auf. Christliches
Erlösungsbewußtsein [sic!] steht im Konnex zu jüdischen Erlösungserfahrungen und
-hoffnungen, da [sic! was weder die einzige, noch die entscheidende
Erklärung / Begründung bleiben muss; O.G.J. mit ‚gnostisch‘-denkend
bis ‚antihumanistisch / menschenverachtend‘- angehauchten Determinismusverdachtsmomenten, wie sie teils auch Ka.Ha. und
zumal J.N.R. anführen] die Erlösungstat [sic!] des Juden Jesus sich in Jerusalem
ereignete in einer Zeit, da das jüdische Volk [sic!] schwerste Erniedrigungen und
Beschämungen seitens heidnischer
[sic!] Besatzungsmächte
über sich ergehen lassen mußte. Als jüdischer Märtyrer gab [sic!
allerdings ist beides (gar auch ‚innerhüdich‘ und gleich gar doktrinär)
strittig: sowohl der Tempus der (zudem vollendeten) Vergangenheitsform; als
auch diese Persönlichkeit, welches (gar märthyrerisch gedeuteten), bis
singularisierten, Messias / Gotteskbechts, in/als/namens Jeschua; O.G.J. mit
J.J.P. u. Cl.Th. daselbst] Jesus
sein Leben als Lösegeld „für die Vielen“ hin ( Jes 52,13-53,12). [Gar
‚nicht nur für die, bis anstatt Wenigen/r‘? O.G.J.]
Begriffe und Inhalte [sic!/?/-/. Dass, äh falls, es ‚der Gnosis‘ –
zumal (‚Rech thabend / bekommend‘) Verteilungsparadigmatischs
‚übersehen/d‘ (einander / sich) verheimlicht (mittels Aufklären
und Verbesserungen bis Zwingen – s/wollend
bis getan [vorgestellt])
– um
Erlösung vom CHeT / ‚nahezu
Zerreißendem‘ חטא׀עבירה
:חיים \ Leben, äh (allmächtige) Widerspruchsfreiheit, geht] Semitische
Denken erlauben Ihnen / sich / uns: ‚Referenzen‘
רמז ![]()
Die Rabbinen
erklärten die Erlösung [sic! insofern und zumindest von daher ein definitorisch prekärer Oberbegriff, aus einer Reihe gleichrangiger bedeutungsähnlicher,
inhaltparalleler / teilreichweitenüberlappender anstatt identischer / trennscharfer Ausdrücke; O.G.J.] Weder Japheten, noch ‚Heiden‘, noch Griechen, noch Christen zur Gnosis
gezwungen, doch auch Semitinnen, Kabbalistinnen und Apostellinnen dafür
anfällig / dazu ‚verfrustrierbar‘.
#olaf#jojo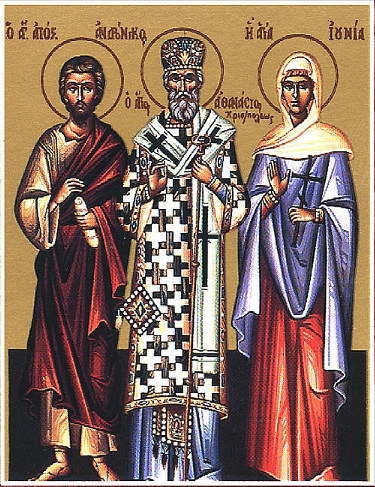
oft mit Ex
6,6-8: „Sag den Israeliten: Ich bin der Ewige, ich werde euch aus dem
Frondienst Ägyptens herausführen
(hôze'tî) [הוצאתי], ich werde
euch aus ihrer
Sklaverei
befreien (hizzaltî) [הצלתי], ich werde
euch
loskaufen (ga'altî) [גאלתי], ich werde
euch mir
zumeinem Volk [sic!] nehmen (laqachtî) [לקחתי] ... und ich
werde euch hinein führen (hewe'tî) [הבאתי] in das Land, das ich Abraham,
Isaak und Jakob versprochen habe.“
Entsprechend den fünf Verben verstanden die Rabbinen Erlösung als ein
Herausführen, Heraus-
- 54 –
holen aus
der Unterdrückung, als Befreiung, Loskauf, Annahme
und
Hineinbringen an den Ort der Sicherheit [sic! gar, oder
immerhin (auch nicht etwa alleine) ‚geographische / strategische /
territoriale‘, eben keineswegs ohne, sondern eher in und trotz CHeT; O.G.J.
namentlich /schalom/ als solches / tieferes / weitergehendes eher qualifiziert aufgehoben (als buchstäblich /
darauf beschrämkt erlebend] und Geborgenheit. Diese fünf Tätigkeiten
vollführt Gott selber „mit hoch erhobenem Arm und durch gewaltige Strafgerichte
hindurch“. Die drei Verse fanden auch deswegen bei den Rabbinen Beachtung,
weil sie vor dem Auszug
aus Ägypten stehen und trotz dem in der Vergangenheitsform stehen. So
konnten sie für die Erlösung in der
Vergangenheit und in der Zukunft in Dienst genommen werden: für die erst [‚immerhin‘: O.G.J.] spurenhafte Erlösung und für
die [sic! gleichwohl nicht notwendigerweise / nur
untätig, passiv, gar beschleunigungsfähig; O.G.J. mit J.J.P.] zu
erwartende Enderlösung.
Laut yPes 10,1 (37c) sind die vier ersten
Verben von Ex 6,6-8 ein Hinweis auf die vier Becher des
Zornes, die Gott dem Pharao wegen seiner Weigerung, das Volk [sic! zu der
Zeit wohl am eindeutigsten ‚kein Volk‘ im üblichen gänigen nicht-semitischen
Wortverständnis suwawe soziologischen Figuration; O.G.J. mit einem Fachausruch
von No.El.] Israel
ziehen zu lassen, verabreicht hat. Dieselben vier Becher reichte Gott auch den
vier israel- und
gottfeindlichen Weltreichen (Dan 2,7).
Mit den Zornesbechern sind somit auch „die vier
Heimsuchungen“ (pûranût) [#hier] gemeint, „die Gott den Völkern
der Welt zu trinken geben wird“. Dem gegenüber
reicht Gott dem Volk [sic!] Israel
„vier Becher des Erbarmens“, d.h.
„vier Becher der Erlösungen“.
Mit den fünf Verben aus Ex 6,6-8 ist der
Erlösung bezeichnende Wortschatz noch nicht ausgeschöpft. Die wichtigsten
Substantive sind yeschu'ā (Heil) [#hier], ge'ûlla (Erlösung) [#hier], pidyôn (Loskauf) [#hier], cherût (Freiheit)
[#hier], qez (Ende) [#hier] usw.
Dazu kommen Ausdrücke
und Redeweisen, die den Ablauf des endzeitlichen
Erlösungsprozesses andeuten: „die Fußspuren des Messias ('iqbôt
ham-maschiach) [#hier], die Leiden der messianischen Zeit (chevlê
ham-maschiach) [#hier], die Tage (Zeit) des Messias (yemôt
ham-maschiach) [#hier], die Endzeit
(‚ātîd lavô') [#hier], die kommende Welt (ha'ôlam hab-ba') [#hier] usw.
Anfang und Vollendung der Erlösung
Nach Ps 107,lf. sollen
die Israeliten den Ewigen preisen, weil sein Erbarmen ewig währt, denn sie sind
„die Erlösten des Ewigen (ge'ûllîm) [], die er
aus der Bedrängnis erlöst hat“. Die Israeliten sind also bereits Erlöste, und
sie erfahren als Erlöse täglich das Erbarmen Gottes. Das Anfangsdatum der
Erlösung Israels ist in der rabbinischen Tradition umstritten: Hat die göttlich
initiierte Erlösung bei der Erschaffung
des Menschen begonnen, zur Zeit der Patriarchen, beim Auszug aus Ägypten oder
bei der Toraverleihung auf dem Sinai? Mehrere Rabbinen verbinden
den Anfang der Erlösung mit der ersten Stiftung
jüdischer Hochfeste zur Zeit des Auszuges aus Ägypten, der Verleihung der Tora
und der Wüstenwanderung: Pesach, Neujahr und Versöhnungstag. Im 2. Jh. n. Chr.
wurde die Frage nach dem liturgischen Anfang der Erlösung besonders von Rabbi
Eliezer und Rabbi Jehoschua ben Chananja
kontrovers diskutiert. Laut bRHSh l10b-1la sagte Rabbi Eliezer:
„Am Neujahrsfest wurde die Knechtschaft von unsern Vätern
weggenommen, im Monat Nisan (Pesach) wurden sie erlöst und im Monat Tischri
(Versöhnungstag) werden sie dereinst erlöst.“ Rabbi Jehoschua wollte dem
gegenüber weiter ausgreifen: „Im Monat Nisan wurde die Welt erschaffen, auch
die Väter wurden in diesem Monat geboren und starben in diesem Monat. Zu Pesach
wurde Isaak geboren ... Am Neujahrsfest ... wurde die Knechtschaft von unsern
Vätern in Ägypten weggenommen. Im Monat Nisan wurden sie erlöst, und sie
werden auch im
Monat Nisan endzeitlich erlöst werden.“
Die meiste Zustimmung für den Anfang der
Erlösung erhielt der Monat 55 - Nisan, der Monat des Auszuges aus Ägypten und
des Pesachfestes. In MTeh zu Ps 107,If (Buber 461) wird dazu Jes 48,11 erwogen;
„Um meinetwillen, ja um meinetwillen tue ich es.“
Aus der zweimaligen Beteuerung Gottes wird
gefolgert, daß auch die Enderlösung am Pesachfest sein wird.
Gott habe zu Israel gesagt: „Als ihr in Ägypten
wart, habe ich euch um meines Namens willen erlöst. Auch in Edom (d.h. unter
der Herrschaft des letzten Hauptfeindes Israels) werde ich dies um meines
Namens willen tun . . . Wie ich euch in dieser Welt erlöst
habe, so werde ich euch in der kommenden Welt
erlösen.“
Wegen der Erlösungsspur von der Erschaffung der
Welt bis zur Erlösungsfülle am Ende [sic! das wohl besser treffebder mut dem Begriff
‚Fülle der‘ getroffen: O.G.J. mit Cl-Th.] der Zeiten hatte das Pesachfest schon in vorchristlicher Zeit vier
Festgeheimnisse: Erschaffung der Welt, Geburt Isaaks, Fesselung Isaaks auf dem
Opferaltar (Gen 22), Auszug aus Ägypten und messianische Enderlösung (vgl. CN 1
zu Ex 12, 42) . Die Juden wurden außerdem liturgisch und homiletisch ermuntert,
siesollten an Pesach und überhaupt immer nicht nur die Hoffnung auf die
Vollendung der
Erlösung am Ende [sic!] der Zeiten in ihren Herzen nähren, sondern auch die Erinnerung an
die Anfangserlösungen in
der Vergangenheit. [Diese doch
wohl gleich gar nicht abwertend? O.G.J.] Gott sage zu den Israeliten täglich: „Zu jeder Zeit, da ihr
meiner gedenket, wird mein Inneres für euch
aufgewühlt!“ Gott habe „die Israeliten nur erlöst, weil sieseiner Wunder
gedachte n ... und er wird zur endzeitlichen vollen Rettung kommen“
( MTeh zu Ps 70, 1ff. Buber 3210 -
Die Enderlösung wird die Anfangserlösung an
Dramatik, Glanz und Glück weit übertreffen. I m Anschluß
an Jes 11,11 („An jenem Tag wird der
Ewige seine Hand zum zweiten Mal erheben, um
den Rest seines Volkes [sic!] zurück
zu gewinnen ... “), heißt es in der
jüdischen Liturgie im Musaf des Sabbats und der
Feiertage: „Einer ist unser Gott, er ist unser Vater, er ist unser König, er
ist unser Retter (môschi‘enû) [], und er
wird sich für uns in seinem Erbarmen zum zweiten Mal vor den Augen aller
Menschen hören lasse n, um für euch Gott zu sein.“
Die partielle Erlösung
In der Mekhilta zu Ex 15,18 („Der Ewige wird
König sein für immer und Ewig”; S. 150f) wird die Ansicht vertreten, die
Israeliten seien beim gottgewirkten Durchzug durch das Meer
vor einer Ganzhingabe an den Ewigen zurück
geschreckt und hätten dadurch den damals von Gott geplanten vollen Anbruch der
Gottesherrschaft bzw. der Enderlösung weggeschoben. Wenn sie damals gesagt
hätten: „Der Ewige ist König für immer und ewig“, dann wäre die
Enderlösung schon damals im Volke [sic!] Israel Wirklichkeit geworden.
Mit dem
Problem der nur partiell und temporär realisierten Erlösung haben die Rabbinen
immer wieder schwer gerungen. In MTeh zu P s 31 (119-121) wird darüber ein
Sinn-Dialog zwischen
Gott und Israel geführt. Gott sagt zu Israel:
„Ich habe dich erlöst! Ich habe ein Wort gesprochen, und es ist zur Tat geworden!
... Ich . . . habe gesagt, daß ich euch erlösen werde, wie ich euch erlöst
habe!“ Daraufhin wenden die Israeliten ein: „Hast du uns nicht bereits erlöst
durch die Hände Moses, durch die Hände Josuas, durch die Hände der Richter und
Könige? Wir aber sind jetzt zurück geworfen und sind wieder unterjocht! Und wir
sind in der Beschämung, als ob wir nicht erlöst worden wären!“ Die letzte
Antwort Gottes lautet: „Da eu re Erlösung durch Menschen geschah, und da eure
Führung durch Menschen geschah, die
- 56 -
heute da sind und morgen im Grab, ist eure
Erlösung nur die Erlösung einer Stunde. Aber in der Endzukunft erlöse Ich euch
durch mich selbst, denn Ich bin lebendig und immer während! Ich
werde euch eine immerwährende Erlösung für alle
Ewigkeiten bereiten!“
Nöte vor
der Vollerlösung  [Beachtliches von, gar anti-gnostischen
Einsichten ‚War der Endzeitkalender noch nie
zuvor so sicher (wie jetzt)?‘, hier
namentlich nit Ka.Ha.s-Hinweisen bis zu ups alternierenden
Zeitchronologisierungen aus/in/von biblischen Textverständnissen]
Noch so artig / deutlich צמצום zurückhaltend ändert
den/der Überwältigtheiten / Überzeugtheiten Status conflictus auch/gerade kaum eine Beziehungsrelation – beeinflusst vielmehr ob bis wie der oft
‚inhaltlich‘ oder gar ‚sachlich‘ genannte (dennoch: zwischenmenschliche)
Konflikt
(innermenschlich/dyadisch/persönlich/versönlich) aus- bis
durchzuhalten, respektive
beziehungsunterbrechendes bis beendendes / tötendes Verhalten zoft
bis vererbt.
[Beachtliches von, gar anti-gnostischen
Einsichten ‚War der Endzeitkalender noch nie
zuvor so sicher (wie jetzt)?‘, hier
namentlich nit Ka.Ha.s-Hinweisen bis zu ups alternierenden
Zeitchronologisierungen aus/in/von biblischen Textverständnissen]
Noch so artig / deutlich צמצום zurückhaltend ändert
den/der Überwältigtheiten / Überzeugtheiten Status conflictus auch/gerade kaum eine Beziehungsrelation – beeinflusst vielmehr ob bis wie der oft
‚inhaltlich‘ oder gar ‚sachlich‘ genannte (dennoch: zwischenmenschliche)
Konflikt
(innermenschlich/dyadisch/persönlich/versönlich) aus- bis
durchzuhalten, respektive
beziehungsunterbrechendes bis beendendes / tötendes Verhalten zoft
bis vererbt. 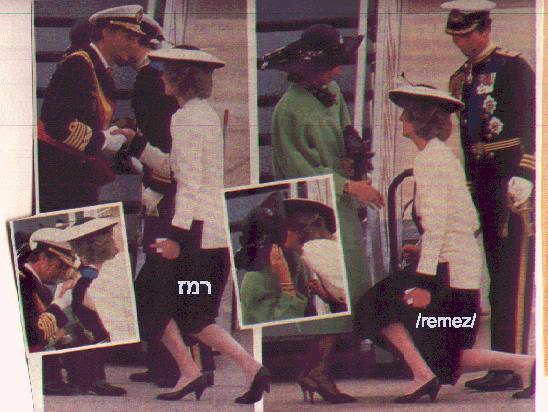
Seitdem das Buch Daniel mit seinen eindrücklichen
Schilderungen der Nöte der Endzeit kanonische Anerkennung
gefunden hatte, und seit dem das Joch der
Seleukiden und Römer schwer auf Israel lastete, griffen angsterfüllte [Schrecken; O.G.J.] apokalyptische Vorstellungen und Phantasien um sich. Kriege,
Krankheiten, Unterdrückungen, Zerfall, Abfall von der Religion, Dekadenz der
Gesellschaft, Resignation usw. werden dem Kommen des Messias vorangehen. Viele
meinten, das Ende der Notstrecke berechnen oder gar mit Waffengewalt [sic!
respektive sonstigen ‚Gewalten‘, bis ‚methodisch‘; O.G.J.] herbeizwinge n zu können. Laut Midrasch zum
Hohen Lied ( zu 2,7/36c) beschwor Gott Israel, „sich
nicht gegen
das Joch der Weltvölker zu empören; und er
beschwor auch die Weltvölker, das Joch auf Israel nicht allzu schwer zu
machen“. Aber mitten in apokalyptischen Ängsten flammte das Zutrauen
in Gottes souveräne Erlösermacht trotz aller
Sünde [sic! ‚Zielverfehlung/en‘, das bestenfalls unglückliche
Sein-gefärdende Wort taucht so folgenreich erst deutlich später …; O.G.J.] auf, Laut bSan 97b wies
Rabbi Jehoschua im 2. Jh. n. Chr in diesem
Zusammenhang auf Jes 52, 3 hin: „Umsonst wurdet ihr verkauft, aber ihr werdet
nicht mit Geld erlöst werden.“ Israel sei wegen seine Götzendienerei „umsonst“ verkauft worden.
Wichtiger aber sei der zweite Teil
des Satzes: Israel werde nicht mit Geld erlöst
werden: „Nicht durch Buße und nicht durch gute Werke!“" Die Vollerlösung
kann letztlich nicht verdient werden. Sie ist ein freies Gnadengeschenk
Gottes nach vielen Leiden und Katastrophen des
Volkes Gottes.
Erlösung und jüdisch-christlicher Dialog
Es ist auch von christlicher Warte aus
unsinnig, ohne Wen n und Aber zu sagen, die Christen seien erlöst, die Juden
aber seien noch nicht erlöst. Vielmehr ist die Enderlösung in Judentum und
Christentum grundgelegt. Sie ist als Saatgut ins Volk Gottes [sic!]
eingepflanzt und wächst dem Tag der Reife und der Früchte entgegen. Die
Erlösungstat Christi [sic!] bedeutet
eine Eingliederung und Anpassung an die noch unfertige Erlösungssituation des
jüdischen Volkes. Beide Völker
[sic! hier erweist sich der eingeführte/geläufige
ethnozentristische bis kulturalistische Sprachbebrauch für beiderlei
soziokulturelle Figurationen als besonders prekär; O.G.J.] – das christliche und das jüdische – wachsen
und reifen nun der von Gott zu schenkenden Erlösungshoffnung entgegen.
Das Neue, Zusätzliche [sic!
der Universalismus ist allerdings
bereits und gerade der Hebräischen Bibel bekannt, wie J.J.P. unf Cl.Zh.
herausarbeiten; O.G.J.] der
Erlösungstat Christi besteht zunächst [sic!] einmal in der Ausweitung: Alle Völker [sic?
oder gar doch, bis eher mehr oder minder kollektive Personen ungeachtet ihrer
Herkunft? O.G.J.] werden
in das Erlösungswachstum des Volkes [sic!] Gottes hinein genommen.
Bei seinen Besuchen des Synagogengottesdienstes
in Nazaret (vgl . Lk 4,16-30) hat Jesus ohne Zweifel
das jüdische Gebet „U-ha' le Zion go'el“ (Der Erlöser wird zum Zion
kommen) mitgebetet. In den ältesten Teilen dieses Gebetes heißt es u.a.:
„Gelobt sei er unser Gott, der uns zu seiner Ehre geschaffen und uns von den
Irrenden getrennt hat, der uns die Tora der Wahrheit gegeben hat und der ewiges
Leben in unsere Mitte eingepflanzt hat.
Er möge unser Herz durch seine Tora öffnen und
seine Liebe und Furcht in unser Herz legen, damit wir seinen Willen tun und ihm
mit vollem Herzen dienen, und damit wir nicht Leerem nach jagen und nichts zum
Schrecken erzeugen. Es möge dein Wille sein,
Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, daß
wir deine Gebote in dieser Welt beachten, damit wir würdig werden, zu leben, zu
sehen und Gutes und Segen zu erben für die Tage des Messias und für die
kommende Welt.“ - Jesus wollte durch sein Leben, Leiden
und Sterben die im jüdischen Volk bereits
sprossende Pflanze der Erlösung begießen und aufrichten und darüber hinaus
ewiges Leben in die Herzen aller Menschen einpflanzen, damit alle
Menschen dem Tag der Enderlösung entgegen
wachsen können.
/
Jesus von Ny/.aret. Judentum. Dialog. Pesaeh.
Sünde
und Vergebung.
Literatur:
Ä. H i r x h , Israels Gebete, Frankfurt
1921,
.187-.191; J. N e u x n e r I W. G r e e n / E . F r e -
r i c l n , Judaisms and their Messiahs at the
Turn of
the Christian Era. Cambridge 1997; C. S
c i m l e m .
Erlösung
durch Sünde. Judaica 5. Frankfurt
1992;
C. T l i m m i (Hrsg.). Zukunft
in der Gegenwart,
Wegweisungen
in Judentum und Christentum.
JudChr I .
Bern 1976; i l e r s . . Das
Messiasprojekt,
Augsburg
1994. T
» (Erweiterte
3. Neuauflage 1997, S. 54-57;
verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) ![]()
 [Ihr dürft Euch
erheben Milady. – ‚Männer‘/אדם verfehlen Ziele]
Sogar /
Gerade in berühmtesten
Anstiftungsfällen.
[Ihr dürft Euch
erheben Milady. – ‚Männer‘/אדם verfehlen Ziele]
Sogar /
Gerade in berühmtesten
Anstiftungsfällen. 
«Eschaton /
Eschatologie
Gemeinsamer Bezug zum Eschaton [sic! den griechischen Begriff nicht notwendigerweise
vorziehend: O.G.J. gar mit R.Ch.Sch.]
Judentum
und Christentum sind endzeitbezogene [sic! allenfalls ‚auch‘, doch
weder nur noch hauptsächlich; O.G.J. diesseitige Interessenlagen
entblößend] Religionen [sic! doch auch nicht nur dies,
zumindest in Recht setzenden und durchsetzenden Absichten ; O.G.J. nicht nur
bei ‚monotheistisch‘-genannten/gescholtenen
kulturaklistisches/partikularistisches Bemühen er- bis anerkennen könnend /
Universalismen reduzierenkritisieren dürfend].
Bei beiden bedeutet „die Herrschaft Gottes“ (malkhut schamayim /
hasileia lou theou) eine gegenwärtige und eine künftige Wirklichkeit
(bes. seit Dan 2).  [PaRDeS-Fragen-פרד״ס des definitorisch( denkerisch empfunden)en philosophisch-theologischen versus semitischer Vor-Verständnisse
ups-zulassend, statt be/streitend: Weisheitlich qualifizierte, intelligente
(ק־ו־ה ‚Hoffnungen‘, א־מ־ן׀ה ‚Vertrauen‘ und אהבה ‚Lieben‘ sind/werden) Unendlichkeiten, haben gar Grenzenräder / Gegenüberheiten,
hören aber eben (mathematisches/‚des bis der Denkens‘ Grundlagenparadoxon) gar nicht auf]
[PaRDeS-Fragen-פרד״ס des definitorisch( denkerisch empfunden)en philosophisch-theologischen versus semitischer Vor-Verständnisse
ups-zulassend, statt be/streitend: Weisheitlich qualifizierte, intelligente
(ק־ו־ה ‚Hoffnungen‘, א־מ־ן׀ה ‚Vertrauen‘ und אהבה ‚Lieben‘ sind/werden) Unendlichkeiten, haben gar Grenzenräder / Gegenüberheiten,
hören aber eben (mathematisches/‚des bis der Denkens‘ Grundlagenparadoxon) gar nicht auf]  Rettungs- und Fesselungsseilvorstellungen treffen das
Gemeinte bis (kommend) Gegebene am ‚gnostischsten‘/wenigsten,
respektive hinterhältig, äh irrig.
Abb.-Norderker-Michaelsturm-beschriftet
Rettungs- und Fesselungsseilvorstellungen treffen das
Gemeinte bis (kommend) Gegebene am ‚gnostischsten‘/wenigsten,
respektive hinterhältig, äh irrig.
Abb.-Norderker-Michaelsturm-beschriftet
Jeder Mensch, alle irdische [sic! ‚himmlische‘ allerdings kaum
weniger; O.G.J.] Macht, die
ganze G eschichtszeit und die Religionsgemeinschaften als ganze [sic!] gehen dem universalen
[sic! ‚Wo, sooft und eben falls wir Menschen einen Teil von uns bekämpfen,
bekämpfen wir uns selbst‘ O.G.J. etal. sozial-psychgo-logisch,
spricht hier mein
‚innerer Schweinehund‘ oder Eure antignostische ‚Spiritualität‘]
 Endgericht Gottes entgegen, das zum
unverlierbaren Heil [sic!] der Menschen und zur Verwerfung der
böswillig im Bösen Verharrenden führt. Das Endgericht zur [sic! eine durchaus bereits/geade
fragwürdige motivationale Verzweckung, namentlich bei/falls Unverdienbarkeit/en
‚der Gnade‘, ‚der Liebe‘ pp. ernst genommen; O.G.J. durchaus Unterschiede / Verhaltens(wahl)folgen
erwartend, näher am gemeinwesentlichen ‚Futurim exactum‘-Verständnis
/ Existenz-Bewältigungs-Konzept,
als am ‚um-zus‘-Sanktionsprogramm,
des so ambivalenten ‚buchhaltergöttlichen‘, und so abnutzungsanfälligen]
Endgericht Gottes entgegen, das zum
unverlierbaren Heil [sic!] der Menschen und zur Verwerfung der
böswillig im Bösen Verharrenden führt. Das Endgericht zur [sic! eine durchaus bereits/geade
fragwürdige motivationale Verzweckung, namentlich bei/falls Unverdienbarkeit/en
‚der Gnade‘, ‚der Liebe‘ pp. ernst genommen; O.G.J. durchaus Unterschiede / Verhaltens(wahl)folgen
erwartend, näher am gemeinwesentlichen ‚Futurim exactum‘-Verständnis
/ Existenz-Bewältigungs-Konzept,
als am ‚um-zus‘-Sanktionsprogramm,
des so ambivalenten ‚buchhaltergöttlichen‘, und so abnutzungsanfälligen]
Belohnung und
Bestrafung [Denkens/Handelns, ohne dafür willkürlichem Gerechtigkeitsverzicht für
Bündnistreue unterliegen zu müssen, was zumal Jesus/jüdischerseits
‚Gottlosigkeit‘ als eigentliches Gegenteil von ‚Gerechtigkeit‘ entlarvt; O.G.J.
wider Maximierungen des Askese-versus-Libertinismus-Irrtums durch
Folgenverschiebung is Unendliche/Nie]
gehen in der
Endphase [sic! falls dies incht zu chronologisch/griechisch
definiert-vorausgesetztgedacht; O.G.J. mit A.K. etal. allgegenwärtuge
Raumzeitlosigkeit erwägend] der Geschichte bedrängende, umstürzend e und
auch restaurative Ereignisse voraus, welche die Welt [sic! soweit sich griechische und semitische Vorstellungen dusbetüglich überhaupt
verbunden lassen; O.G.J.] und die Geschichte für den ####nachtag
Endpunkt [sic!] Geschichte sich vollen Durchbruch schaffenden „Gott
alles in allem“ 1 Kor 15, 28) reif und bereit machen,###
's der alle diese Erwartungen und er ##gemsseme in ende Begriff hat sich in
christlichen Theologie „Eschatoloe“ bzw. die „Lehre
von den letzten Tagen“
eingebürgert,
#### tag auf jüdischer Seite besonders die Begriffe 'ätid vö (künftig
Kommendes) , yöm had-( Gerichtstag) , yöm
'adonay (Tag Ewigen) , ### fv (Ende), 'acharit hayim (Ende der Tage)
entsprechen [sic! zumindest nicht deckungsgleich
identisch; O.G.J.]. ### Im
Neuen
Testament [sic!] und im rabbinischen Judentum kommen
eschatologische Vorstellungen besonders in ####eichn
issen zum Ausdruck, ####n allem Anfang an war Gott für die
Ilten ein Gott
auf Zukunft hin 28, 10-22; Ex 3,14). Im Zeitalter der Apokalyptiker hielt die
israelitische Zukunftshoffnung eine spezielle Zuspitzung und Ausweitung. Weil
innergeschichtliche Hoffnungen (z.B. auf die Restauration der Davidsdynastie)
gescheitert waren und weil die Bedrängnisse seitens der hellenistischen Okkupationsmächte zum Abfall oder zum
Tod vieler Juden führten (Dan 9, 11; 1Makk1; Mt 24, 37-42), entstand eine erregte
Hoffnung auf den möglichst bald ostentativ, endgültig und umstürzend
in die Geschichte eingreifenden Gott, der den Verfolgten und Gestorbenen eine
neue postm ###ortale Existenz in seinem nach- und über-endzeitlichen Reich [sic!] verleihen
wird.
Irdische
Endhoffnungen
Im
Zusammenhang mit den über Raum und Zeit hinausgreifenden eschatologischen
Hoffnungen entstanden Vorstellungen über
Szenarien, die sich vor, beim und nach tag Übergang ins Endreich [sic!] Gottes
abspielen werden. Dabei ging es nie nur um Sachverhalte, sondern vor
allem um das Verhältnis der
sich in der
Vorendzeit wissenden Gemeinden zu den erhofften radikalen und alles Bisherige
übertreffenden
Neugestaltungen.
Man erhoffte sich im Zusammenhang mit dem eschatologischen „Umbruch der Zeiten“
(3 Sib 158) u. a. die Einsammlung der zerstreuten Israeliten {qihhüz
galuyiöt: Jes
27, 13; 60, 4;
Ez 37, 15-28; Joel 4, 1f u. ö.), den Aufbau des zerstörten Landes und die
Wiederherstellung von dessen Fruchtbarkeit und Pracht (J es 26, 1-4; Jer. 30, 17-20; Hos 14, 5-7), die
Durchsetzung der ####monolatrischen [sic!] israelitischen
Gottesverehrung bei allen Völkern, Stämmen und Nationen
(Dtn 6, 4;
Sach 14, 9; Dan 6, 26-28; vgl. Mt 8, 5-13 par; Röm 9-11; 1 Kor 15; Offb 7), den
Neubau Jerusalems als
Wohnstatt
Gottes, die Erneuerung des
- 61 -
Priestertums,
das Hineinströmen der Heiden nach Jerusalem (Jes 60), die Neuerrichtung der
Herrschaft Davids, die Befreiung von Fremdherrschaft und die Rückkehr vieler
Abtrünniger (Achtzehngebet; 'ä/ ( ####' « H - Gebet; Offb 20-22). Dieses
Szenarium blieb für die jüdisch e Geschichte prägend bis zum
neuzeitlichen
modernen Zionismus, der das Schwergewicht auf die Usnverzichtbarkeit der
irdischen, israel- und
jerusalembezogenen
Enderwartungen legte.
Jenseitige
Endhoffinmgen
Das Judentum
bezeugte zu allen Zeiten aber auch überirdisch-jenseitige eschatologische [sic!
zumindest vorhellenistisch allerdings nicht unter dieser Begrifflichkeit;
O.G.J.] Hoffnungen. Im rabbinischen Schrifttum wird betont, die
kommende Welt werde alle irdischen Endhoffnungen weit überragen
(PesK 22, 3: Gleichnis von der Rückkehr des Gatten: Thoma / Lauer 260-262).
„Diese Welt (ha-'ohim haz-zeh) gleicht einem Vorraum, der zur kommenden
Welt
(ha-'olam
hah-liä)### hinführt.
Rüste dich im Vorraum, damit du in den Speisesaal eintreten kannst” (Av 4, 16).
In „dieser
Welt, so die weitreichende rabbinische Auffassung, herrschen Ungerechtigkeiten,
Unterdrückung, Not, Tod. In der „kommenden Welt“ dagegen werden weder Tod noch
Leid, noch
Ungerechtigkeit,
noch Einengung, noch Haß sein, sondern nur [sic!] Gottes Liebe
und vollendetes unverwelkliches Menschenglück. So heißt
es in bBer 17a: „In der kommenden Welt gibt es weder Essen noch Trinken, noch
Handel, noch Vermehrung. Vielmehr sitzen die Gerechten mit ihren Kronen da und
erfreuen sich am Glanz der Schekhina.“
Hineingeschoben zwischen diese und die kommende Welt wurde bereits in
rabbinischer Zeit die messianische Zeit (yemöt ham-maschiach).
Bisweilen
wurde diese Zeit eher jenseitig, d. h. zur kommenden Welt gehörig, verstanden
(yBer 1,6). Meistens jedoch wurde die messianische Zeit diesseitig-endzeitlich
verstanden, Mose ben Maimon verhalf der zweiten Ansicht zum Durchbruch. Schon
in talmudischer Zeit war man in bestimmten Kreisen darauf bedacht, keine
körperlichen Vorstellungen mit der kommenden Welt in Zusammenhang zu bringen.
In bSan 99a heißt es: „Alle Propheten prophezeiten nur über die messianische
Zeit. Über die kommende Welt aber heißt es: ,Kein Auge
hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört außer dir, o Herr‘“ (J es 64, 3; vgl. 1
Kor 2 , 9). Für Mose ben Maimon war es bei der Erwägung dieses Spruchs wichtig,
daß es „in der
kommenden Welt weder einen Körper noch eine körperliche Form gibt” (Mischne
Tora, Buch des Wissens, Hilkhotteschua8) . Es konnte
sich aber weder die Auffassung, man könne von der kommenden Welt nichts sagen,
durchsetzen, noch die maimonidische Aussage von der absoluten Geistigkeit. [Insofern ohnehin eher ein
hellenistisch/griechisches Scheinproblem; O.G.J.] Der Hauptgrund für die
Opposition dagegen war die Auffassung von der in der kommenden Welt stattfindenden Auferstehung zur Belohn ung und Bestrafung.
Der ganze Mensch, bestehend aus Leib und Seele, müsse belohnt oder bestraft
werd en (bSan 91a: Gleichnis vom Blinden und
vom Lahmen).
Neutestamentlicher
Eigenweg
In der
Predigt Jesu von der Endherrschaft Gottes herrscht ein
eigentümliches Nebeneinander von Gegenwärtigkeit und Zukünftigkeit sowie
Diesseitigkeit und Jenseitigkeit. Einerseits
heißt es: „Die
Zeit ist erfüllt, die Herrschaft Gottes ist nahe; kehret um und glaubt an die
Frohbotschaft“ ( Mk 1, 15); es gehe jetzt darum ins Reich Gottes einzugehen (Mk 9, 47); dies sei
- 62 -
identisch mit:
ins Leben eingehen (Mk 9, 43).  [Ein/Das wachsen lassen im, bis vom, Garten]
Anderseits wird das schlechthin
selbständige, unverfügbare und unberechenbare Kommen der Gottesherrschaft betont
(Mt 24, 32 - 42; Lk 17,
[Ein/Das wachsen lassen im, bis vom, Garten]
Anderseits wird das schlechthin
selbständige, unverfügbare und unberechenbare Kommen der Gottesherrschaft betont
(Mt 24, 32 - 42; Lk 17,
22 - 37). Es ist eine neutestamentliche Wesensaussage, daß in Christus
[sic!] die Endherrschaft Gottes
grundgelegt und dargestellt ist und daß an ihm vorbei kein Heil [sic!] in der Endherrschaft Gottes
möglich ist (Joh 14, 6; 1 Petr 2, 1-10).
Die im Leben, Tod und in der Auferstehung Christi [sic!]
zum vollen [sic! ohne Wider- und Rückkehr-Topologien?
O.G.J.] Ausdruck gekommene Endherrschaft
Gottes wächst und entfaltet sich von ihm her zur letzten „ Fülle der Zeiten“ (Röm 11, 25-36; 1
Kor 15, 20-28; 1 Petr 1, 3-7). Abb. Jeschua-leuchter-fisch?? [Forschung fällt
auf wie jene, die innerraumzeitliche Gleichheitsideale aller vergotten, der
vielfaltenvielzahlen differenzen über- bis außerraumzeitlich rächen]
Jüdisch-christliche Bedeutung
Beim letzten [sic!] Endpunkt der
Menschheitsgeschichte, wenn alle und alles ins Endreich [sic!] Gottes übergehen werden,
wird es keine jüdisch-christliche Konkurrenz
vortag ### „ Gott alles in allem“ geben. Im Anschluß an I Kor 15, 28 bemerkte
Franz Rosenzweig (1876-1929): „An diesem Punkt, wo Christus [sic!] aufhört der Herr zu sein, hört Israel
### auserwählt zu sein; an diesem Tage verliert Go ####« den Namen, mittag ihn
Israel alle in anruft: Gott. Bis zu diesem Tage
aber ist es Israels Leben, diesen ewigen Tag in Bekenntnis und Handlung vorweg
zu nehmen, als ein lebendiges Vorzeichen dieses Tages dazu stehen, ein Volk von
Priestern, mit tagges### durch die eigene Heiligkeit den Namen Gottes zu
heiligen“ (Briefe Bd. I , 134f ) . Das
Hinschauen, Harren und Zugehen auf das Eschaton ist für Juden und Christen
glaubens- und [sic!] lebensbestimmend. Alle religiösen Risse und alles
menschliche Ungenügen werden im Eschaton in Gott aufgehoben [sic!] sein.
Von daher werden auch die jüdisch-christlichen Glaubensdifferenzen [sic!] ####- , Eenrelativ .Von eine m rigoristischen eschatologischen
denken kann jedoch auch eine Gefahr
ausgehen: Bestimmte jüdische Texte erwarten
ur eine jüdische Rechtfertigung im Eschaton, während die
Weltvölker scheitern (vgl. PesK 21, 3; Thoma / Lauer 252-256). Ähnlich [partikularistischen
Paradigmata der sozualen Ausschließung anderer/vieler folgend; O.G.J. mit den
Autoren] reden christliche Texe davon, daß nur eine christliche Rechtfertigung
stattf inden wird. Ein eschatologisches Denken ist nur dann für alle zum Segen,
wenn mittag## 'älenü-Gtbex erwartet wird, daß alle Menschen ohne
konfessionellen und volksmäßigen Unterschied schließlich zur nbetung des [sic!
jedenfalls immerhin eines/ihres; O.G.J.] Namens des Gottes Israels gelangen
werden und daß dieser Gott auch fähig und willens ist, am Ende „alle Übeltäter
der Welt zu sich zu bekehren“ (ähnlich Röm 11, 25-32). Für die
jüdisch-christliche Begegnung ist ferner der zwar verschieden akzentuierte,
aber doch grundsätzliche Konsens wichtig, daß die eschatologischen Hoffnungen sich nicht
auf bloße Jenseitshoffnungen reduzieren lassen, daß
sie vielmehr mit irdischen Enderwartungen verbunden bleiben. Schließlich haben
Judentum und Christentum die Aufgabe, zu bekennen, daß das Eschaton nicht
errechnet, nicht herbei gedrängt und nicht verdient werden kann (gegen Zeloten
und Kreuzfahrertum). Die Enderfüllung der Geschichte ist ein Geschenk Gottes.
/"
Apokalypliic; Auferstehung; Bibel; Christus/
Christologie;
Gott; Messias; Neues Testament;
Reich
Gottes; Schekhina; Unsterblichkeil; Zionismus.
Literatur:
L Jacob.t. Herrschaft Gottes / Reich
Gottes
(Judentum), in: T R E 15, Berlin 1986,
190-196;
H . Kessler. Sucht den Lebenden nicht
bei
den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi in
biblischer,
fundamental-theologischer und systematischer
Sicht,
Düsseldorf 1985; F. Rosenzwein.
Briefe
und Tagebücher. 2 Bde. hrsg. v. R. Rosenzweig
/
E . Rosenzweig, Haag 1979; R . S c h n a c k e n b
u
r g (Hrsg.), Zukunft. Zur Eschattilogie bei Juden
und
Christen, Düsseldorf 1980; C. T h o m a /
S.
L a u e r (Hrsg.). Die Gleichnis.se der
Rabbinen.
Erster
Teil; Pesiqta deRav Kahana (PesK), Einleitung,
Übersetzung,
Parallelen, Kommentar, Texte,
Bern
1986. T
» (Erweiterte
3. Neuauflage 1997, S. ; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.) ![]()
|
[Respekt, weder ersetzen könnend, noch hinreichend ausdrückend / repräsentierend? תודה] |
Danksagungen, bis
Preisungen, zumal für/wegen, oder aber zumindest
anstatt, Erlösung/en sind/werden
nur allzu gerne bestenfalls überzogen. |
|
|
|
J.J.P. ‚Es lehrten unsere Meister‘ |
«Als die jüdischen
Gebetsformeln noch flüssig waren und nur die Reihenfolge der Gebete und ihre
Inhalte, aber noch nicht ihr voller Wortlaut,
festgelegt waren, da leitete einmal ein Mann den öffentlichen Gottesdienst in
der Anwesenheit des Rabbi Chanina. Der
Mann begann das Hauptgebet in folgender Weise: „Gelobt
seist Du, Herr, unser Gott
und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, großer,
allmächtiger, furchtbarer, prächtiger,
starker, ehrfurchtgebietender kräftiger,
gewaltiger, gewissenhafter und
verehrter Gott!“ Rabbi Chanina wartete, bis
der Mann damit fertig war, und sprach zu ihm: „Bist du nun endlich mit
den Preisungen deines Herrn zu Ende? Sieh mal, wenn Moses nicht selbst im
Deuteronomium 10, 17 geschrieben hätte, daß Gott
„groß, allmächtig und furchtbar“ ist
und
wenn die Männer der Synagoga
Magna diese drei Attribute nicht für
den Gebetstext angeordnet hätten,
dann dürften wir noch nicht einmal diese drei Attribute
im Gebet erwähnen. Du aber leierst
stundenlang göttliche Attribute her! Das
läßt sich mit dem Fall eines Königs vergleichen, der einen Schatz von
Millionen von goldenen Denarii besitzt. Und
nun kommen Menschen daher, die den König preisen, weil er silberne Denarii
besitzt. Wäre denn das keine Beleidigung für den König?“ ach b. Berakhoth 33 b; vgl. B. Megillah 25
a» (Jakob J.
Petchowski S.22-24; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) |
Orestes V. Trebeis, Herausgeber: |
»«Ein
[sic!] Wort zuvor
[…] VI. Zu danken habe ich ielen.
Ich nenne jedoch keinen69 [Zwei Ausnahmen muß
ich jedoch machen. … Übersetzer… und … Auswahlberater …]! Da
sich auch in den Wirtschaftswissenschaften – ein
weiteres Beispiel der Vertrocknung – die multiple choice breit macht, möge der [sic!] Leser sich einen ihm gefälligen Schlußsatz aussuchen (bitte zutreffendes ankreuzen): □ „Verbleibende Fehler gehen –um eine geläufige Wendung abzuwandeln
– voll zu ihren (der Ratgeber) Lasten. Nicht
zuletzt habe ich meiner Frau zu danken, die wie mein
Hund, der [kaum allein; O.G.J.] auf manche Spaziergänge verzichten mußte
– einen großen Teil der sozialen Kosten
dieses Buches getragen hat“70. □
„ . . .
Schließlich möchte ich auch meiner Frau
danken, die meine gelegentlichen Geistesabwesenheiten geduldig hinnahm und
während der Zeit, in der ich an diesem Buch arbeitete, ihre Ansichten über die
Qualität wirtschaftlicher Vorhersage taktvollerweise für sich behielt“71. □
„ . . . Frau Hannelore ... schließlich tippte
nicht nur, in mühevoller Arbeit
das Manuskript, sondern sie forcierte auch seine Fertigstellung mit der Drohung, sie werde kündigen,
wenn das Buch nicht bald abgeschlossen würde. So nehme ich lieber noch
bestehende Mängel des Manuskriptes in Kauf – und die mögliche Pointe des Kritikers, ich hätte es vielleicht doch
besser auf die Kündigung meinet
Sekretärin ankommen lassen sollen.“72. Mai 1991 O.V.T.» Nur verlinkende und ‚[eckig-verklammerte]‘-Kürzungen bis Hervorhebungen von O.G.J.; Druckunterschiede und Wahl-Icons im Original, Fußnoten mit Quellenangaben daselbst. |
|
|
|
|
|
:
 [Noch eine Reverenz, gar dem ‚lexikalischen‘
Bemühen der Autoren]
[Noch eine Reverenz, gar dem ‚lexikalischen‘
Bemühen der Autoren]
Umschreibungen und ein Beispiel
Im neutestamentlichen
[sic!] und im rabbinschen Verständnis sind Gleichnisse von Bibelerklärern und
Predigern gestaltete Kurzerzählungen mit einer Pointe (rabbinisch Chidilusch:
###uner wartete Neuheit, überraschende
Wendung der Erzählung), die Offenbarungsinhalte [sic!] verständlich,
anregend machen und in einem neuen Licht
erscheinen lassen sollen. Das Gleichnis hat zwei Ebenen: die Ebene der profanen
Erzählung (Ma.uhal. parcdxde, Rhema, Bildhälfte) und die Ebene der
Offenbarung [sic!] (Nimschal, Sachhälfte, Thema, das Gemeinte und Geforderte). [vgl. PaRDeS-Mnemowort-Konzepte bis Kommunikationsmodelle; O.G.J. mit der Deutungsbedarfsthese aller Interaktion/en überhaupt]
In der rabbinischen Tradition gilt König Salomo als erster großer Gleichniserzähler
und ###-deutendies wird besonders aus ####C an t1, : P r o v 1 , 1 , und Koh 12, 9 heraus
gelesen. Laut ShirR 1 , 8 erzählte Rav Nachman
folgendes Gleichnis : „Gleiche in e m großen Palast mit vielen Türen. Jeder,
der in ihn eintrat, ging von der Türe an den falschen Weg, Da kam ein Kluger,
nahm eine Schnurspule und befestigte sie für den Rückweg an der Tür. Nun
konnten alle eintreten und den Weg mittels der Schnur an der Spule f in den . So : Bevor Salomo kam, konnte
kein Mensch die Worte der Tora im rechten Verständnis erschließen. Als aber
Salomo kam, begannen alle die Tora zu interpretieren.“
Ein Gleichnis soll tag nach die Tora „begehbar“
machen und sie der religiösen Gemeinschaft praktikabel und plausibel vorlegen.
Damit wird das Gleichnis zu einem literarischen Ereignis und eine
mhermeneutischen Schlüssel zur Weitergabe der Tora. Die
Pointe imer wähnten Gleichnis ist die vom
Klugen angebrachtes chnurspule. Das Beispiel macht auch deutlich, daß die
Gleichniserzähler bei der Wahl ihrer Bilder und Metaphern ausein em Pool
schöpften, der durch aus auch mit giechisch-hellenistischen Vorstellungen und
Ideen durch tränkt war, diesie tag Zweck des Gleichnisses unterordneten.
- 70 -
Jesus und die Rabbinen
Jesus war einer der frühesten großen Gleichniserzähler.
Er ist damit auch ein prominenter Vertreter der frühen jüdisch-religiösen
Literaturgeschichte.
Die ca. 40 jesuanischen Gleichnisse woll endie
Offenbarung handhabbar machen . Das wichtigste
Stichwort des Gleichniserzählers Jesus ist das Reich
Gottes. Es beinhaltet bei ihm mehrere Aspekte der Offenbarung [sic!]
Gottes, besonders aber die praesentia Dei mitten im Volk [sic!] Gott es
und in der Menschheit sowie das Hineinwachsen der von Gott wirksam
Angesprochenen in seine Herrlichkeit (vgl. bes. das Gleichnis vom Sämann [Mt
13, 1-9. 18-23 par|; das Gleichnis vom Fisch netz [Mt l3, 47- 50]; das
Gleichnis vom großen Gastmahl [Mt 22, 1-14 par.]; das Gleichnis von den zehn
Jungfrauen [Mt 25, 1-13]; das Gleichnis [Exempel] vom reichen Mann und vom
armen Lazarus [Lk 16, 19-31] usw.). Auch unter den Rabbinen gab es große
Gleichniserzähler. Die hervorragendsten unter ihnen wirkten im 2.-5. Jh. in
Galiläa: Rabbi Meir, Rabbi Lewi,
Rabbi Berekhya, Rabbi Yochanan bar Napachau.###
a.
Insgesamt gibt es über 2000 rabbinische Gleichnise . Ca . 380 davon sind von Thoma / Lauer / Ernst
in drei Bänden kritisch ediert und interpretiert worden.
Die Frühphase der rabbinischen Gleichnisse war
im 1. und 2. Jh. Die klassische (amoräische) Phase war bes. im 3.-5. Jh . Dazu ist (in den späteren Midraschwerken) die
ausgiebige Spätphase vom 6.-11. Jh. (also bis ins frühe Mittelalter hinein)
hinzu zu nehmen. Diese Einteilung ist e ine rein zeitliche. Qualitativ
hochstehende Gleichnisse kommen in allen genannten Phasen vor. Die jüdische
Tradition hat das stets neue Gleichniserzählen bis
heute nie vernachlässigt. Die Kabbala
und der Chasidismus quellen geradezu über von viel fältigen
Gleichniserzählungen und -deutungen.  [Im/Das
Judentum schreckt der Vielfaltenvielzahlen des Denkens nicht – zumal da der
‚Sprung der Tat‘ wichtiger als (zumal griechisch-hellenistischer Prinzipialität, im Singular) jene des Denkens]
[Im/Das
Judentum schreckt der Vielfaltenvielzahlen des Denkens nicht – zumal da der
‚Sprung der Tat‘ wichtiger als (zumal griechisch-hellenistischer Prinzipialität, im Singular) jene des Denkens]
Ch ristlich -jüdische Relevanz
Die jüdische und die christlich e Religion [sic!] leben im starken Maße von
der Erzählung und von der Erinnerung (zikkaron, memoria). Beide
Religionen lassen sich weder auf Dogmen noch auf die Halakha reduzieren, wenn
auch diese beiden Elemente nicht bei Seite geschoben werden können. Christentun
und Juden ###hatten sich selbst und ihrem Gegenüber stets viel zu erzählen.
Durch Gleichnisse sind sie einander näher
gekommen.
Erzählungen sind in jeder Generation neu zu
gestalten. Ihr moderner paradigmatischer Hauptinhalt ist die vergangene und
gegenwärtige Enttweiungs- und Feindschaftsgeschichte im Licht der Offenbarung
[sic!] Gottes. Erforderlich ist eine Erzählkultur die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft im Blickpunkt hat. Die rabbinischen und jesuanischen Gleichnisse
sind in ihrem Kern ökumenisch und interkulturell. Sie bilden mündliche
Traditionen, die das Wirken Gott es für die je eigene Zeit reklamieren. Ihre
Brückenfunktion sollte gerade in der Zeit nach dem Holocaust kreativ
wahrgenommen werden.
/
Aggada; Jesus von Nazaret; Midrasch; Reich
Gottes.
Literatur: P. I X u h u t n i x f ! ' Rabbinische
Gleichnisse
und
das Neue Testament, JudChr 12, Bern 1988;
H
p . Emst. Dieschekhina in rabbinischen
Gleichnissen,
JudChr
14. Bern 1994; ß . Flus.ser. Die rabbinischen
Gleichnisse
und der Gleichniserzähler
Jesus,
I.Tcil: Das Wesen der Gleichni.s.se. JudChr
4.
Bern 1981; I ) . S t e r n . Parables in Midrash, Narrative
and Exegesis in Rabbinic Literature.
Cambridge
Mass. 1991; C, T h o m a / S. U i
u e r / H p
E
r n . i l . Die Gleichnisse der Rabbinen. 3
Bde.. JudChr
II).
13.16, Bern 1986 1991.1996: B . H . Y o u n n .
Jesus and His Jewish Parables.
Rediscovering the
Roots of Jesus' Teaching, New York
1989. T
»
(Erweiterte 3. Neuauflage 1997, S. ; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.) ![]()
[] „“
(Sp. Und erweiterte 3.
Neuauflage 1997, S.)![]()
Dankbarkeit und insofern recht (anstatt popularisierte/interessiert) verstandene Demut ziehen Intuitivität an (immerhin sogenannte 'Selbst-', genauer Alleinherrlichkeit schließt gegen s/Sie und von ihr ab – [un]bekanntlich eben selbst aggressiv zu deutender Tymos/JeTZeR drunten, überhaupt Unternehmertum, nicht notwendigerweise): „Gerade wenn man Erfolg gehabt hat, und das nicht nur feiert, sondern reflektiert, dann stellt man immer wieder fest: 'Ja, da haben doch viele [gar mehr als nur duldend: O.G.J.] geholfen. Da waren viele; die mich unterstützt haben, die mich gefördert haben, die mich beschützt haben, die mir den Weg geebant haben.' Und je mehr man dieses innere Bewustsein [sic!] der Dankbarkeit - das ist mehr ein Gefühl [eine nicht nur inner, also vieldeutig und vielfältig (atatt eindeutig und scharf fokusiert) ausstrahlbare, Einstellung bis Haltung; O.G.J.] - dieses Bewustsein der Dankbarkeit in sich pflegt und kultiviert [sic! Eher 'zivilisiert'? O.G.J.], das ist ein schöner Närboden für Intuition. .... Zusammenarbeit ist immer in erster Linie Wertschätzung: 'Ich muss [sic!] es [mir und/oder] dem anderen zutrauen.'“ Was gemeinschaftlich, gar gesellschaftlich [O.G.J.] zu kultivieren wäre, so dass andere erkennen: "die wissen worauf's [immerhin ihnen] ankommt. Werte haben heißt ja 'ich weiß worauf's ankommt.'" Auf allern Ebenen [interaktiver, hirachischer, inhaltlicher pp. Arten] zu wissen [sich sogar bis eher darauf zu verständigen? O.G.J.] was passieren soll und was nicht passueren dürfe. (Götz Werner)
Allerdings sind und werden Skepsis
und gar Zweifel – gleich gar 'nachträgliche' / wissbarkeitssensitive
und qualifizierte anstatt totaöitäre Formen selbst von Vorsicht und Revision
inklusive – ausgerechnet hier, im Hochschlosslügel geradezu zwischen Dasein und Erfahrung,
weder undankbar, noch schlecht – und gleich gar nicht in Abrede zu stellen.
Die/der Menschenheit verdankt
diesen – es sind und bleiben ja selbst und gerade – Achtsankeiten Vieles, nicht
Alles und auch nicht nur Gutes, doch und also sind
s/Sie – entgegen massiver, bebachbarer anderslautender Irrtümmer, vis Behauptungen – nicht der böse Feinmd des Vertrauens/(Glaubens
sondern sein (qualifiziert aufgehobenes) Korrektiv der dennoch Hoffmung bis bedingungslosen Liebe
- und schlichter Vertragsnotwendigkeiten
mit Verbindlichkeiten (also Schulden im Unterschied zu 'Sündenschuld')
und Verlässlichkeitsbedürfnisse.
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Unterm AHaWaH-Saal der gar qualifizierten
Liebe
MiLoT Ha-KeSSeM ‚Wunderwörter‘-Halle: SeLiCHa! ToDa! BeWaKaScha!
![]() E.B.
Gegenrechnung noch vor Theodize-Problem. (Vgl. auch was ein und das ebenso
schreckliche Ereignis einer Notlage/Katastrophe ‚vor 1755 und danach‘ bzw.
unter nicht mechanistischem Weltbild (‚Not lehrt beten‘) und im Bann bis Wahn
des/der Menschen den vollständigen, deterministischen Überblick zumindest über
die ‚Sphäre der Natur‘ zu bekommen bis zu haben ‚auslöst‘/Anlass bietet)
E.B.
Gegenrechnung noch vor Theodize-Problem. (Vgl. auch was ein und das ebenso
schreckliche Ereignis einer Notlage/Katastrophe ‚vor 1755 und danach‘ bzw.
unter nicht mechanistischem Weltbild (‚Not lehrt beten‘) und im Bann bis Wahn
des/der Menschen den vollständigen, deterministischen Überblick zumindest über
die ‚Sphäre der Natur‘ zu bekommen bis zu haben ‚auslöst‘/Anlass bietet)
Entschuldigung versus
Verzeihung 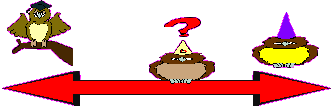
Zu den, eben nicht nur drunten, so besonders wirkmächtigen der basalen Unachtsamkeiten gehören die analoge Verwechslung bzw. univoke Gleichsetzung
vom einlößenden bis erlösenden Ende einer (gar jeden spezifischen? - **wie auch immer näher zu bestimmenden vorgeblichen und/oder tatsächlichen) Schuld
mit
dem Vergeben und/oder Verzeihen (zumal ausgerechnet auch noch als gerade deren Erlass bzw. Streichung, vorzugsweise als Fehler, aus der Erfahrung. - Also in der Rauschsphäre mehr oder minder äquivalenter von Leistung und Gegenleostungver- bis gefangen).
Ein zumindest protestantisches wenigstens Missverständnis, namentlich der Übersetzung in's Griechische und aus Begrifflichkeiten besonders der 'Vater-unser-Bitten' bzw. satisfaktionstheoretischen Erlösungsverständnisses nicht zuletzt des späten Augustinus, in der neuzeitlichen Geistesgeschichte, zumal der Ökonomie des Christentums mag - gar mitursächlich äh schuldhaft - daran beteiligt sein/werden.
The graceful apology - nicely timed
and sincerely, meant - is a curtsy to civility, a gesture that helps people put
up with each other, and keeps the little hassles within tolerable bounds.
Ja, ich, wir – bis gerade
G-tt – vergebe/n und verzeihe/n selbst sich/uns/mir respektive ausgerechnet
Ihnen/Euch, durchaus auch (sogar monetär unbezifferbare) Schuld/en, zuzmal
erlassend. – Nein, weder erfolgt solches (gar inklusive möglicher Vertöchterungen
und Versöhnung) bedingungslos / voraussetzungsfrei ohne Vorbehalte, oder
etwa ständig (namentlich aus/als Liebe oder Opfer) andauernd, noch irgendwie
(zumal rein einseitig), irgendwann von selbst / deterministisch automatisiert;
gleich gar nicht als/durch Entschuldigung / Sündenerlass, oder (zumindest
vergessender) Löschung/Vergehen des Geschehenen / qua Vernichtung (ziel)verfehlender Erfahrung,
bis magisch-wundersamer Versetzung an den rechten Ort, was – hinreichend genau
genommen – weder qualifiziert eint, gar gleich
macht, oder (etwa karmatisch oder wi[e]dergeährend) erneuert / repariert, noch jemand/etwas vollendet.
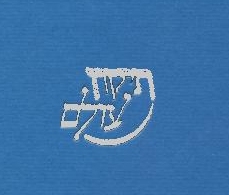
Eines der entscheidenden Gegenteile von Dank bzw. Dankbarkeit ist übrigens nicht so sehr Undank - sondern (die - masslose/unbedingte) Gier (bekanntlich durchaus mit Begierden verwandt - und keineswegs verzichtbar oder völlig schlecht bis anzuschaffen).
![]() Regel Nr. 18 sei:
Es ist besser um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis.
Regel Nr. 18 sei:
Es ist besser um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis.![]()
Mache Leute erzählen/messen und fühlen ja, dass Mimik oder nonverbale Kommunikation weniger Täuschungspotenziale mit sich brächten als etwa Wortsprachen, - Wir beobachten jedoch, dass selbst bicht-spontane, unautentische Versuche etwa zu Lächeln (aber auch traurig oder wütend auszusehen) durchaus einen, kleinen aber immerhin nachweislichen Effeckt auf die eigene (ja durchaus auch ansteckungsgefährliche) Gefühlslage haben. Der quasi - zumindest spiegelneuronake - Trick mit der Grundeinstellung 'Dankbarkeit' - namentlich für das wofür/worüber, man es autentisch sein kann (also eben nicht notwendigerweise/verkrampft bzw. spontan erzwungenfür das, gar jeweils Spezifische oder allgemeine, Übel) - weißt noch größere Potenziale auf - aber lässt sich noch weniger erzwingen/verordnen, als angemessene dosierte Gesten bzw. höfliche Form(ulierung)en.
![]()
![]() Zugleich ‚nebenan und
etwas tiefer‘ bemerkte immerhin Machiavelli, dass ‚Macht zu haben‘ dadurch charakterisierbar sei, ‚sich
nicht entschuldigen zu müssen‘ (Der Fürst).
Was es ja nicht notwendigerweise erleichern muss, dies zu tun.
Zugleich ‚nebenan und
etwas tiefer‘ bemerkte immerhin Machiavelli, dass ‚Macht zu haben‘ dadurch charakterisierbar sei, ‚sich
nicht entschuldigen zu müssen‘ (Der Fürst).
Was es ja nicht notwendigerweise erleichern muss, dies zu tun.
Der gar formelhafte bis ritualisierte Gebrauch von Worten und Gesten (Behavioremen überhaupt) kann - nicht zuletzt durch inflationären bzw. entwertenden Gebrauch - verkommen, indes ist der Anspruch, dass ihre Einsparung durch reine ihnen gar entsprechende Geistes- oder 'wenigstens' Körperhaltung zuersetzen bis bereits ausgeglichen sei kaum einzulösen/erfüllbar. - Auch beleidigt ein Zuviel an Höfkichkeit niemanden (ohne es ausschließen/verhindern zu können), während sowohl ein Zuviel wie ein Zuwenig an Formen sehr belastend sein/werden kann bis muss.
![]() Auch die /(einseitig
vorleistende bzw. einggehaltene) Logik der, gar der goldenen zumindest aber,
Rezipozitätsregel sorgt eben weder dafür, dass 'wer sich entschuldigt' auch
entschuldigt wird, noch dafür, dass sich deswegen überhauot keine Konsequenten (insbesonderesogar gerade ausgerechnet entschuldigten Verhaltens) ergeben. Nur weil die Entscheidungsbastion (namentlich des und der Anderen) von hier aus nicht (gleich gar nicht absolut
vorher)zu sehen ist, muss janicht auch die ganze Burghofseite
der Fasade des Handelns an und von diesem
Schloßflügel ignoriert werden.
Auch die /(einseitig
vorleistende bzw. einggehaltene) Logik der, gar der goldenen zumindest aber,
Rezipozitätsregel sorgt eben weder dafür, dass 'wer sich entschuldigt' auch
entschuldigt wird, noch dafür, dass sich deswegen überhauot keine Konsequenten (insbesonderesogar gerade ausgerechnet entschuldigten Verhaltens) ergeben. Nur weil die Entscheidungsbastion (namentlich des und der Anderen) von hier aus nicht (gleich gar nicht absolut
vorher)zu sehen ist, muss janicht auch die ganze Burghofseite
der Fasade des Handelns an und von diesem
Schloßflügel ignoriert werden.
Kausalitätsfanatiker – also, namentlich zeitgenössische, Menschen – sind/werden oft so bemüht, die (sie gar ultimativ erzwingende) Bedingung/Voraussetzungen für Vergebung zu finden, dass sie es versäumen sich und anderen zu vergeben.
Weitere, besonders wirkmächtige Irtümmer bis Fehler liegen hier in/an den omnipräsenten Verbindungen respektive Verwechslungen von Vergeben und Vergessen – den wohl zuverlässigsten Vorrausetzungen für Lern- und Erinnerungsversagen überhaupt (also für weitere solche und aueh andere Ziekverfehlungen). – Womöglich war oder ist mit der, aorachlich bis didaktisch bestenfalls unglücklichen, Vorstellungs-Verbindung (von Vergeben und Vergessen) etwas anderes (als noch ein Verzicht auf / Abschaffungsversuch des Futurum exactum /ZaCHoR wirklicher Weltwirklichkeit[en]) gemeint - nämlich etwa. sich und/oder dem/den anderen Verfehlungen und erst recht Verletzungen nicht (für immer anklagend und Entschädigungen bis Rache nzz. Entblößende Demütigungen verlangend) nach zu tragen / vor zu halten, duese (gar bereits denkmöglichen, virtuellen) schlechten/bösen Verhaltensweisen nicht zum Anlass für unendliches bis absolutes Misstrauen gegen sich/andere oder immerhin wider diese Person/en zu nehmen, respektive manche zumal wohlgemeinte (oder belehrende) Varianten mehr.
Nicht einmal das Beenden von Beziehungen bzw. Vermeiden künftiger Interaktionshandlungen mit seinen sogenannten ‚Schuldigern‘ (gleich gar und gerade im nicht-monetären, partnerschhaftlich wechselseitigen Sinne. respektive nach diesbezüglichem Ausgleich im Rechtsfrieden) taugt als Beleg gegen Vergebung (auch nur auf einer beteiligten Seite). Und hier trifft sogar auch einmal der Umkehrschluss zu: Auch noch so freundschaftlicher Umgang miteinander ist kein gültiger Beleg für duch Freiwilligkeit qualifizierte Vergebuung – sondern kann immerhin ein Zeichen/Ausdruck akzeptierter/anerkannter (durchaus rational angeratener, insbesondere auszudrückender bis allmählich zu übender, gar anstatt 'nur' bzw. spontan so empfundener pp.) Entschuldigung sein/werden.
![]() Zu den bestenfalls Missverständnissen über und von ‚Entschuldigung‘,
bekanntlich nur allzu gerne mit Vergebung interveriert, gehört: dass sie
(beide) mit Vergessen verbunden bzw. zu erledigen sei(en). Vorstellungen, die zwar bereits/spätestens mit jenen
Wirklichkeitskopepten des Vorfindlichen
(OLaM bis OLaMoT) konfligieren, die ein Futurum exaktum anerkennen (so dass
überraumzeitliches Bewustsein/werden Ereignisse eher umfasst und mehrstufig
aufhebt, eben qualifiziert repräsentiert, als sie
vernichtet; vgl. etwa die Denkform auswischbarer Aufzeichnungen als bis anstatt deren Handhabung, der sich etwa
Paulus sich griechisch, zur Veranschaulichung der alternierenden Umgangsangebote
G'ttes mit gar Ihren Zielverfehlungen
äh 'der Sündenvergebung', bedient); vor allem aber wird das Vergessen
(das nicht Erinnern AL ZaCHoR von Erfahrung, namentlich anstatt ihrer präsenten
Deutungsreflektion, womöglich anstatt ganz irritationsfreier Geborgenheit in
abgeschlossenem Sein) zum Lernverhinderer/Reproduktionsanführer - gleich gar
wiederholte Ereignisse bis 'charakterliche' Muster
von Verhalten betreffend.
Zu den bestenfalls Missverständnissen über und von ‚Entschuldigung‘,
bekanntlich nur allzu gerne mit Vergebung interveriert, gehört: dass sie
(beide) mit Vergessen verbunden bzw. zu erledigen sei(en). Vorstellungen, die zwar bereits/spätestens mit jenen
Wirklichkeitskopepten des Vorfindlichen
(OLaM bis OLaMoT) konfligieren, die ein Futurum exaktum anerkennen (so dass
überraumzeitliches Bewustsein/werden Ereignisse eher umfasst und mehrstufig
aufhebt, eben qualifiziert repräsentiert, als sie
vernichtet; vgl. etwa die Denkform auswischbarer Aufzeichnungen als bis anstatt deren Handhabung, der sich etwa
Paulus sich griechisch, zur Veranschaulichung der alternierenden Umgangsangebote
G'ttes mit gar Ihren Zielverfehlungen
äh 'der Sündenvergebung', bedient); vor allem aber wird das Vergessen
(das nicht Erinnern AL ZaCHoR von Erfahrung, namentlich anstatt ihrer präsenten
Deutungsreflektion, womöglich anstatt ganz irritationsfreier Geborgenheit in
abgeschlossenem Sein) zum Lernverhinderer/Reproduktionsanführer - gleich gar
wiederholte Ereignisse bis 'charakterliche' Muster
von Verhalten betreffend.
Eigentümlich bis verräterisch ist ja auch, dass bzw. wo und wann einem Vergessen durchaus – sogar von jenen Personen, die gerne hätten, dass wir/jemand ihnen vergibt/vergeben bzw. Kritik ersparen würde – übel genommen wird.
Sich (bis jemanden) zu entschuldigen findet nicht nur die gesamte Bewertungspalette von ‚Schwäche‘ bis ‚Stärke‘, sondern ist weit darüber hinaus und darum herum bedeutsam – ‚selbst‘/sogar wo es vorgeblich und/oder erzwungen erfolgt ist es wirksam; doch bleiben seine Wechselwirkungen auch da nicht frei von Ambivalenzen, wo es sowohl authentisch wie aus Einsicht in Irritationen oder gar Schädigungen erfolgt (was im Unterschied zur Überzeugung vieler Leute keineswegs dasselbe ist/wird).
![]()
![]() «Wo lassen sündigen?» so wurde etwa auch Paul Chaum Eisenberg von einem
Rabbinerkollegen gefragt und habe geantwortet: «Das besorge ich ganz allein.»
«Wo lassen sündigen?» so wurde etwa auch Paul Chaum Eisenberg von einem
Rabbinerkollegen gefragt und habe geantwortet: «Das besorge ich ganz allein.»
Na klar war oder wird auch mit darauf angespielt, dass manche Leute sich vom/n Anderen, sprich exemplarisch von Nichtjuden, helfen (namentlich etwa jenen nicht Untersagtes erledigen) lassen, oder etwa am Schabbat Zeitschaltuhren einzusetzen trachten; und gemeint ist insbesondere, dass ja allerlei Antriebe bis Gründe für Regelverstöße (zumal für 'klein' oder gar 'leicht' erklärte bzw. gehaltene) spräche, gar für durchaus absichtliche, angenehme, pragmatische etc. pp. (vgl. auch die gar universelle Einsicht, dass 'Not kein Gebot kenne' - inklusive des omnipräsenten Nachschlags der Debatten darum bzw. Unterstellungen 'wie echt oder drängend' diese tatsächlich ... Sie wissen schon - auch um die Häme, dies anderen 'Kulziten'/Ethnien zu bestreiten bzw. sie zielgerichtet zu überfallen).
Die 613 Ge- und Verbote der zudem so gerne ‚Gesetz‘ genannten, rabbinischen Halachah-Tradition, des überlieferten Judentums sind auch insofern ein wichtiges Beispiel sogar durchaus lustvoller Normerfüllung bis MitZWoT, da sie - und dies bereits (letztlich wohl durch Belehrungsverzicht belegt und allenfalls von Judenfeinden bestritten) eingeräumter massen - gerade nicht alle allgemeinverbindlich für alle und von allen Menschen (janicht einmal alle Geschlechter, Berufsgruppen pp. im Judentum) gleich gefordert sind/werden.
 MitZWoT
eher mit, gar heilige, 'Verpflichtungen' oder auch 'guten Taten' zutreffend
übersetzt.
MitZWoT
eher mit, gar heilige, 'Verpflichtungen' oder auch 'guten Taten' zutreffend
übersetzt.
Denen - den ganzen respektive jeweils aktuellen Rechtsordnungen - durchaus gegenüber und insbesondere (eher auch) darin (denn nur 'dazu') ausdifferenziert ist/wird 'der harte bzw. innere/innerste Kern (des Ethischen)' [Abb. Nusschale?] von je nach Formulierung etwa '('Noas') sieben bis zu ('dekaöohischen' respektive 'hamurabischen' oder etwa 'weltethischen') zwölf' eine vernünftigerweise bis interkulturell konsensfähige - in ihrer Notwendigkeit dadurch bedingte, dass überhaupt gegen sie verstoßen wird - Grundlage von (zumal zwischenmenschlicher) Koexistenz der/von Lebenwesen. -
Die in (der einen): ‚Liebe deinen
Nächsten wie bis als Dich selbst‘ zusammengedacht
gesehen werden kann.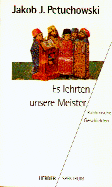 Was übrigens gerade Anhängern von Reinkernationsvorstellungen nicht leichtfertig
abgesprochen werden muss, da gerade sie final aus ‚Andere schädigenden
Daseinszyklen‘ heraus zu kommen trachten; und da Barmherzigkeitsvorstellungen und insbesondere Verzweckungspraktiken wider sich,
und auf Kosten seiner selbst, ... Sie/Dero Gnaden wissen wohl schon.
Was übrigens gerade Anhängern von Reinkernationsvorstellungen nicht leichtfertig
abgesprochen werden muss, da gerade sie final aus ‚Andere schädigenden
Daseinszyklen‘ heraus zu kommen trachten; und da Barmherzigkeitsvorstellungen und insbesondere Verzweckungspraktiken wider sich,
und auf Kosten seiner selbst, ... Sie/Dero Gnaden wissen wohl schon.
[jer-mitzwot.html: Von den 613 zu dem einem gar universalistischen [Es lehrten unsere Meister; J.J.P.]
Nicht exklusiv, und zugleich keines der vielen mehr als systemisch minimal
(etwa in Formulierungen der sieben noachidischen, doch inhaltlich universellen Grundregeln des Ethischen oder zumindest des Rechts)
koexistenz-notwendig, ist hingegen ein dennoch wichtiger Anlass für das überhaupt Bemühen des und der Menschen um gar eigene Besserung (respektive Heilung bis Vollendung der Weltwirklichkeiten TiKuN HaOLaM) - die Überzeugung bis Erfahrungsgewissheit, dass G'tt uns - 'immerhin' oder 'zumindest' unter Bedingungen bis gar im qualifizierten Sinne gnädig - vergibt.
Gibt es allerdings (oder findet/gebraucht jemand), entgegen durchaus verbreiteter, vielerhoffter und immerwieder versprochener Behauptungen und Lehren - insbesondere der Substitutionstheologie oder 'Alles-wi((e)der-gut-Machung/Werdenss'-Vorstellungen (namentlich durch Schöpfungswirklichkeitsauflösung) -
keine universellen Generalmittel
zur (vom Griechischen![]() her)
‚Aus-X-ung‘ genannten, doch rest- und spurlos gemeinten/verstandenen, Löschung
von Zielverfehlungen aus allem wirklich
geworden sein Werdendem (dem Futurum Exaktum) fientischen Geschehen (gar mittels
insbesondere heteronomistisch bzw. motivational so omnipräsenten
Ausgleichs-Praktiken wie: Watschenmädchen/Prügrlknaben, Sündenbock
respektive Schuldige bis Ersatz-Opfer-bringen äh töten – aus dem was,
namentlich von asiatischen Denkformen her
her)
‚Aus-X-ung‘ genannten, doch rest- und spurlos gemeinten/verstandenen, Löschung
von Zielverfehlungen aus allem wirklich
geworden sein Werdendem (dem Futurum Exaktum) fientischen Geschehen (gar mittels
insbesondere heteronomistisch bzw. motivational so omnipräsenten
Ausgleichs-Praktiken wie: Watschenmädchen/Prügrlknaben, Sündenbock
respektive Schuldige bis Ersatz-Opfer-bringen äh töten – aus dem was,
namentlich von asiatischen Denkformen her![]() ,
gerne ‚Karma/Kismet‘ oder ‚Schicksal‘ bzw. ‚speicherbewusst‘ genannt wird),
,
gerne ‚Karma/Kismet‘ oder ‚Schicksal‘ bzw. ‚speicherbewusst‘ genannt wird),
werden wir Lebewesen G'tt und (zumindest) anderen Menschen/Wesen
· selbst jenseits bzw. abgesehen von und gerade nach
·
![]() (Rück-)Zahlung/Ableistung privatrechtlicher
bzw. öffentlichrechtlicher Schulden, Gebühren und Dienstbarheiten,
(Rück-)Zahlung/Ableistung privatrechtlicher
bzw. öffentlichrechtlicher Schulden, Gebühren und Dienstbarheiten,
·
![]() Verbüßung von strafrechtlichen Sanktionen
respektive auch bei (ja gar manchmal durchaus - in hinreichender anstatt in
absoluter Weise - möglicher) Einhaltung aller sieben noachidischen 'Grundgebote' des Ethischen (Hoffens) plus der
lokal gültigen je zeitgenössischen Rechtsordnung(en),
Verbüßung von strafrechtlichen Sanktionen
respektive auch bei (ja gar manchmal durchaus - in hinreichender anstatt in
absoluter Weise - möglicher) Einhaltung aller sieben noachidischen 'Grundgebote' des Ethischen (Hoffens) plus der
lokal gültigen je zeitgenössischen Rechtsordnung(en),
·
![]() ja
sogar der Erbringung von: zweckbedingter
Arbeitsleistungen und Nächstenliebe, z.B.
Wohhtaten / Almosen / Fürbitten, Achtsam- bzw. Freundlichkeiten (auf/für was
'gesund', 'natürlich', 'ökolpgisch', 'fair gehandelt', 'sozial ausgewogen',
'kultur- bzw. religionsverlräglich / traditionsgemäß', 'political correct',
'gendergerecht' oder etwa 'unprovokativ' pp. sei) und (gar dabei bis so Anderheiten qualifiziert respektierende) Höfkichkeiten, über das (gleich gar professionell)
angebrachte Mass hinaus,
ja
sogar der Erbringung von: zweckbedingter
Arbeitsleistungen und Nächstenliebe, z.B.
Wohhtaten / Almosen / Fürbitten, Achtsam- bzw. Freundlichkeiten (auf/für was
'gesund', 'natürlich', 'ökolpgisch', 'fair gehandelt', 'sozial ausgewogen',
'kultur- bzw. religionsverlräglich / traditionsgemäß', 'political correct',
'gendergerecht' oder etwa 'unprovokativ' pp. sei) und (gar dabei bis so Anderheiten qualifiziert respektierende) Höfkichkeiten, über das (gleich gar professionell)
angebrachte Mass hinaus,
·
![]() und
selbst bis gerade der Heilung/Vollendung der Welt TiKuN OLaM bzw. der (gar
'persönlicher') Weisheit(svervollmitnung) zu -
und
selbst bis gerade der Heilung/Vollendung der Welt TiKuN OLaM bzw. der (gar
'persönlicher') Weisheit(svervollmitnung) zu -
so Manches, im versäumt- und verfehlt-habenden Sinne, an jener Gerechtigkeit 'schuldig geblieben', die wir 'droben'/jedenfalls vor/bei G'tt haben sollten - i/Ihrer (und zumal unserer eigenen) durch Freiheit qualifizierter- und riskannterweise eben auch ausbleiben könnender, Vergebung und/oder Verzeihung, eben Euer Gnaden / Formen der Gnade durchaus drunten bedürftig - sein.
Zwischen der Wirksamkeit bzw. dem Gewicht des verbalen und des nonverbalen Gebrauchs der drei Behavioreme/Verhaltensweisen ist kaum grundsätzlich zu entscheiden. Doch genügt entschuldigendes, bittendes und dankendes Denken bzw. Reden allein noch nicht als, oder auch ‚nur‘ für, jede Tat.
Wohl noch besonderere Eigentümlichkeiten – und zumindest daher wohl auch Bedeutung/en – weist das (mit dem) Entschuldigen auf: Wie geht das eigentlich? Was ist oder wird möglich?
Jemanden zu entschuldigen ist ja einerseits so etwas wie das Übermitteln einer Verhinderung bis zur (mehr oder minder stichhaltigen) Begründung respektive Erklärung einer Abwesenheit, die zumindest persönliche, namentlich emotionale, Nachteile oder gar (Veränderungs-)Aufwendungen etwa für eine 'Gast-gebende' Person betreffen. Weitererseits geht es dabei um ein Verhalten – häufig auch ganz anderer Art – das einen - nicht notwendigerweise auch einen bezifferbaren, gar dann besonders großen – Schatten bis Schaden hinterließ ,um dessen Handhabung es nun (vielleicht bzw. auch) geht. Wobei charakteristischerweise selbst und gerade der/ein ökonomische/r Ausgleich oder Ersatz nicht hinreichen (bereits sein Versuch eventuell sogar zusätzlich beleidigend sein) kann.
Mehr noch als die Bitte um Entschuldigung – wie auch immer sie aussehen, bis vorgetragen werden, mag – ermöglicht, will oder ist ja deren Gewährung mehr/ bzw. noch etwas anspruchvolleres als ein Kommunikativer Akt (und sei er immerhin das rituelle Aussprechen der ‚Absolve‘-Formeln, selbst am geheiligten Ort).
Besonders gerne mit Entschuldigung vermischt bis vertauscht werden Schuld(en)erlass, Verschweigen, Vergessen, Ignorieren und Vergebung, die es kaum sein, und nicht einmal immer werden, können.
Entschuldigung – gar/gerade jene für das eigene Dasein muss weder so frustriert noch so totalitär ausgeschlossen sein, werden, bleiben wie der tieferliegenden Fuchslocjbastei zorning-stolzer Impetus nahe legen kann, der dem/der anderen (möglichst verborgen nullsummenparadigmatisch scharf) die Tauglichkeit abspricht. Insbesondere Gesellschaft, in erweiternder Verschärfung der Fragestellung gegenüber Gemeinschaften, versucht bzw. hat Ignorierungsmöglichkeiten und Cooperationsnotwendigkeiten ihrer Angehörigen untereinander zu regeln.
 Entschuldigung bitte – ‚die Braut‘ lässt i/Ihren besten Hofknicks und Dank bestellen!
Entschuldigung bitte – ‚die Braut‘ lässt i/Ihren besten Hofknicks und Dank bestellen!
Dabei, dennoch und also sind alle drei ‚Wunderworte‘, bzw. gar qualifizierte Haltungen (die diese Begriffsfelder nur/immerhin repräsenteiren), keineswegs zweckfrei und sind, gar besonders wirkmächtige, Anreize, die nicht über die reziproke und selbst in ihrer Asymmetrie wechselseitige aufeinander Bezogenheiten des Tauschhandels erhaben sind/werden.
Nur sind/werden manche bis zu viele Leute bekanntlich davon überzeugt: Respekt bestehe, und äußere sich, in demjenigen unmittelbar benachbarten Verhalten, das jemand (respektive vorgeblich bis tatsächlich sogar jeder Mensch – meines bis unseres aktuellen Erachtens) erwartet, bis (und sei es auch noch so ausdrücklich oder heimlich) verlangt. – Auch nicht gerde wenige Menschen sind (gar daher – zumal situativ) der, gar irrigen, Aufassung bzw. in Versuchung tieferliegend durchzusetzen, dass entweder das (namentlich des/der Anderen) Affizieren ‚draußen‘ drunten oder die soziale bis tauschhändlerisch verzweckende (eigene bzw. fremde) ‚innere‘ Beeinflussbarkeit das/von Übel seien.
Wir vermögen durchaus manche Missetaten von Menschen, insbesondere an/gegen uns, zu vergeben – ohne die dazu entschuldigen, oder gar vergessen machen/lassen, zu müssen, oder auch nur zu dürfen.
 [Sorry – oder
auch/gerade dies nicht]
[Sorry – oder
auch/gerade dies nicht]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sie haben die Wahl: |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Goto project: Terra (sorry still in German) |
|
|||
|
Comments and suggestions are
always welcome (at webmaster@jahreiss-og.de) Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss-og.de) |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|||||
|
by |