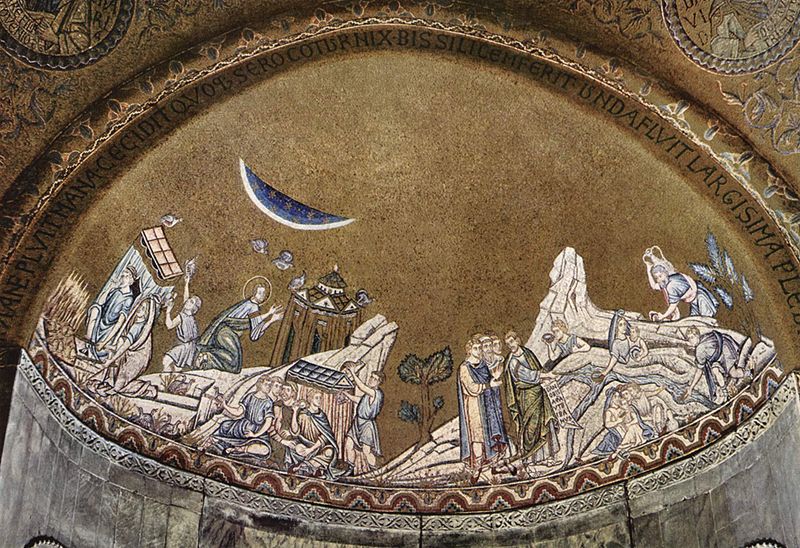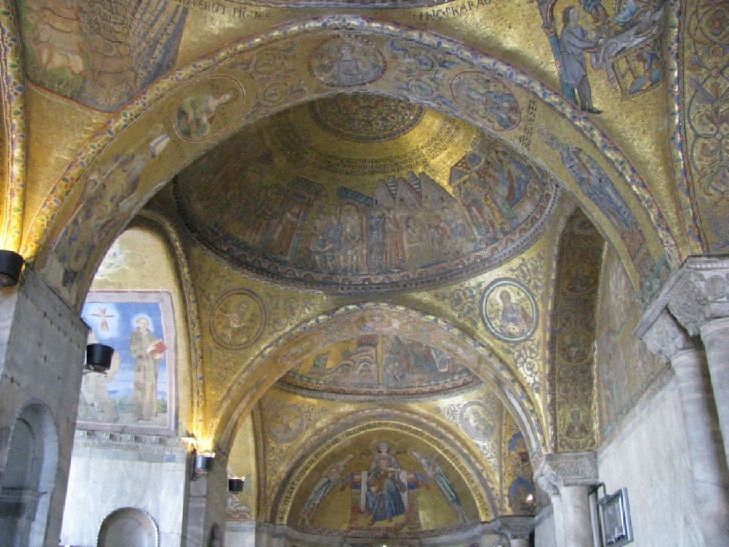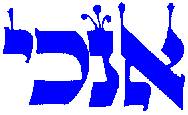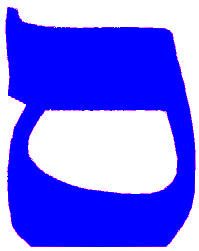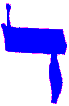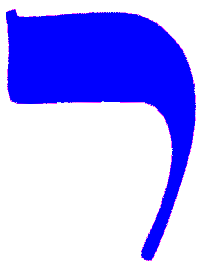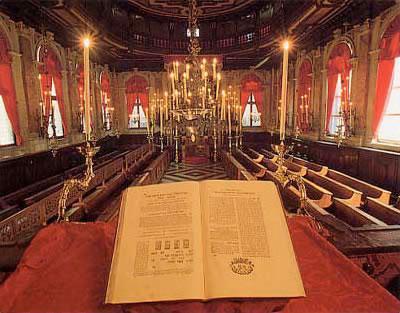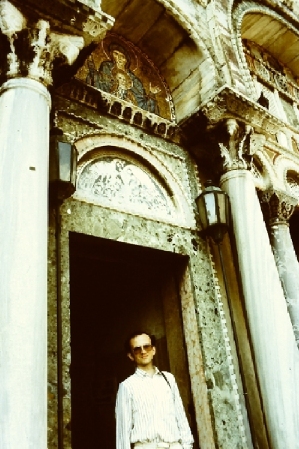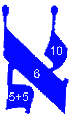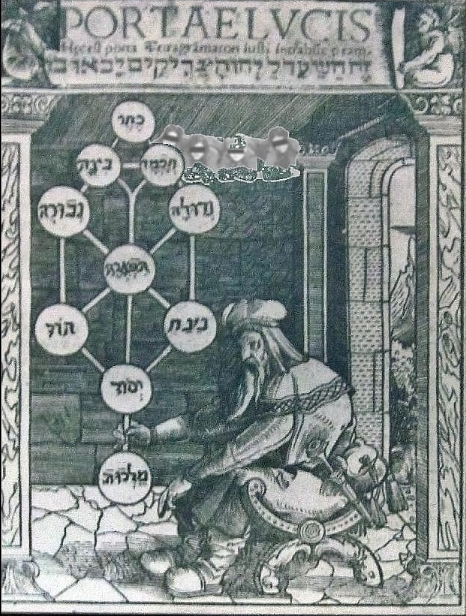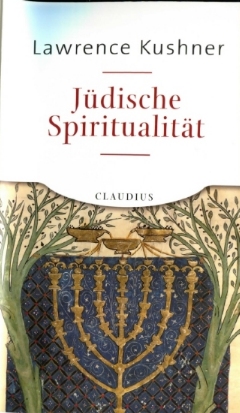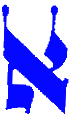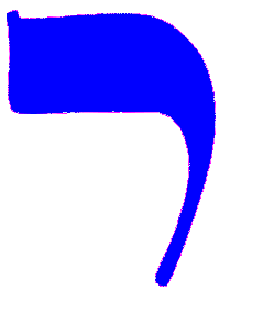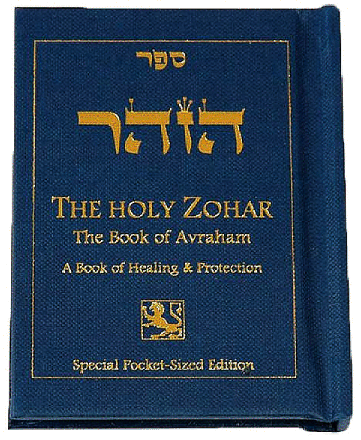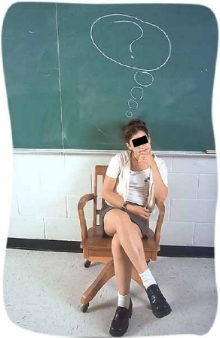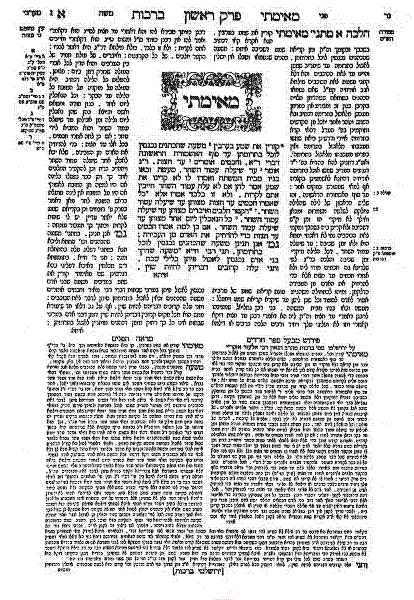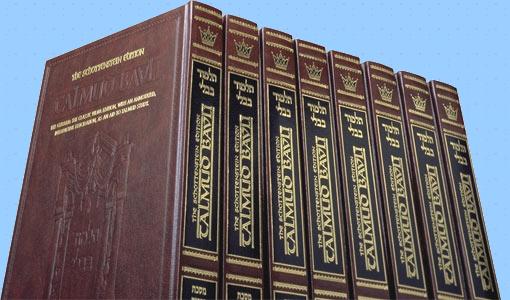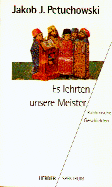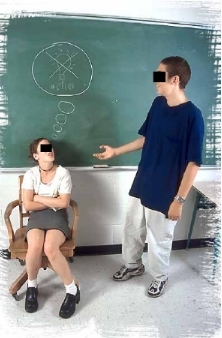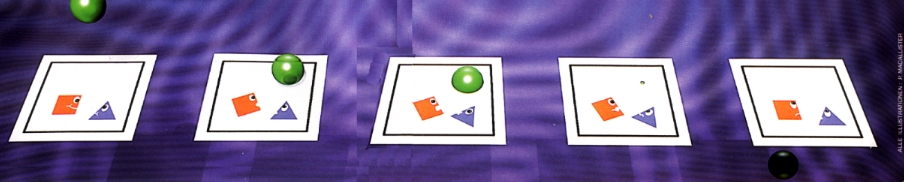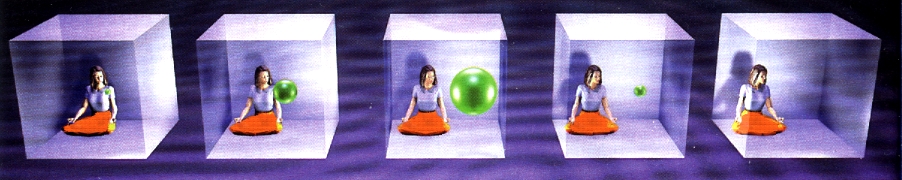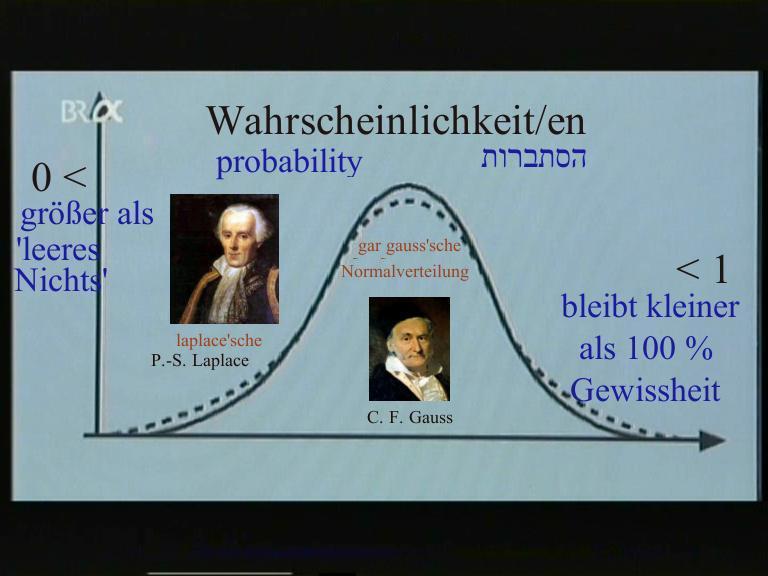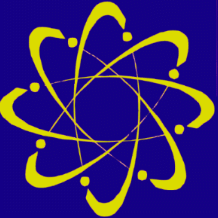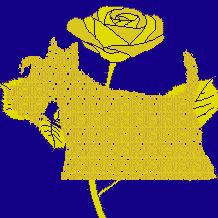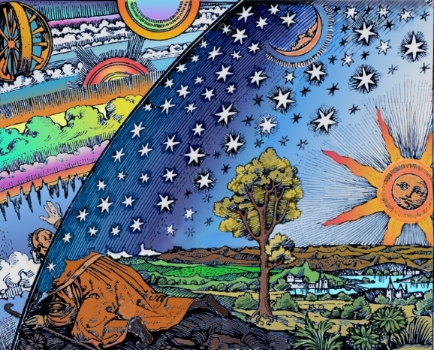![]() Sollte Ihr Monitor bzw. Browser
(neben- sowie untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie
hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
Sollte Ihr Monitor bzw. Browser
(neben- sowie untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie
hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
|
Mosaiken,
der Kuppel und der Lynette des Hebräers Moschä, ‚unseres
(Hilfs-)Lehrers?‘, mit acht Szenen nördlich in/an/vor der ‚Goldenen
Basilika‘
|
Von den schließlich zehnten, Genesis-strukturellen, der ‚anfänglichen‘ |
Von unter der mittleren
‚Josefskuppel‘ des Nordatriums, in Richtung Osten, auch zur ‚Moseskuppel‘, überm Blumentor, hin zum Querschiffsportal San Marcos,
‚sehend‘. Piazetta de leonini links und Seitenschiff des St. Petrus rechts‚
‚neben dem Foto‘ vorstellbar. |
Namen – manche Kerninhalte vom ‚Beginn‘ /bereschit/ בראשית des
gleichnamigen tanachischen Buches –
beendet/erledigt einiger
Christen – äh
mancher Vorstellungen – Mosaikenzyklus des Atriums/Nathex (der Vorhalle von San Marco) recht wundersam / gewohnt paradox  rasch zum/ins
Querschiff.
rasch zum/ins
Querschiff.
![]() Sollte … אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת Anmerkung
ךׅקדוּק für Pedanten, äh ‚natürlich‘ Grammatiker:
Sollte … אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת Anmerkung
ךׅקדוּק für Pedanten, äh ‚natürlich‘ Grammatiker:
Ja, die
Transskription ‚der Namen‘, nein
des hebräischen Wortes /schmot/
שמוֺת zumal dafür,
ist in diesem web-Dateinamen (namen-schamot.html) falsch
geschrieben! Das –
gleich gar nach/im/von ‚orientalischem‘
Sprachempfinden – phonetisch
zwischen schin ש und mem מ kaum, bis nicht, hörbar erforderliche ![]() schwa
(in
schwa
(in ![]() massoretischen
‚Punktierungen‘ der Quadratschrift als eine Art ‚Doppelpunkt‘ mitten unter dem
vorangehenden Zeichen hier שְׁ deutlich gemacht/orthographierbar)
erklingt gegenwärtig allenfalls wie ein ‚Murmelvokal‘ (in Richtung ‚e‘; – solche ‚schwach‘ nach אֱ
‚ä‘ oder [etwas
unterschiedlich ‚langem‘ respektive gar ‚o‘-artig?] ‚a‘ אֲ , אֳ klingen sollende könnten, bis würden,
also dementsprechend gekennzeichnet erwartet
werden dürfen).
massoretischen
‚Punktierungen‘ der Quadratschrift als eine Art ‚Doppelpunkt‘ mitten unter dem
vorangehenden Zeichen hier שְׁ deutlich gemacht/orthographierbar)
erklingt gegenwärtig allenfalls wie ein ‚Murmelvokal‘ (in Richtung ‚e‘; – solche ‚schwach‘ nach אֱ
‚ä‘ oder [etwas
unterschiedlich ‚langem‘ respektive gar ‚o‘-artig?] ‚a‘ אֲ , אֳ klingen sollende könnten, bis würden,
also dementsprechend gekennzeichnet erwartet
werden dürfen).
 [Falsche Absicht bis
unbeabsichtigt falsch –
müssen nicht unbedimgt immer
nur zu den falschen Fragen gehören]
[Falsche Absicht bis
unbeabsichtigt falsch –
müssen nicht unbedimgt immer
nur zu den falschen Fragen gehören]
Absicht? – In semitischen Denkweisen finden sich/wir (prompt pluralisch) mehrere,
lexikalisch zutreffend mit/in/als ‚Grammatica‘ übersetzlich zu verstehende Semiotica
/ ‚Aus-/Eindrücke‘. Immerhin ‚auf den Straßen Israels‘, respektive ‚von
Israelis‘, würde jemand – ungeachtet all solcher Aussprache/n
– durchaus verstanden werden;
da/indem Sie Vokale
(bei/wegen deren so
erheblicher Bedeutungsänderungseinflüsse) nicht-selbstlautend
(japhetisch / massoretisch) überbetonen
müssen.
|
|
||
|
(Denn) Ein, bis das, nun/insofern zweite/s biblische Buch /sefer/ ספר (des Mosche, äh der) Namen /schemot/ שׁמות – zumal christlicherseits zu ‚Exodus‘ lat(e)inisiert, also als jenes vom ‚Auszug‘ verstanden – beginnt, genau – von rechts her – (vor)gelesen, bekanntlich וְאֵלֶּה שְׁמוֺת … mit einem ‚waw/vav‘, dem hebräischen undװaber-Laut
sowie (das Wort וו VaV\UaU übersetzt wird)
‚Haken‘-Verbindungszeichen, das den Dialog / das Zwigespärch
– (wiederaufnehmend)
beinhalte, oder ganz, ‚von Anfang an‘ (erstmals Genesis/bereschit 1:1 respektive seit[ וַיּ֥אֺמֶר 1:3 ]her) – fortsetzt / aufnimmt. |
||

#hierfoto
[Falls bis wo/wem Schrift-Zeichen
etwas bedeuten – eigene/neue ‚Bibel‘-Verständnisse bis Übersetzungen] Na
klar, jenen seit Jahrhunderten andauernden, über des (nummerisch sechsten) Zeichens ן Aussprache(varianten) selbst, und seine
Bezeichnung/en, gleich ebenso inklusive.
Die – geläufig oft auch /vav/, bis gar eher
/uau/, transkripierte/gesprochene – Konjunktion /waw/ steht da um alef-lamed-he
אלה (den
‚diese‘ genannten grammatikalischen Aspekt / Gedanken repräsentierend)
erweitert, vor schin-mem-o(-waw)-taw שמות wohl /schmot/ oder /schemot/ zu sprechen, und
‚Namen‘ bedeutend: «UndװAber
dies/e (sind/waren) Namen (der/jener)
Söhne/Nachkommenschaft/Kinder Jisraels, die kommenden nach Ägypten/mitzarima
mit Ja’akow ... »
Ähnlich bekannt auch, dass beides Israel und Jakob zunächst als Namen eines
– gleichwohl von letzterem zu ersterem veränderten – Menschen, und (spätestens) dann für dessen
Nachkommenschaft/en, gebraucht werdenden, respektive gebräuchlich sind. – Semitische(!) Denken
gebraucht/benötigt(„) und bemüht(!) auch gerade hier keine sprachliche
Gegenwartsform von ‚sein/werden‘
– zumal diese Mose und Israel so untrennbar mit, und in, dem ‚Namen‘-Buch spezifisch erschlossen wird.
Angerufen wird/werden G-ttes Name/n ja bereits ‚seit‘ bereschit/Genesis
, wohl den Tagen Seth's, der
dafür teils besonderes Ansehen erhält, und erscheint/erscheinen daher/insofern
durchaus bekannt/gegeben. G-ttes Adressierbarkeiten / Anredbarkeit setzt aber –
wie jede eines Gegenübers /kengdo/
כנגדו oder Selbst's überhaupt – weder voraus, den richtigen,
noch gar den einzigen, Namen dafür zu verwenden oder wenigstens
kennen/verbergen zu müssen. –  Noch genauer genommen wissen wir
Menschen (bis/jedenfalls)
heute, nicht was Namen
sind/werden, können es intersubjektiv konsensfähig wahrscheinlich
überhaupt nicht qualifiziert wissen (Nichtwissensprinzip / Grenze analytischer
Sprachphilosophie). Was den Gebrauch von Namen nicht etwa
verunmöglicht, und leider nicht
einmal so sorgfältig, vorsichtig, zurückhaltend pp. macht, wie es dies
angeraten erscheinen lassen könnte. Zumindest die omnipräsent üblich Miss- und
Gebrauchsweisen von Namen – gleich gar
mit (beabsichtigten, bis kaum
bemerkten) magischen/beschwörenden Absichten – könn/t)en da zu Denken
geben: Dass wir weder, über die Sache/n, noch über die Person/en verfügen,
weil/wo wir meinen darüber/davon reden/denken zu können, und/oder dies eben
tun (respektive verbieten s/wollen).
Noch genauer genommen wissen wir
Menschen (bis/jedenfalls)
heute, nicht was Namen
sind/werden, können es intersubjektiv konsensfähig wahrscheinlich
überhaupt nicht qualifiziert wissen (Nichtwissensprinzip / Grenze analytischer
Sprachphilosophie). Was den Gebrauch von Namen nicht etwa
verunmöglicht, und leider nicht
einmal so sorgfältig, vorsichtig, zurückhaltend pp. macht, wie es dies
angeraten erscheinen lassen könnte. Zumindest die omnipräsent üblich Miss- und
Gebrauchsweisen von Namen – gleich gar
mit (beabsichtigten, bis kaum
bemerkten) magischen/beschwörenden Absichten – könn/t)en da zu Denken
geben: Dass wir weder, über die Sache/n, noch über die Person/en verfügen,
weil/wo wir meinen darüber/davon reden/denken zu können, und/oder dies eben
tun (respektive verbieten s/wollen).
Immerhin gilt ‚der‘, bis jeder' Name G'ttes als Quelle der Identitäten /
Selbigkeiten.
Das latinisiert als ‚Expdus / Auszug‘
bezeichnete zweite Tora-Buch ![]() beginnt (gar anscheinend weniger beachtet)
eben mit (den) Namen /schemot/ der Söhne Jisraels/Jakobs, die
(mit, und vor, ihm)
nach/in mitzarim(a)/Ägypten eingeladen, eingewandert und willkommen sind/waren;
– also mit einem
wichtigem Aspekt der vorausgehenden
‚Josefsgeschichte‘ dessen was aus Ja’akow/Israel wuede, der zehnten /toledot/ bereschits/‘der
Genesis‘.
beginnt (gar anscheinend weniger beachtet)
eben mit (den) Namen /schemot/ der Söhne Jisraels/Jakobs, die
(mit, und vor, ihm)
nach/in mitzarim(a)/Ägypten eingeladen, eingewandert und willkommen sind/waren;
– also mit einem
wichtigem Aspekt der vorausgehenden
‚Josefsgeschichte‘ dessen was aus Ja’akow/Israel wuede, der zehnten /toledot/ bereschits/‘der
Genesis‘.
 Gar einleuchtend, dass/wenn/wie – zumal dagegen –
sogar so komplexe, wie die
musivischen, ‚ewigkeitsmahlerischen‘
Darstellungen der sieben Kuppelmotive (
Gar einleuchtend, dass/wenn/wie – zumal dagegen –
sogar so komplexe, wie die
musivischen, ‚ewigkeitsmahlerischen‘
Darstellungen der sieben Kuppelmotive (OD2-45.jpg: 45 Atrium, Moses cupola, northwest pendentive: Zacharia
(Procuratoria) - Otto Demus 2 Bände English SW
Moses vor dem brennenden Dornbusch; 2. Mose 3,9– 10. AKG
) und jenes der Lynette (von der wundersamen
Teilung immerhin des Meeres) derart
‚golden‘ bevorzugt verwendet
werden. ![]() Zu den
eher unbekannten/unbeachteten, an sich logischen
mithin nicht-Selbstverständlichkeiten
gehört, dass es/was Verbotenes, deswegen und damit nicht notwendigerweise
unterbleibt (gar häufig sogar
im Gegenteil).
Zu den
eher unbekannten/unbeachteten, an sich logischen
mithin nicht-Selbstverständlichkeiten
gehört, dass es/was Verbotenes, deswegen und damit nicht notwendigerweise
unterbleibt (gar häufig sogar
im Gegenteil).
‚Erstmals‘ in der, bis sogar als die, Tora (im engsten begrifflich, nein
eben schriftlich, verwendeten Sinne, des auch nach Mose benannten Fünf[- bis Sieben]-Buches, vom Griechischen:. Pentateuch) wird ‚des Bundes Buch‘ /sefer hatora/
von hier an erwähnt, auf- und gar fortgeschreiben: Zwar ist dabei/daran nicht
notwendigerweise die ‚Verschriftlichung‘ bzw. ‚Buchrollenform‘ (zumal auch
Steintafeln graviert werden) als solche ‚neu‘ (ras erste tanachisch genannte
Buch /sefer/ ist bekanntlich jenes der /toledot haadam/ von den
Hervorbringungen der/dutch die Menschenheit) doch scheint hier erstmals (auch
und gerade sowohl nach Noah’s Bund, als auch nach den sowohl zusätzlichen, als
auch spezifischeren von Abram zu Abraham) G’ttes-Bund – mit wem - auch – immer (worüber
der Streit, zumindest, anzudauern
scheint) – (also eben nicht etwa nur) Schriftform/en zu (jene von Urkunden bis
Normen und Gesetzen längst nicht ausgeschlossen, doch auch nicht unbedingt
vereinzigt / darauf beschränkt) haben. Jedes Zeichen, ob etwa akustisch oder
optisch, bedarf jedoch(bekenntlich der Deutung um verstanden zu werden, was zu
geren übersehen, bis betritten wird. Schriftliche unterscheiden sich diesbezüglich keineswegs. Gerade, und sogar,
Juristen sind sich nicht darüber einig, was das ‚ist‘ in/aus dem Satz ‚die
Würde des Menschen ust unantastbar‘ bedeutet: Ein/Das deslriütiv
gemeinte ‚ost‘ würde behaupten, dass es nicht möglich ist des/der Menschen
Würde anzutasten; und\aber ein/das normativ verstandene (bis zu verstehende)
verbietet diese anzutasten, mithin mögliches zu tun  (vgl. R. Spähmann
versus H. Dreier gemeinsam gerade am/zum Exempel des Gekreuzigten Jesus/Jeschua, eben auch zu rechtlich hier
eher begrenzten Auswirkungen dieses Unterschiedes; O.G.J.). Doch/Dabei
stehe dieser Satz eins des Artikels eins Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, so formuliert ja gar nicht in der Tora/Bibel, oder anders ausgedrückt,
bis inhaltlich, ja vielleicht sogar/gerade doch thematisiert? Jedenfalls sind
und waren sowohl die Rabbinen, als auch (bereits) christliche wie (dann auch) islamische ‚Theologen‘ durchaus Rechtsgelehrte, und
werden – mit etlichen
Schwerpunktverlagerungen zu/in der staatlichen/r
Rechtspflege
– manchmal, vielerorts
weiterhin juristisch tätig.
(vgl. R. Spähmann
versus H. Dreier gemeinsam gerade am/zum Exempel des Gekreuzigten Jesus/Jeschua, eben auch zu rechtlich hier
eher begrenzten Auswirkungen dieses Unterschiedes; O.G.J.). Doch/Dabei
stehe dieser Satz eins des Artikels eins Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, so formuliert ja gar nicht in der Tora/Bibel, oder anders ausgedrückt,
bis inhaltlich, ja vielleicht sogar/gerade doch thematisiert? Jedenfalls sind
und waren sowohl die Rabbinen, als auch (bereits) christliche wie (dann auch) islamische ‚Theologen‘ durchaus Rechtsgelehrte, und
werden – mit etlichen
Schwerpunktverlagerungen zu/in der staatlichen/r
Rechtspflege
– manchmal, vielerorts
weiterhin juristisch tätig.
Und jedenfalls ist/wäre
der häufige Versuch als
gescheitert/widerlegt
zu betrachten, dass ‚alles was im Gesetz (sogar im sogenannten/vorgeblichen ‚Naturgesetz‘)
stehe, wirklich immer und überall genau so
(nicht allein/immerhin
geschrieben/gesagt sondern) gegeben vorzufinden, bis wenigstens erzwingbar/kommend, sei‘.  Mache
ja Niemand.
Mache
ja Niemand.
Was Juristen – gar zu allen
Zeiten und an allen Orten – zu (er)klären und schließlich verbindlich zu
entscheiden haben und hatten: Ist nämlich nicht allein, ‚was eiene/diese Norm
konkret bedeutet oder verletzt‘, sondern insbesonderr auch jedesmal ob diese
Norm für alle (respektive für
wen sie) überall (respektive
wo sie) und immer (respektive
wann) sie gilt, oder eben nicht. – Warum/Wie sich Gottes oder der
Menschen Normen darin/davon unterscheiden sollen, muss (bis kann) nicht
überzeugend (allenfalls
überredend/übersehend) einleuchten.
Die biblischen/der Tora tun dies jedenfalls nicht vollständig alle – da/indem
sich manche (gerade) in
ihrem ausdrücklichen Wortlaut angeben an wen sie sich wann und wo wenden.
Wenn/Da aber bereits in Rechtsfragen – wo also der Urteilsbedarf /
Entscheidungsnotwendigkeiten wohl am wenigsten strittig (dicht gefolgt vom.
Zumal politischen, Felde sozialer Verhaltenskoordination) – optionale und bedingte (bis sogar unterschiedliche
/ auch andere als die diesmal gewählten) Richtigkeiten (Fallrechtssysteme unterscheiden sich
von Prinzipien anwendenden, sogar Gesetze
z.B. Strafrahmen vorgebend – Gerichte in ihrer Urteilsfindung zudem frei
bleibend) bestehen können, ist kaum ernsthaft zu erwarten/hoffen,
dass Sptache(n) oder
etwa Wissenschaften (sehr im Unterschied, ja Widerspruch, zu den
meisten [philosophischen]
Meinungen, äh [theoretischen] Überzeugungen,
respektive [theologischen,
akademischen, kulturellen, gesellschaftlichen, medialen Gemurmel] Lehren, bis Dogmen – die
alle anderen/abweichenden Auffassungen für, mehr oder minder, unzureichend bis
falsch/böse, zu halten neigen/haben), Jedenfalls aber ‚Künste‘, immer
und überall / für alle/s und jede/n/s, die eine alleinig einzige (pareto) optimal richtige /
gültige / ästhetische /
gute / wahre / zulässige / treffende (etwa monokausalistische/komplexe, magische, weltformelistische
pp. final paradox endgültige – gleich
gar/eben jene für ‚die singuläre göttliche / natürliche / universelle /
ganzheitlich-holistische / überhimmlische / außeraumzeitliche‘ zu haltende /
auszugebende / anzubetende) Art und
Weise (der Wahrnehmung)
des (repräsentierenden/addressierenden)
Ausdrucks / der (bewirkenden/betreffenden)
Handhabung finden/haben müssten (oder wenigstens könnten).
|
Bibel und rabbinisches Judentum Zwei Arten
der Offenbarung [sic!] sind der Hebräischen Bibel bekannt [sic!].
Sie kennt [‚erwähnt‘ jedenfalls; O.G.J.] die „Vision“ oder die „Erscheinung“ (hebr.: mar'eh [מראה ; vgl. /mar’a/
‘‚Spiegel’]
vgl Ex 3,1 ff; Ez 11,24 u.ö.);
und sie redet vom „Worte Gottes“ (debhar
YHWH. [דבר יה־ה /dawar Adonai/]
vgl. Dtn 5,5 u. ö.) oder der
„Tora“ ([תורה] vgl. Jes 2,3 u.ö.), |
[Wesentlich ‚woher‘ (namentlich
von welchem[!]
Oberbegriff/en aus) Begriffsverständnisse definiert / verwendet
werden] |
Doch
auch / eher Selbsterschließungen,
gleich gar G’ttes – Wahrnehmungen
betreffend / aneignend-!/?/-/. (Jedenfalls
nicht allein fehlende / passende /
sämtliche / teilweise / verborgene / zutreffende Kenntnisse – von
Sachverhalten, Menschenverhalten, Ereignissen, /dewarim/ דברים
und/oder Daten.) |
|
|
|
worunter die göttliche Weisung zu verstehen ist, die sowohl aus Lehren [sic!
|
respektive eher narrativer, deswegen jedoch nicht etwa weniger
wesentlichen, oder gar wirkungslosen, ‚Geschichten‘, als etwa Theorien bis Systemen; O.G.J.
durchaus mit J.J.P.] |
|
||
|
als auch aus Gesetzen [sic! |
[Durchaus ebenfalls in der/den gesamten Verwendungsreichweite/n
und Bedeutungspaltette/n der ‚Gesetzes‘-Begrifflichkeiten:
etwa von Imperativen, über Rechtnormen und Prinzipien, bis zu
Regelmäßigkeiten respektive Verpflichtungen; O.G.J.] |
|
||
|
|
Das rabbinische Judentum blieb daher dem biblischen
Vorbild treu [sic!], wenn es das zweideutige
[sic! |
gar
vielgestaltiger unspezifiziert, nicht allein Inspiration und Intuition
göttlicher Einwohnung versus Weisungen adressieren könnend/sollend, sondern
etwa auch allgemein Wahrnehmungsergebnisse, bis insbesondere vorherberechnend
prognostisch / voraussehend prophetisch,
doch etwa auch hin zur Apokalypse
apostolischer, kanonisierter Schriften solchen Namens; O.G.J.] |
|
|
|
|
Wort „Offenbarung“ vermied und statt
dessen [sic! |
was
eine, gar vermeidbare, unglückliche, Akzeptanz des prekären Ausdrucks
‚Offenbarung‘ als
definitorischem Oberbegriff (für/über freiwillig persönlich relationalem
gar wechselseitige, Selbsterschließungen
von/der Subjekte/n) bedeuten könnte; O.G.J.], |
|
|
|
|
|
|
|
|
dem Zusammenhang entsprechend, entweder von gilluj schekhina [גילוי שכינה]. der ![]() Epiphanie [sic!] der Anwesenheit Gottes, oder von mattan tôra
[מתן תורה], dem Geschenk der göttlichen Weisung,
sprach. Ein jeder Empfang von göttlicher Weisung setzt eine Epiphanie [sic!] Gottes voraus [sic! Warum/Dass sich
eine Weisung nicht auch durch Kurierdienste überbringen ließe, erschließt sich
hier/so kaum notwendigerweise; O.G.J.]: aber nicht jede
Epiphanie Gottes muß unbedingt in einer Gesetzgebung [sic! gar nicht einmal immer in/als
uns schriftlich vorliegende Weisung/תורה? O.G.J.[] münden Für das rabbinische Judentum war der Pentateuch
[die kanonischen ‚Mosebücher‘ als
schriftlicher Tora im engsten Sinne] das
Offenbarungszeugnis [sic! ‚Selbsterschließungszeugnis‘?
Gleich gar im/als Konflikt mit personifizierten ‚Botinnen‘ Gottes,
respektive deren götzendienstfähiger / kritikunfähiger / distanzloser
Verehrung/en; O.G.J. begrifflich mit M.B. & F.X.R. et al. unten] par excellence. Ihm wurde eine größere
Autorität
als den [sie gar bereits middraschisch etc. auslegenden und spätestens insbesondere anwendenden; O.G.J.] Propheten und den Hagiographen [den übrigen Schriften der kanonischen Hebräischen Bibel /
Tanach] zugeschrieben. Jedoch führte diese [mit Sch.b.Ch. zwar als ‚Mitspracherecht‘, nicht aber als
‚Vetorecht‘, bei/in gegenwärtigen / künftigen Entscheidungsfindung/en, zu
verstehende/verwendende; O.G.J.] Autorität des Pentateuchs die Rabbinen nicht
zu einem buchstabengläubigen Fundamentalismus.
Epiphanie [sic!] der Anwesenheit Gottes, oder von mattan tôra
[מתן תורה], dem Geschenk der göttlichen Weisung,
sprach. Ein jeder Empfang von göttlicher Weisung setzt eine Epiphanie [sic!] Gottes voraus [sic! Warum/Dass sich
eine Weisung nicht auch durch Kurierdienste überbringen ließe, erschließt sich
hier/so kaum notwendigerweise; O.G.J.]: aber nicht jede
Epiphanie Gottes muß unbedingt in einer Gesetzgebung [sic! gar nicht einmal immer in/als
uns schriftlich vorliegende Weisung/תורה? O.G.J.[] münden Für das rabbinische Judentum war der Pentateuch
[die kanonischen ‚Mosebücher‘ als
schriftlicher Tora im engsten Sinne] das
Offenbarungszeugnis [sic! ‚Selbsterschließungszeugnis‘?
Gleich gar im/als Konflikt mit personifizierten ‚Botinnen‘ Gottes,
respektive deren götzendienstfähiger / kritikunfähiger / distanzloser
Verehrung/en; O.G.J. begrifflich mit M.B. & F.X.R. et al. unten] par excellence. Ihm wurde eine größere
Autorität
als den [sie gar bereits middraschisch etc. auslegenden und spätestens insbesondere anwendenden; O.G.J.] Propheten und den Hagiographen [den übrigen Schriften der kanonischen Hebräischen Bibel /
Tanach] zugeschrieben. Jedoch führte diese [mit Sch.b.Ch. zwar als ‚Mitspracherecht‘, nicht aber als
‚Vetorecht‘, bei/in gegenwärtigen / künftigen Entscheidungsfindung/en, zu
verstehende/verwendende; O.G.J.] Autorität des Pentateuchs die Rabbinen nicht
zu einem buchstabengläubigen Fundamentalismus.

Dieselben Rabbinen, die den Pentateuch zur höchsten Autorität
[sic!] in Glaubens- [sic!] und
Praxisfragen erhoben hatten,
bestanden dennoch
[sic! oder eher ‚deswegen‘? O.G.J.] darauf,daß sich die volle
[sic! insofern und von daher genügt es (u.E.)
nicht die ‚mündliche Tora‘, gleich gar den ‚weißen ‚Buchstaben‘-Raum um der
schwarzen Schruft-Feuer her‘ mit / in / als / auf ‚Tradition/en‘ (gleich gar
konfessionall- religiös spezifizierte) übersetzt / reduziert zu verstehen.
Bereits wie Sie/wir ‚zählen‘ erweist sich als weitaus weniger erwartungsgemäß
eindeutig, bis zwingend. Gerade/Schon mathematische Reihen/Folgen
repräsentieren Wahloptionen: 1; 2; 3; 4; 5; … ? 0;
1; 2; 3; 4; …? 2; 4; 8; 16; 32; …? 1; 4; 9; 16; 25; … ?… ? 1; 10; 100;
1000; 10000; … ? … ? i: ii: iii; iv; v;
…? z; y; x; w; v; …? … ? א׳ ; ב׳
; ג׳ ; ד׳
; ה׳ ; … י״א ; … י״ד ; ט״ו ; ט״ז ; י״ז ; … ת׳ ; …![]() ? O.G.J.] Offenbarung [sic!]
Gottes nicht auf den
Pentateuch und noch nicht einmal
auf die Bibel als Ganzes beschränke. Sie lehrten nämlich
[sic! jedenfalls ‚zudem / diesbezüglich‘;
O.G.J.] das Dogma [sic! gar eher weniger, bis ‚eigentlich‘ im
exformativ-denkerischen Ansatz überhaupt nicht ‚dogmatisch‘ (außer wohl / eben
der Existenzbehauprung/en G’ttes, wird sieh ‚jüdischerseits konfessionenübergreifend
konsensfähig‘ ohnehin
onthologisch kein. im engeren Sinne. ‚Lehr-Dogma‘ nachweisen lassen), sondern
vielmehr logischerweise notwendigen, da nie umgebungsfreien (jedoch von
Wahrnehmenden eher selten, als solches, am ehesten beim/vom Übersetzen, als
konfliktanläßliche Schwierigkeiten, bemerkten / reflektierbaren) deutendem
Verstehens jedweder Gramatica / Semiotik überhaupt; vgl. insbesondere beiderlei
Bedeutungen / Vokalaussprachen von resch-waw-chet ר־ו־ח als ‚Raum/rewax/‘ und\aber ‚Wind/ruax/‘, zu
häufig allenfalls eher unglücklich, äh griechisch, auch als ‚[Gottes] Geist‘,
bis auf λόγος /lógos/ (gar versus νόμος /nomos/? – ersteres hebräisch eben eher mit: דבר /dawar/ eben sowohl ‚Sache‘ als auch ‚Wort‘ dafür,
repräsentabel) reduziert, popularisiert übersetzt/verstanden, bis etwa Ps. 62:12 eines hat G’tt geredet, zweierlei habe ich
vernommen‘; O.G.J. mit David] von der „zweifachen Tora“. Zusätzlich [sic! gar eher als/da des Wortwörtlichen / Ausdrücklichen /
Repräsentationen kontextuelle,
komplementäre (raumzeitlich sogar veränderlichen) ‚Außerhalbs‘ und
dennoch/gerade auch darin respektive damit/dazwischen (nicht allein griechisch
‚meta‘-genannt) überhaipt wirkend! O.G.J.] zu der
„geschriebenen Tora“ [תורה שבכתיו
/tora schäbik-taw/]
soll Gott auch eine [sic! nein, studierend und anwendend, ‚anze, gar unendliche,
unerschöpfliche, unergründliche Vielfakten Vielzahlenmengen davon / daran /
darin‘; O.G.J.] „mündliche Tora“ [תורה שבעל פה
/tora schebal pe/]
geoffenbart [sic! ‚des (gar geschrieben, bis dazwischen) Da-Stehenden / Gesagten Verstehenkönnen
zugänglich gemacht/erlaubt‘; O.G.J.] haben, die
schließlich [doch nicht etwa
bereits vollständig final und vollkommen vollendet; O.-G.J.] in der rabbinischen Literatur ihren - teilweisen - schriftlichen
Niederschlag gefunden haben soll und durch die allein die „geschriebene Tora“ [/tora
schebik-tav/] richtig
[sic! gar anstatt ‚ein(ein)deutig singulär und
für immer bis ewig überall exakt deckungsgleich gerade so übereinstimmend
zusammenpassend, logisch widerspruchsfrei, allumfassend und allen gleichzeitig,
gemeinsam einleuchten müssend‘ – damit aber gerade auch nicht etwa ‚nach
einseitiger Wahl / in beliebiger Willkür‘, sondern, zumal
situationsunabhängig,
beziehungsrelationale Zuverlässigkeit/en anbietend/ermöglichend, anstatt
Gefolgschaften erzwingend; O.G.J.] verstanden werden kann. Man vergleiche damit etwa [/ ‚immerhin‘ oder ‚zumindest‘; O.G.J. vielleicht sogar
durchaus mit ‚sola scriptura‘-An- bis ‚kulturellen‘ Einsichten ‚der/von
Freiheit‘ vereinbar?]
die Rolle [sic!
mehr oder minder eingestanden/reflektiert; O.G.J. allem Wahrnehmen
‚hermeneutisch-deuterischen‘ Bedarf unterstellend, zumal jenen ‚objektiven‘
Leuten die ihn legnen müssen/wollen], welche
die Tradition und das Lehramt in der katholischen Kirche oder die Hadith im
Islam spielen.
? O.G.J.] Offenbarung [sic!]
Gottes nicht auf den
Pentateuch und noch nicht einmal
auf die Bibel als Ganzes beschränke. Sie lehrten nämlich
[sic! jedenfalls ‚zudem / diesbezüglich‘;
O.G.J.] das Dogma [sic! gar eher weniger, bis ‚eigentlich‘ im
exformativ-denkerischen Ansatz überhaupt nicht ‚dogmatisch‘ (außer wohl / eben
der Existenzbehauprung/en G’ttes, wird sieh ‚jüdischerseits konfessionenübergreifend
konsensfähig‘ ohnehin
onthologisch kein. im engeren Sinne. ‚Lehr-Dogma‘ nachweisen lassen), sondern
vielmehr logischerweise notwendigen, da nie umgebungsfreien (jedoch von
Wahrnehmenden eher selten, als solches, am ehesten beim/vom Übersetzen, als
konfliktanläßliche Schwierigkeiten, bemerkten / reflektierbaren) deutendem
Verstehens jedweder Gramatica / Semiotik überhaupt; vgl. insbesondere beiderlei
Bedeutungen / Vokalaussprachen von resch-waw-chet ר־ו־ח als ‚Raum/rewax/‘ und\aber ‚Wind/ruax/‘, zu
häufig allenfalls eher unglücklich, äh griechisch, auch als ‚[Gottes] Geist‘,
bis auf λόγος /lógos/ (gar versus νόμος /nomos/? – ersteres hebräisch eben eher mit: דבר /dawar/ eben sowohl ‚Sache‘ als auch ‚Wort‘ dafür,
repräsentabel) reduziert, popularisiert übersetzt/verstanden, bis etwa Ps. 62:12 eines hat G’tt geredet, zweierlei habe ich
vernommen‘; O.G.J. mit David] von der „zweifachen Tora“. Zusätzlich [sic! gar eher als/da des Wortwörtlichen / Ausdrücklichen /
Repräsentationen kontextuelle,
komplementäre (raumzeitlich sogar veränderlichen) ‚Außerhalbs‘ und
dennoch/gerade auch darin respektive damit/dazwischen (nicht allein griechisch
‚meta‘-genannt) überhaipt wirkend! O.G.J.] zu der
„geschriebenen Tora“ [תורה שבכתיו
/tora schäbik-taw/]
soll Gott auch eine [sic! nein, studierend und anwendend, ‚anze, gar unendliche,
unerschöpfliche, unergründliche Vielfakten Vielzahlenmengen davon / daran /
darin‘; O.G.J.] „mündliche Tora“ [תורה שבעל פה
/tora schebal pe/]
geoffenbart [sic! ‚des (gar geschrieben, bis dazwischen) Da-Stehenden / Gesagten Verstehenkönnen
zugänglich gemacht/erlaubt‘; O.G.J.] haben, die
schließlich [doch nicht etwa
bereits vollständig final und vollkommen vollendet; O.-G.J.] in der rabbinischen Literatur ihren - teilweisen - schriftlichen
Niederschlag gefunden haben soll und durch die allein die „geschriebene Tora“ [/tora
schebik-tav/] richtig
[sic! gar anstatt ‚ein(ein)deutig singulär und
für immer bis ewig überall exakt deckungsgleich gerade so übereinstimmend
zusammenpassend, logisch widerspruchsfrei, allumfassend und allen gleichzeitig,
gemeinsam einleuchten müssend‘ – damit aber gerade auch nicht etwa ‚nach
einseitiger Wahl / in beliebiger Willkür‘, sondern, zumal
situationsunabhängig,
beziehungsrelationale Zuverlässigkeit/en anbietend/ermöglichend, anstatt
Gefolgschaften erzwingend; O.G.J.] verstanden werden kann. Man vergleiche damit etwa [/ ‚immerhin‘ oder ‚zumindest‘; O.G.J. vielleicht sogar
durchaus mit ‚sola scriptura‘-An- bis ‚kulturellen‘ Einsichten ‚der/von
Freiheit‘ vereinbar?]
die Rolle [sic!
mehr oder minder eingestanden/reflektiert; O.G.J. allem Wahrnehmen
‚hermeneutisch-deuterischen‘ Bedarf unterstellend, zumal jenen ‚objektiven‘
Leuten die ihn legnen müssen/wollen], welche
die Tradition und das Lehramt in der katholischen Kirche oder die Hadith im
Islam spielen.
Christentum
Im christlichen
[sic!] Glaubensverständnis
[sic! gleich gar allenfalls den ‚sekundären‘ /
‚sachverhaltlichen‘ / ‚dogmatischen‘ Verständnissen des Glaubensbegriffsfeldes;
O.G.J. mit M.B. bis R.H.] erreicht die Offenbarung [sic!]
Gottes ihren Höhepunkt in
Gottes Inkarnation in Jesus Christus [sic!] wobei der ‚Erlösungstopos‘ nicht notwendigerweise jenem
‚der Aussöhnung, gleich gar nicht allein/immerhin mit Gott‘, vorgezogen
sein/werden muss, um Erkenntnisfortschrittsparadigma gerecht zu werden, zumal,
mindestens ‚transzendent / außerraumzeitlich‘, auch schon ‚alles Kommende‘,
zumal עולם הבא /olam haba/ bekannt, anstatt etwa ‚gegenwärtig auf Erden / unter
der Sonne anwesend‘; O.G.J.]. Da aber auch für das rabbinische Judentum
die Tora mehr [sic!] bedeutete als nur das auf Pergament
geschriebene Wort (die Tora war [sic! gar eher
‚durativ‘ denn
‚beendet‘ zu verstehen?
O.G.J. nicht so ganz ohne machen ‚gnosis‘-‚ bis ‚Hellenismus‘-Verdacht in
beiderlei Überlieferungen]
z.B. auch das Werkzeug, mit
dem, oder der Plan, nach dem Gott die Welt erschuf; vgl. BerR 1,1), ist vieles, was
im Prolog zum Johannesevangelium steht,
Juden und Christen gemeinsam.
Allerdings spalten sich die
Wege beim 14. Vers („Und das Wort
ist Fleisch geworden“), der im Johannesevangelium das
charakteristisch Christliche [sic! gar eher ‚Hellenistische- bis gnöstisches-Übergreifen‘? O.G.J.]
ausdrückt, während die
jüdische Theologie [sic!] einerseits mit ihrem Begriff von der
Schekhina [שכינה] nie so
weit ging, in einem einzelnen Menschen [oder
gar Symbol bis Gegenstand? O.G.J. durchaua besorgt] die volle Verkörperung
Gottes zu sehen, und auch anderseits in der [sic! analytisch/sprachphilosophisch gar nicht verzichtbaren Erkenntnisverfahren;
O.G.J. /paedes/-orientiert-פרד״ס mit M. Buber] Lehre von der „mündlichen Tora“ den [sic! gar des
resch-waw-chet ר־ו־ח sowohl Raumes als auch
der Bewegung/Vermittlung zwischen Sendenden und Empfangenden; O.G.J. eher
bei/mit den ‚Teig‘-Metaphern des Nussschalen-Theorems unvollständig
verstandener Toraschichten/סוד] Ausdruck für die fortdauernde Offenbarung [sic! mindestens aber
der situativ aktuellen Anwendung von Rechts-
äh Weisungstexten bis G’ttes Selbsterschließungen; O.G.J. /darasch/-Gemurmel-entblößend-דרש] der göttlichen Weisung
gefunden hat.
Mittelalter
Im Mittelalter wurde das
[sic! eben ‚ein‘ in einer bestimmten, durchaus
fragwürdigen Art und Weise verstandenes; O.G.J.] Verhältnis
zwischen Offenbarung [sic! gleich gar
‚Glauben‘ genannt und als ‚das für wahr-Halten von Sätzen, bis deren
Bekenntnis‘ definiert;
O.G.J. mit R.H.]
und Vernunft [sic! indoeuropäisch zum/vom allen gemeinsam und gleich singulär
vorgesetzten allerobersten Gesamten vergottemd, äh verteilend; O.G.J.] Gegenstand einer sich durch die
Jahrhunderte ziehenden
Diskussion. Da [sic!]
aber schon von den frühen Rabbinen die menschliche
Entdeckung von Vernunftwahrheiten
aJs_Gnadentat Gottes angesehen
wurde, kam es [sic! gar eher
platonisch singulärem Wahrheitsverständnis geschuldet; O.G.J.] zu der weitverbreiteten Behauptung, daß ein Konflikt zwischen
Offenbarungs- und Vernunftwahrheiten an und für sich gar nicht bestehen kann [sic! eher, gar fälschlich, ‚nicht könne‘ – respektive
‚(‚Vielfalten Vielzahlen-Füllen‘ / Paradoxes, bis, zumal ‚zweckfrei‘, Kontemplatives) nicht
existieren dürfe‘; O.G.J.].
[Hinter der Entstehung dieser / Entscheidung für
diese Problemstellung(smuster, im engeren gar nicht
notwendigerweise beantwortungspflichtigen / nicht unausweichlichen Sinne),
verborgen / verstellt der (auch hier versuchte)
Blick auf, bis hinter/über, einen der grundsätzlichsten Verständnisirrtümer der
/ Fehlerwartungen an und von beziehungsrelationalen
alef-mem-nun-Begriffehorizonte/n א־מ־נ mit deren, bis gar unter, durchaus wissbare und wichtige,
doch alternativenreich optional präsentablen, Inhalte (an Sätzen, bis
über/von Sachverhalten respektive Menschenverhalren), die einander keineswegs hierarchisch, oder
summenverteilerisch (‚entweder-oder‘-dichotom) gegenüber gestellt
sein/werden/bleiben müssen. – Von besonderer Bedeutung, dass derartige Unterscheidung/en gerade auch ‚rein
innerweltliche‘ Beziehungen jedes Erkenntnisprozesses, auch/schon abgesehen von
(außer-
bis überraumzeitlichen) Transzendenzfragen,
betrifft.]
Warum dann also überhaupt Offenbarung? Auf diese Frage [sic! genauer ebenfalls ‚nur‘, im engeren
begrifflich-konzeptionellen Denksinne, eine prekär aus vorstehenden
‚Offenbarungsvertrauen-versus-Vernunften-Wissen‘-Axiomen abgeleitete Problemstellung; O.G.J. mit R.G.O.
Prinzipiengöttzendienst vermutend] antwortete
Saadja Gaon im 10. Jahrhundert,
daß die [sic!] Offenbarung
eine Methode ist, die Gott bei der
Erziehung [sic!] der Menschen anwendet.
Nicht alle Menschen sind klug
[bis ‚weise‘; O.G.J.] genug, zur gleichen Zeit zu den
Geboten [sic! indoeuropäischer sprachen Tripubt verdächtige
Wahrheitssigularkonstruktion bis Utopie; O.G.J.] zu gelangen, die sich die [sic!]
Vernunft erarbeiten kann
[sic! womit allerdings der umkehrschlüssige
Irrtum droht, Gottes Selbsterschließungen damit zu verwechseln/ersetzen;
O.G.J.]. Um aber diese Gebote [sic! also ‚Alles an überhaupt Erkenntnis/Erfahrung‘ von Aspekten modalen ‚Imperativen des/der Wirklichen‘.
über ‚Regelmäßig- respektive Wahrscheinlichkeiten‘ und etwa ‚Rechtsätze und
Sitten‘ bis zu מצוות  /mitzwot/, undifferenziert vermischt /
zusammengefasst; O.G.J.]
allen gleichzeitig [sic! jedenfalls in / als deren notwendige, bis gar darüber hinaus
zusätzlich, zu beachtende, Verhaltenskonsequenz/en; O.G.J.] zugänglich zumachen, wurden sie von Gott auf übernatürlichem [sic!] Wege offenbart. Und die
zeremoniellen [sic! bereits
begrifflich mindestens so üreär wie in dem eigen Artikel des Lexikons dazu
deutlich ausgeführt, sind/werden es gerade rituelle bis kultische
Verhaltensunterschiedfragen des Respekts die über das und aus dem hinaus /
heraus ragen, was juristisch cidifuziert und ethisch interkulturell
konsensfähig an Minimalvoraussetzungen – gleich gar er- bis verträglichen –
menschlichen Zusammenlabens, gleich gar trotz / wegen Gött, erforderlich /
strittig; O.G.J.]_Gebote, obwohl sie der [sic! ohnehin nicht derart singulären, sondern eher
aspektischen, und\aber Menschen
allenfalls/immerhin
/mitzwot/, undifferenziert vermischt /
zusammengefasst; O.G.J.]
allen gleichzeitig [sic! jedenfalls in / als deren notwendige, bis gar darüber hinaus
zusätzlich, zu beachtende, Verhaltenskonsequenz/en; O.G.J.] zugänglich zumachen, wurden sie von Gott auf übernatürlichem [sic!] Wege offenbart. Und die
zeremoniellen [sic! bereits
begrifflich mindestens so üreär wie in dem eigen Artikel des Lexikons dazu
deutlich ausgeführt, sind/werden es gerade rituelle bis kultische
Verhaltensunterschiedfragen des Respekts die über das und aus dem hinaus /
heraus ragen, was juristisch cidifuziert und ethisch interkulturell
konsensfähig an Minimalvoraussetzungen – gleich gar er- bis verträglichen –
menschlichen Zusammenlabens, gleich gar trotz / wegen Gött, erforderlich /
strittig; O.G.J.]_Gebote, obwohl sie der [sic! ohnehin nicht derart singulären, sondern eher
aspektischen, und\aber Menschen
allenfalls/immerhin ![]() begrenzt
rational zugänglichen/verfügbaren; O.G.J.] Vernunft nicht
widersprechen [sic! so manche Optimierungsbemühung ökonomischer Modalität
konfligiert ja nicht nur mit ‚Höflichkeiten und Respekt‘ überhaupz, sondern
auch mit höherrangigen ‚Künsten-Freiheiten‘; O.G.J.], sind durch die reine [sic!] Vernunft nicht erreichbar und bedurften daher der Offenbarung
[sic! jedenfalls ‚transzendender‘/göttlicher
Mitteilung, bis gar/immerhin wechselseitiger Absprache/Vereinbarung (gleich gar
innerhalb eines Gemeinwesens, bis des
‚Kulturraumes‘, nicht zuletzt deswegen und daher zu häufig mit als/zu
Gott/Göttern verwechselt/überhöht); O.G.J.].
begrenzt
rational zugänglichen/verfügbaren; O.G.J.] Vernunft nicht
widersprechen [sic! so manche Optimierungsbemühung ökonomischer Modalität
konfligiert ja nicht nur mit ‚Höflichkeiten und Respekt‘ überhaupz, sondern
auch mit höherrangigen ‚Künsten-Freiheiten‘; O.G.J.], sind durch die reine [sic!] Vernunft nicht erreichbar und bedurften daher der Offenbarung
[sic! jedenfalls ‚transzendender‘/göttlicher
Mitteilung, bis gar/immerhin wechselseitiger Absprache/Vereinbarung (gleich gar
innerhalb eines Gemeinwesens, bis des
‚Kulturraumes‘, nicht zuletzt deswegen und daher zu häufig mit als/zu
Gott/Göttern verwechselt/überhöht); O.G.J.].
Nach Mose ben Maimon (1135-1204) sind etwaige
Widersprüche zwischen Vernunft und Offenbarung
nur scheinbar, und sie
sind dadurch zu schlichten, daß
man entweder die vermeintlichen Schlüsse
der Vernunft nochmals streng überprüft [sic! ![]() Sir
Karl Reimund (Poppers)
Sir
Karl Reimund (Poppers) ![]() Falsifirkationsprinzip geht bekanntlich soweit nur überhaupt
widerlegbare Behauptungen für im engeren Sinne wissbar qualifizieren zu dürfen;
O.G.J.] oder daß man, nach stattgefundener Überprüfung, die bezügliche Bibelstelle
anders als zuvor auslegt, denn „die
Pforten der Deutung sind uns nicht verrammelt und verboten“ (More Nebhukhim
II, 25).
Falsifirkationsprinzip geht bekanntlich soweit nur überhaupt
widerlegbare Behauptungen für im engeren Sinne wissbar qualifizieren zu dürfen;
O.G.J.] oder daß man, nach stattgefundener Überprüfung, die bezügliche Bibelstelle
anders als zuvor auslegt, denn „die
Pforten der Deutung sind uns nicht verrammelt und verboten“ (More Nebhukhim
II, 25).
|
Neuzeit Gerade das wurde aber von den
[sic! gar gar ‚vielen‘ bis ‚den meisten‘
nicht etwa ‚allen‘; O.G.J.] Denkern der Neuzeit bestritten. So wendet sich im
17. Jahrhundert z.B. Baruch Spinoza
besonders scharf gegen die Versuche
des Mose ben Maimon, eine Harmonie zwischen der Bibel [sic! |
|
Reduktionismen,
das meist |
s |
|
|
|
|
|
jedenfalls, bis eher, dem was zeitgenössisch und/oder bisher wie
– gar kaum völlig vernunftlos – davon / darin
/ daraus / damit verstanden / gedeutet sowie gemacht wurde; O.G.J.] und der [sic! ihrerseits unter vergottendem Verabsolutierungsverdacht
stehend gehandhabten / indoeurropäisch singularisierend, bestenfalls einseitig
/ aspektisch, verstandenen (gar/zumal füt
allumfassend, absolut und sogar vollständig begriffen gehaltenen); O.G.J.] Vernunft herzustellen, da es ja eben Spinozas
Anliegen war, die Bibel dem gemeinen
Volk zu überlassen, während die Bedürfnisse der Philosophen allein durch die
Vernunft gedeckt werden können [sic!
was zumindest verdächtig nach, gar
folgenschwer, doch bisher
wohl wenig verstanden, gescheiterten Verzichtsversuchungen
auf ‚suspekte‘ äh, Subjekt-Subjekt-Relationen, nach, gleich gar objektiv-nötig scheinenden, Herrschaftsoptionen (Besserer) vorzugsweise über
‚Objekte‘, aussieht; O.G.J. gar mit
Jeremia 31]. Als dann im 18._und l9. Jahrhundert (übrigens nicht zuletzt einer Anregung Spinozas folgend) das [sic! eher ‚jenes‘, gleich gar zumal bei Wellinghausen
antisemitisch motivierte, in der Absicht das ‚Alte Testament‘ als unvollkommen
willkürlichen und widersprüchlichen
Autorenmischmasch, wider das trotz meherer Autoren für einheitlich
vollendet gehaltene ‚Neue‘, eben aus Gottes Hand, zu entwerten / widerlegen –
bekanntlich in/an der späteren, entsprechenden ‚höheren Textkritik‘ auch der
Apostolischen Schriften einerseits, sowie der Anerkennung der Toledot- und
anderer Sturlturen der Mosebücher, zumindest nicht alternativlos geblieben;
O.G.J. mit Prof. Bär bis S.R.K. et al.] wissenschaftlich-kritische
Studium der Bjbel aufkam, in welchem man die
mosaische Autorschaft des Pentateuchs
verneinte und auch andere biblische
Bücher einer radikalen Quellenkritik
unterzog, meinte man in fortschrittlichen christlichen und jüdischen
Kreisen, dadurch den Offenbarungsglauben [sic! diesen in der
irrig, äh inhaltlich dogmatisierenden,
vorherrschenden, bzw. zur Herrschaft
über ‚gläubige Menschen‘, verwendeten Form/en, soweit möglich durchaus – nicht jedoch in der
beziehungsrelationalen Kernfrage wechselseitig mit Immanenz interaktionsfähiger Transzendenz(en)existenz;
O.G.J.] widerlegt zu haben.
(Daß das ein Trugschluß war, wurde erst im 20. Jahrhundert entdeckt.) Im
Hintergrund stand der philosophische Idealismus mit seinem immanenten
Gottesbegriff, während das
[sic! womit etwa ‚babylonische und persische
Entstehungszeiten‘ nicht bestritten sein/werden müssen, jedoch wesentliche
Kanonisierungsfragen und Übersetungsschwierigkeiten
respektive –folgen der tanach datiert erscheinen; O.G.J.] biblische Zeitalter, die Spätantike und das
Mittelalter an einen transzendenten Gott glaubten [sic!]
und es ein transzendenter Gott
ist, der die [sic! jedenfalls ‚eine
hinreichen könne‘, anstatt ‚zwingende‘; O.G.J.] Voraussetzung für
eine „von außen“ an den Menschen [sic!
respeltive an mehrere davon
/ Kollektive, bis die Menschenheit insgesamt: O.G.J.] herankommende Offenbarung [sic!] bildet.
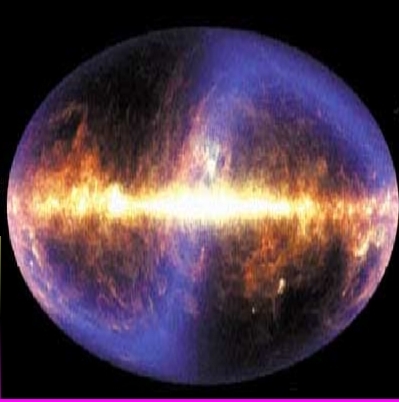 [‚Nichts‘
über die / in respektive von der völligsten Dunkelheit
(bzw. absolutesten
Leere / Nichtigkeit) um/neben/außer
[‚Nichts‘
über die / in respektive von der völligsten Dunkelheit
(bzw. absolutesten
Leere / Nichtigkeit) um/neben/außer ![]() barionischer/‚leuchtender‘
barionischer/‚leuchtender‘ ![]() Materie/Energie erschienend, aussagen zu können, oder dies
nicht tun
zu wollen/sollen,
Materie/Energie erschienend, aussagen zu können, oder dies
nicht tun
zu wollen/sollen, 
bleiben völlig andere Behauptungen/Feststellungen als
existenzielle Bestreitung/en (bzw. jedenfalls zu erwartende/erreichte
Abgeschaftheiten) jedweden
‚Raumes/Hauchs‘ resch-waw-chet der/von ‚Finsternis‘ (bzw. Leere, jedenfalls nicht-leerer / ordnungsloser); die ohnehin nie (ohne Ignoranz/en allenfalls ![]() begrenzter
Rationalitäten/bound rationality) intersubjektiv
konsensfähig, bestenfalls ‚Burgfrieden‘ / anderes Agenda-setting, gar (Gottes-Totsager sterblich) gewesen.
begrenzter
Rationalitäten/bound rationality) intersubjektiv
konsensfähig, bestenfalls ‚Burgfrieden‘ / anderes Agenda-setting, gar (Gottes-Totsager sterblich) gewesen. ![]() Wobei immerhin Kindern auffallt, dass/wo Nichts durchaus (gar legitim) erkennbar.
La.Ku.: «Gott ist im
Judentum selbstverständlich [sic!] keiner Mythologie zugeordnet
und hat keine Familie. Gott ist nicht
geboren und stirbt nicht, Gott hat keine persönliche
Geschichte.
Wobei immerhin Kindern auffallt, dass/wo Nichts durchaus (gar legitim) erkennbar.
La.Ku.: «Gott ist im
Judentum selbstverständlich [sic!] keiner Mythologie zugeordnet
und hat keine Familie. Gott ist nicht
geboren und stirbt nicht, Gott hat keine persönliche
Geschichte.
Und Gott hat keine wie auch immer
geartete Gestalt. Vornicht langer Zeit erinnerte mich ein neunjähriger Junge
daran.
Ich las gerade die Post in meinem
Büro in der Synagoge, als die Lehrerin der vierten Klasse hereingestürzt kam.
„Rabbi, wir brauchen Sie auf der
Stelle", sagte sie. „Die Kinder reden über Gott.“ Ich ging in den
Klassenraum hinunter und begann mit meinem Kurzunterricht. „Erzählt mir, was
ihr sicher über Gott wisst“, forderte ich die Kinder auf. Zögerlich gingen
einige Hände nach oben.
„Gott hat die Welt gemacht“, sagte einer.
Ich schrieb an die Tafel: „Hat die
Welt gemacht.“
„Gott ist einzig“, sagte eine andere und ich
notierte auch das auf der Tafel.
„Gott ist gut“, ergänzte ein
Dritter. Es gab einige Zweifel, aber die Mehrheit war für Gottes Güte.
„Gott ist unsichtbar“, sagte ein
weiteres Kind. Ich begann, das an die Tafel zu schreiben, aber ein anderes Kind
widersprach.
„Du hast Unrecht. Gott ist sichtbar.
Er ist gerade hier, gerade jetzt.“
„Aha“, sagte das erste Kind, „ich
sehe ihn nicht. Wie sieht er aus?“
: Worauf das zweite Kind
antwortete: „Das genau ist es ... Das Nichts ist zu
sehen.“» (S. 74 f.; verlinkende
Gervorgebungen O.G.J.)] 
 [Wesentlich
an/von der Philosophia/Theologia
negativa eben auch, dass wir mit Gott nie zu Rande kommen werden/können,
weil G’tt gar keinen Rand hat (vgl. etwa von Maimonides/Rambam bis Albert
Keller)]
[Wesentlich
an/von der Philosophia/Theologia
negativa eben auch, dass wir mit Gott nie zu Rande kommen werden/können,
weil G’tt gar keinen Rand hat (vgl. etwa von Maimonides/Rambam bis Albert
Keller)] 
Denker wie Martin Buber (1878-1965) und Franz [X.]
Rosenzweig (1886-1929) lassen
das wissenschaftlich-kritische Studium gelten, entwickeln aber [sic! jedweder ‚Glaube der / alle Überzeugtheiten, bis
Weisheiten (respektive dafür Gehaltenes), die nicht kritisch be- und
hinterfragt werden (sollen)
darf/dürfen, verkenn/missbraucht den personalen Subjektcharakter /
Freiheitsaspekt von/in/an/aus Beziehungsrelationen zur/als Heteronomie /
‚Fremdbestimmung‘. Gerade Vertrauensbeziehungen zwischen Subjekten benötigen
die Fähigkeit zur kritisch distanzierenden Unterscheidung zwischen der
Beziehungsqualität und\aber dem – davon gerade deswegen nicht völlig
unbeeinflussten, sondern damit unidentischen, nicht notwendigerweise selbigen /
dem( Erwarteten )entsprechenden –
Verhalten beteiligter Personen / Wesen; O.G.J.], einen Offenbarungsglauben [sic! ‚Gottes
Erfahrbarkeit/en‘; O.G.J.], der von der wissenschaftlichen
Rekonstruktion der alten hebräischen [sic! gar auch was
griechische, bis hin zu der apostolischen Schriften / Erfahrungen /
Debattenbeiträge ‚Rückübertragungen‘ in Iwrit und Aramäisch, mithin in / aus
semitischem/s Denken, angeht, O.G.J. mit
J.S.S.R. et al.] Literaturgeschichte unabhängig [sic! gar ‚Heilige
Schrift wegen ihreres Inhaltes, bis Ursprungs, nicht ihrer – noch so präzise
gehüteten – Formalien wegen‘; vgl. Wa.Ho.] ist. Gott
offenbart [sic! genauer
‚erschließt‘; O.G,J. so weit mit M.B. & F.X.R.] nur [/
‚nicht weniger als‘; O.G.J.]
sich selbst, aber [sic! jedenfalls ‚fast, bis schließlich doch‘; O.G.J.] keine gesetzlichen Schriften und auch keine theologischen Systeme [von eigner ‚G’tteshand‘ geschrieben – allem, äh dem,
Werden entzogen – ewig erhalten:
O.G.J.]. Was schriftlich von Menschen in der
Bibel und [sic! seither, gar
nicht nur;? O.G.J.] in der
traditionellen Literatur festgehalten worden ist, isj nicht die Offenbarung
[sic! schon gar nicht Gott; O.G.J.] als solche, sondern die
[sic! gar allerlei, unterschiedliche? O-G.J.] menschliche Reaktion auf
Erlebnisse der Offenbarung [sic! eher
‚individueller bis kollektiver Gotteserfahrung/en‘ und ‚Weisungsempfangs‘.
Zumal kritischen Rückfragen zu unterzeihen ob es welche, und gleich gar was
deren (davon zu unterscheidende) Konsequenzen / Deutungen, waren/sind; O.G.J. mit R.H.], d.h, also: die menschliche Interpretation der Offenbarung [sic! ‚Gotteserschließung‘; O.G.J. mit E.B.], die dann die Form von Lehren [sic! hauptsächlich stehen da, deswegen nicht notwendigerweise
unverbindliche, ‚Erzählungen / Geschichten‘ – H/aggadah; O.G.J.] und Geboten
[sic!] annimmt.
Wje weit [sic!]
aber die in der Schrift
festgehaltenen Interpretationen der Offenbarung [sic! in welchem Sinne; O.G.J. alef-mem-taw bis … ] wahr und berechtigt sind, führt zu Meinungsunterschieden [sic! also dazu ‚bessere (immerhin) Juden zu sein/werden‘ – zumal ‚es auf das Verhalten (eben nicht allein was die
größtmögliche Sorgfalt und Genauihkeit in / bei der
Überlieferung/en angeht) ankommt‘; vgl. La.Ku.] bei den modernen Theologen und stand auch schon zwischen Buber und Rosenzweig selbst zur
Debatte.
/Autoriläl; Dogma; Inkarnation; Liberales
Judentum / Reformjudentum; Liturgie; Schekhina.
Literatur:
J. Baillie. The Idea of
Reveiation in Recent Thought, New York 1956; S. Mo.ws. System und
Offenbarung. Die Philosophie Franz Rosenzweigs. München 1985; X 7. Peluchowski.
The
Dialectics of Reason and Reveiation. in:
A.J.
H'o//(Hrsg,). Rediscovering Judaism. Chicago
1965. 29-50, 271-273; ders.. Der
Offenbarungsglaube
im neuzeitlichen Judentum, in:
A.
Falaturi / J. J. Peluchowski / W. Slrolz
(Hrsg,), Drei Wege zu dem Einen Gott, Freiburg
i.Br. 1976. 61-74; ders./W. Slrolz
(Hrsg.). Offenbarung
im jüdischen und christlichen
Glaubensverständnis
(QD 92), Freiburg i.Br, 1981;
R. Schaffner / B. Casper / S. Talmon / Y.
Atnir.
Offenbarung im Denken Franz Rosenzweigs,
Essen
1979,» (J.J.P. in Zusammebarbeit mit Cl-Th.,
in deren sehr gelungenem/wesentlichen
Gesprächsergebnisselexikon, Sp. 267-272; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
In
seinem Lexikon-Artikel zur שכינה führt Cl.Th. daselbst, zusammen mit J.J.P., aus: «Schekhina
Jüdische Traditionen
Mit Schekhina ist von Wort (škn) [שכן] und Inhalt her die [sic!] gerade diesbezüglich ist in/mit/wegen אחד
/echad, axad/, wohl eher ‚unverdächtig
pluralisch‘ von Füllen der ‚Vielzahlen Vielheiten‘ die Rede; O.G.J.] „Einwohnung“ Gottes im Volk Israel und in seinen Institutionen gemeint,
d.h. die praesentia Die specialis in Heiligtum und Gemeinschaft [sic! gar ‚Gemeinwesens‘ überhaupt?
O.G.J.] und die heilvolle Begleitung Israels durch
die Geschichtszeit hindurch bis zur endzeitlichen
[sic! nicht zuletzt heftigst verbunden mit den
Konsequenzen des Misverstehens/Missbrauchens von ‚Ewigkeit‘ als ‚sehr, sehr langer Dauer‘ statt/gegen ‚Über- bis Außerraumzeitlichkeiten‘;
O.G.J. kaum weniger um des Versäumens des Gegenwärtigen wegen der Zukunften
besorgt, als ,,, Sie wissen hoffentlich
schon] Fülle von Seiten des sich
herabneigenden [sic!] Gottes
Israels. Der Ausdruck Schekhina [שכינה] taucht erst nach der
Tempelzerstörung (70 n.Chr.) bei den Rabbinen auf und besagt die Fortdauer der
Bundes-Treue Gottes bzw. der Erwählung Israels in der tempellosen Exilszeit.
Die Schekhina-Traditionen stützen sich
auf viele biblische Aussagen, wonach Gott sich stets zu Israel hin
bewegt und im Bundeszelt, im Tempel und im Kreis der sündigen [sic! ‚Ziel/e (gerade / noch) nicht erreicht habenden‘; O.G.J.], bangenden
und hoffenden Israeliten Wohnung nimmt.
Im Anschluß
an den sich in Jes 7,14 findenden „Zeichen-Namen“ ' immanû-'EI (mit uns
ist Gott) sprechen die Rabbinen in bHag 14b von immanû- šekina (mit uns
ist die Schekhina). Sie verstanden also die Sehekhina als den Israel
zugewandten, mit Israel Gemeinschaft pflegenden und Israel ins Heil führenden
Aspekt Gottes. Gott ist der Mit-Seiende, Mit-Gehende, Mit-Leidende, der Erlöser [sic!] Israels.
Im MekhY zu
Ex 12,41 heißt es: „Immer wenn die Israeliten geknechtet wurden, wurde die
Schekhina - wenn man so kühn reden darf – zusammen mit ihnen geknechtet. [Dann
folgt eine Aufzählung der israelitischen Exile: Ägypten, Babylon, Elam, Edom
=Rom; immer sei auch die Schekhina exiliert und geknechtet gewesen] . . . Und wenn die Israeliten am Ende der
Tage zurückkehren werden, wird auch die Shekhinamit ihnen (aus dem Exil)
zurückkehren.“ Die schckhinatische Gegenwart Gottes läßt sich auch durch die [sic!
‚(Ziel-)Verfehlungen‘]
Sünde Israels nicht
vertreiben: Im Zusammenhang mit Lev 16,16 wird in bYom 56b-57a gesagt: „Auch
wenn die Israeliten verunreinigt sind, ist die Schekhinamit ihnen.“ Von welch
religiös-existentialem Gewicht die Vorstellung von der Schekhina war [sic! gar ‚ist / wird‘, so übernimmt neben/nach Christen
bekanntlich auch der Koran den Begriff arabisch als /sakina/ السكينة ; O.G.J. ], deutet ein
Ausspruch in bShab 63 a an: „Wenn zwei Tora-Gelehrte nicht aufeinander hören,
verursachen sie, daß sich die Schekhina von Israel entfernt“ (hitp. v. slq).
Nach mAv 3,2 ist die Schekhina „zwischen“ bzw. „mitten unter“ jenen, die
sich um die Tora bemühen; sie ist sogar anwesend, wenn sich einer allein mit
der Tora beschäftigt. Im Zusammenhang mit der Schekhina werden im allgemeinen keine Befürchtungen vor unziemlichen Anthropomorphismen
laut. So ist vom Antlitz (yBer 5 , 1 ; yHag
1,1; bBB 10a), den Schwingen (bShab 31a) und den Füßen der Schekhina (bBer 43b;
bHag 16a) die .Rede. Da ja „die Hauptsache der Schekhina unten ist“ (BerR
19.13; Tan naśśo 12 zu Num 7,1; Schäfer 233), geht es den Rabbinen
darum, Erd- und Israelzugewandtheit auch plastisch um Ausdruck zu bringen.
Die Rabbinen
warnen anderseits [sic!] immer wieder vr gefährkichen, zur
Überheblichkeit führenden Gottesspekulationen (mHag 2,1). Der Mensch soll auch
vor der Schekhina Respekt und Abstand behaltsn und njcht hinter sie gelangen
und in_die Gotheit hineinschauen wollen.
In bKet 111b wird warnend auf Dtn 4,24 hingewiesen: „Denn der Ewige, dein Gott, ist. ein
verzehrendes Feuer.“ Dann wird gefragt: „Ist es denn möglich, der Schekhina
anzuhangen (ledabbeq baš-šekîna)“? Statt einer Antwort wird gesagt, man
solle jene Menschen fördern, die sich um die Tora bemühen. Dies werde einem
angerechnet, „wie wenn „man der Schekhina anhangen würde“. Die rabbjnische
Scheu vor dem spekulativen Schauen hinter die Schekhina ins innergöttliche
Lehen hinein wird in der Kabbala vielfach
fallengelassen. Die Schekhina wird nun zur untersten, erdnächsten Sefira. Sie
wird auch „Herrschaft“ [sic!] genannt und mit David, dem Sabbat, dem
Heiligen Geist und der mündlichen Tora verbunden. Der die Tora in ihrem
zuinnerst gemeinten Sinn erfüllende
Kabbaiist pflanzt den Sefirôt-Baum In die Erde, wobei die Schekhina /
Herrschaft als unterste Sefira zum Wurzelwerk wird. Diese Vorstellung kommt der
Herrschaft-Gottes-Verküiidigung Jesu
nahe (vgl. Mk 4,26-29.30-32).
Anwendung für
die christologische Ausdrucksweise
Die von den
Rabbinen schekhinatisch gedeuteten
Stellen der hebräischen Bibel weisen
auf die ![]() Kondeszendenz
Gottes hin. Damit wird Schekhina zu einem möglichen
Interpretament der christlichen [sic!]
Theologie und Verkündigung.
Kondeszendenz
Gottes hin. Damit wird Schekhina zu einem möglichen
Interpretament der christlichen [sic!]
Theologie und Verkündigung.
Num 11,17
und seine targumische Deutung können
eine mögliche Adaptation aufzeigen. Nuim 11,17
steht im Zusammenhang mit der Erwählung der [sic! auch insofern
sogar ‚universalistisch‘, über Jisrael hinau verstehbaren/gemeinten; O.G.J.] 70 Ältesten zu Gehilfen [sic!
vgl. die als/mit ‚Hilfe‘ nicht ganzumfasste
‚Macht‘-Bedeutung von עזר
/‘ezer, ‚esär/ bereits ab Genesis/bereschit] des Mose.
Gott befiehlt [sic! ‚veranlasst‘ jedenfalls; O.G.J.], sie vor
das Bundeszelt zu bringen, ürid sagt
dann zumose: „Dann werde ich herniedersteigen (yrd) und dort mit dir
reden.
Ich werde etwas vom Geist [רוּח] nehmen, der
über dir ist, und werde ihn auf sie legen . . . “ Der Targum PsJ aktualisiert
dies so: „Dann werde ich mich offenbaren [sic!] in der Pracht meiner Schekhina und dort mit
dir reden. Ich werde den Geist der
Prophetie vermehren
[sic! mithin nicht allein / immerhin
‚summenverteilungsparadigmatisch‘ gelesen/verstanden; O.G.J.] und ihn auf sie legen...“ Die Verwandtschaft
zwischen Schekhina-Vorstetlungen und Traditionen über den Heiligen Geist . die
Gabe der Prophetie (teilweise
auch mit dem „Wort“ und der „Herrlichkeit“ Gottes) sind auch an anderen Stellen
belegt, besonders in Targum-Stellen über das Bundeszelt, dieses „Haus der
Schekhina“ (so TFS J zu Num
11,24 u.ö.). Aus diesen Voraussetzungen heraus kann man die Schilderung des
urkirchlichen Pfingstfestes (Apg 1,15-26: Wähl des Matthias; Apg 2,1-42:
Herabkunft des Geistes, Predigt des Petrus) schekhinatisch deuten. Wo immer im
Neuen [sic!] Testament von der Herabkunft oder dem Ruhen
des Geistes Gottes die e Rede jst, kann man von Schekhina reden. Wenn Jesus sich in der Synagoge von Nazaret auf
den laut Jes 61,1f [auf den] auf den
Gesalbten ruhenden Geist beruft, dann ist seine Predigt schekhinastisch
interpretierbar. In 2 Kor 3, 17 heißt es bezüglich des erhöhten Christus [sic!]: „Jetzt ist
der Herr der Geist!“ In targumischer Diktion würd der Vers lauten:
„Jetzt ist
der Herr die Schekhina.“ Damit ist der Weg frei, die Christologie und Pneumatologie von den
Schekhina-Traditionen der Rabbinen der zu Deuten bzw. die
Schekhina-Traditionen für die
Christologic und Pneumatologie in Dienst zu nehmen. Diese [sic!
gleich gar manch Männer-Herrschaften
bloßstellende Überraschungen bergen
könnenden? O.G.J.] Zugänge vom rabbinischen Schekhina-
Verständnis her müssen [sic!
folglich/denn das Gegenteil ist häufig der Fall / die judenmissionarische
Absicht; O.G.J.]
jedoch vorsichtig und ohne ![]() synkretistische
oder das jüdische Glaubensverständms [sic!] vereinnahmende
Nebenabsichten belreten werden.
synkretistische
oder das jüdische Glaubensverständms [sic!] vereinnahmende
Nebenabsichten belreten werden.
/ Bund : Christus/Christologie:
Dreifaltigkeit:
Gott: Inkarnation: Wochenfest/Pfingsten.
IJteratur: H. Emst. Rabbinische
Traditionen
über Goites Nähe und Gottes Leid, in: C.
Thoma, M. Wyschogrod, Das Reden vom einen
Gott bei Juden und Christen, (JeC7), Bern
1984,
157-177; A. Goldberg. Untersuchungen
über die
Vorstellung von der Schekhinah in der
frühen
rabbinischen Literatur (SJ 5), Berlin 1969;
P. Kuhn. Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie
der Rabbinen, München 1968: P. Sehäfer
Rivalität zwischen Engeln und Menschen.
Untersuchungen
zur rabbinischen Engelvorstellung
(SJ 8), Berlin 1975; ders.. Die
Vorstellung vom
Heiligen Geist in der rabbinischen
Literatur,
München 1972. T» (Sp. 351-354; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.) Insbesondere Kabbalisten, bis gar (zunehmend
öffentlich wahrnehmbar?) Kabbalistinnen, entdeck(t)en in/an/mit
‘Shekhina שכינה female (called) aspects of G’d, too‘.
So die stets präsente, vielleicht doch nicht nur / immerhin metaphorische
Analogie (anstatt deckungleich identische Uniwolie) der Beziehungsverhältnisse,
respektive ‚Gegenüberheiten‘ (mindestens, bis nicht allein, ‚sich Selbst‘
opponierend, äh parlamentarisch?),
zwischen / von Frau(en, gleich gar spezifisch, bis individuell) und Mann
(bis Männern), mit jenen zwischen Gott und Mensch (respektive ‚sozialen Figurationen‘,
insbesondere derselben, bis Menschen/heit).  Muss hier / eigentlich der Verdacht überraschen: Dass
schlechte Verhältnisse zwischen ‚Mann und Frau‘, Zerstörung, gar Churban (begrifflich spätestens/erstmals für
die Katastrophen der Jahre 586 v. und 70
n. Chr. zu Jerusalem, und
dann vielleicht auch 1492 auf der iberischen
Halbinsel, und/pder für
Muss hier / eigentlich der Verdacht überraschen: Dass
schlechte Verhältnisse zwischen ‚Mann und Frau‘, Zerstörung, gar Churban (begrifflich spätestens/erstmals für
die Katastrophen der Jahre 586 v. und 70
n. Chr. zu Jerusalem, und
dann vielleicht auch 1492 auf der iberischen
Halbinsel, und/pder für ![]() die Shoa(h)
bis 1945, verwendet), wo nicht sogar noch Unvorstellbareres,
ermöglichen? – Früh wurde bereits talmudisch darauf hingewiesen, dass das
Herausziehen / Weglassen von jud-י und he-ה (immerhin der Flagge G’ttes – vgl. zumal, gar beabsichtigte
vermischende, ‚Verwechslungen‘ von ‚Gehorsam‘ mit
die Shoa(h)
bis 1945, verwendet), wo nicht sogar noch Unvorstellbareres,
ermöglichen? – Früh wurde bereits talmudisch darauf hingewiesen, dass das
Herausziehen / Weglassen von jud-י und he-ה (immerhin der Flagge G’ttes – vgl. zumal, gar beabsichtigte
vermischende, ‚Verwechslungen‘ von ‚Gehorsam‘ mit![]() als,
eben höchstens scheinbar
‚verantwortungsfreier / pflichtgemäßer, Gefügigkeit‘) aus/von/zwischen ‚
איש /‘isch/ undװaber אשה /‘ischa/‘, noch zwei אש ‚Feuer‘ alef-schin
/‘esch/ אש …
als,
eben höchstens scheinbar
‚verantwortungsfreier / pflichtgemäßer, Gefügigkeit‘) aus/von/zwischen ‚
איש /‘isch/ undװaber אשה /‘ischa/‘, noch zwei אש ‚Feuer‘ alef-schin
/‘esch/ אש …
Ach ja, und\aber in
seinem (überarbeiteten) 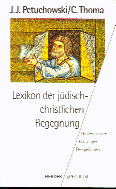
Lexikon-Artikel ebenfalls ‚zur/von der‘ תורה komprimiert
J.J.P. (zusammen mit Cl.Th.)
nochmal fein uns/hier gar Wesentlichstes,
äh …: «Gesetz
Der Begriff im Judentum
Das Judentum ist die Religion [sic!] der
Tora, und unter den verschiedenen Bedeutungen des Wortes tora (wie „Lehre“, „Weisung“, „Offenbarung“)
gibt es auch die Bedeutung[en von;
O.G.J.] „Gesetz“.
Gottes Offenbarung
an Israel bestand [sic! und tut dies weiterhin;
O.G.J. mit J.J.P.] nach
jüdischer Auffassung [sic! mindestens; O.G.J.] aus Lehren, Weisungen und Gesetzen. Dabei ist
zu bemerken, daß „Gesetz“ nicht die
alleinige Bedeutung des hebräischen Wortes tora oder des griechischen
Wortes ![]() nomos ist [deren begriffliche Höfe/Reichweiten einander wechselseitig nur
teilweise deckungsgleich überlappen; O.G.J.]. Das ist oft von nicht jüdischen Beurteilern des Judentums [sic! respektive ‚der Juden‘; O.G.J.] vergessen oder übersehen
worden, und das Judentum ist daher oft ausschließlich als „Gesetzesreligion“ dargestellt worden - eine
Verengung des Begriffs von tora, zu der allerdings auch [sic! ‚griechische‘ Denkformen kennende, und auch
abendländisch ‚aufgeklärt‘-sozialisierte? O.G.J. Determinismen entblößend] jüdische Denker wie Baruch Spinoza (1632-1677)
und Moses Mendelssohn (1729-1786) beigetragen haben.
nomos ist [deren begriffliche Höfe/Reichweiten einander wechselseitig nur
teilweise deckungsgleich überlappen; O.G.J.]. Das ist oft von nicht jüdischen Beurteilern des Judentums [sic! respektive ‚der Juden‘; O.G.J.] vergessen oder übersehen
worden, und das Judentum ist daher oft ausschließlich als „Gesetzesreligion“ dargestellt worden - eine
Verengung des Begriffs von tora, zu der allerdings auch [sic! ‚griechische‘ Denkformen kennende, und auch
abendländisch ‚aufgeklärt‘-sozialisierte? O.G.J. Determinismen entblößend] jüdische Denker wie Baruch Spinoza (1632-1677)
und Moses Mendelssohn (1729-1786) beigetragen haben.
Immerhin spielt das Gesetz im Judentum eine
erhebliche Rolle [sic! ‚Recht und Gesetz‘
sollten, bis tun, dies allerdings auch in Venedig, äh zivilisierten
Staatswesen überhaupt: O.G.J. selbst Rabbinen und Imame als Rechtsgelehre
anerkennend], und im
biblischen Hebräisch gibt es eine ganze Anzahl von Wörtern, die den verschiedenen Gattungen des Gesetzes
Ausdruck verleihen (vgl. z. B. Ps 19, 8-10).
Im rabbinischen Judentum
ist das Wort Halakha [הלכה] bevorzugt,
das so viel wie „das Gehen“, „das Wandern“ und „der Weg“ bedeutet und daher
auch das dynamische Element der jüdischen Gesetzgebung ausdrückt. Biblischer
Glaube [sic!] will nämlich in die Tat umgesetzt werden, und diesem Zweck dient
das Gesetz.
„Ihr sollt auf meine Satzungen und meine
Vorschriften achten. Wer sie einhält, wird durch sie leben. Ich bin der Herr“ (Lev 18,5) . Das
beschreibt die Rolle, die das Gesetz im Judentum spielt, wahrscheinlich besser
als so manche sich auf Paulus berufende Auffassung, die im „Gesetz“ nur den
ungenügenden Versuch sieht, vor Gott als gerecht zu erscheinen. Das Judentum
sieht nämlich in der Offenbarung des Gesetzes einen
starken Beweis gerade der göttlichen Gnade.
- 68 –
Dazu kommt, daß die Hebräische Bibel mehr als
ein theoretisches Lehrbuch der Religion ist, wie auch die rabbinische Literatur
nicht ausschließlich aus homiletischen Schriften besteht. Die Hebräisch e
Bibel, besonders in den Büchern des Pentateuchs,
ist nicht zuletzt die Verfassung und das Grundgesetz eines als #hier Theokratie
verstandenen Staates, und die Rabbinen
hatten sich um die Verwaltung von autonomen jüdischen
Gemeinden - sowohl in der Spätantike als auch im Mittelalter - zu kümmern,
wobei für sie das durch den Talmud interpretierte biblische Gesetz die
rechtliche Basis darstellte.
„Gesetz“ im jüdischen Bereich erstreckt sich
daher auf weit mehr als nur auf das sog. „ Zeremonialgesetz“.
Christentum und Gesetz
Auch das Christentum hat, trotz Gal 3,15-25 und
ähnlichen Stellen im paulinischen Corpus, nie total auf das „Gesetz“
verzichtet. So mag der Jesus der Synoptiker zwar seine
Meinungsverschiedenheiten über Einzelheiten des Gesetzes mit anderen jüdischen
Lehrern seiner Zeit gehabt haben; aber den Begriff des „Gesetzes“ [tora / nomos] hat er
keinesfalls verworfen (siehe z. B. Mt 5, 17-20; 22, 34-40 par). Der
Jakobusbrief verwirft den Glaub n, der nicht von Werken begleitet ist (bes. Jak
2, 14-26). Die Kirchenväter reden von der nova lex Jesu oder der nova
lex Christi, scheinen sich also am Begriff „lex“ als solchem nicht gestoßen
zu haben. Die katholische Kirche hat ihr kanonisches Recht. Luther benutzte die
Zehn Gebote in seinem „Kleinen“ und in seinem „Großen Katechismus“; und Calvin
ließ Genf im Einklang mit seiner „Institutio Religionis Christianae“ regieren. [sic! Ordnungsloses Chaos willkürlicher Beliebigkeiten
fprchteten und fürchten nicht allein die Herrschenden; O.G.J.]
Die Anpassungsfähigkeit des
Gesetzes
Da sich die Zeiten mit ihren Bedingungen ständig
wandeln, das in Buchstaben gefaßte Gesetz aber die Verhältnisse seiner
Entstehungszeit widerspiegelt [sic! Was gar nicht so wenige Leute zu bestreiten versuchen, die
außerraumzeitliche ‚Offenbarung‘ mit deren immanenten/innerraumzeitlichen
Reoräsentationen/Wortlaut gleichzusetzen interessiert sind/werden; O.G.J.], war innerhalb des Judentums das Gesetz immer
ein Gegenstand ununterbrochener Diskussion und Fortentwicklung, die sich bis in
die heutige Zeit hin ziehen [sic! Dazu gehört auch, dass
Auslegungsentscheidungen und Anwendungsraten auch anders als bisher gewählt/gefunden – respektive geändert
– sinnvoll und richtig, bis besser, sein/werden können und erneuert werden
dürfen: O.G.J.]. Der Begriff einer „mündlichen Tora“
machte es den Rabbinen der Spätantike und teilweise auch noch des Mittelalters
möglich,
das Gesetz den sich stets verändernden
Umständen anzupassen und es dadurch von einer sonst unabwendbaren Versteinerung
zu retten [sic!]. Auch in der Neuzeit war der ursprüngliche Unterschied zwischen
den verschiedenen Strömungen im Judent um (etwa Liberales Judentum; Orthodoxes
Judentum) hauptsächlich auf die Frage über die Entwicklungsfähigkeit des
Gesetzes konzentriert. Andere theologische Meinungsunterschiede kamen erst als
Folge davon zum Vorschein.
 [Rabbinischer Schulenstreit exemplifiziert
Hilles verus Schamais] Die Frage, ob das Gesetz (wie auch immer interpretiert)
je seine Gültigkeit verlieren wird, läßt das rabbinische Judentum offen, d. h., zwei verschiedene Meinungen darüber bestehen nebeneinander.
Nach der einen Meinung soll im
messianischen Zeitalter [sic! innrttsu,zeitlich;
O.G.K. Äonen-Denken jedoch ‚gnosis‘-verdächtig empfimdend] die Beobachtung des
Gesetzes sogar noch gewissenhafter werden. Nach der anderen Meinung hört im
messianischen Zeitalter die Herrschaft des
Gesetzes auf.
[Rabbinischer Schulenstreit exemplifiziert
Hilles verus Schamais] Die Frage, ob das Gesetz (wie auch immer interpretiert)
je seine Gültigkeit verlieren wird, läßt das rabbinische Judentum offen, d. h., zwei verschiedene Meinungen darüber bestehen nebeneinander.
Nach der einen Meinung soll im
messianischen Zeitalter [sic! innrttsu,zeitlich;
O.G.K. Äonen-Denken jedoch ‚gnosis‘-verdächtig empfimdend] die Beobachtung des
Gesetzes sogar noch gewissenhafter werden. Nach der anderen Meinung hört im
messianischen Zeitalter die Herrschaft des
Gesetzes auf.
Paulus mag sich letztere Meinung zu eigen gemacht haben, denn für ihn hatte ja mit dem Kommen
Jesu das messianische Zeitalter bereits angefangen. Interessant ist jedenfalls
die Tatsache, daß, historisch gesehen, messianische Bewegungen im Judentum -
das
- 69 -
paulinische Christentum, die
Schabbetai-Zevi-Bewegung im 17. Jahrhundert, die Frankisten im 18. und 19. Jahrhundert
- und das Reformjudentum und der Zionismus im 19. Jahrhundert immer gewisse
antinomistische Tendenzen gezeigt haben.
/ Gnade: Jesus von
Nazarel; Messias: Paulus;
Reinheil/ReinheiLsgesetze;
Talmud; Zeremonialgeselz.
Literatur:
L . Btieck. Geheimnis und Gebot, in:
ders.,
Wege im Judentum. Berlin 193.1. 33-48;
t
l e n . . Judentum in der Kirche, in: ders.,
Aus drei
Jahrlausenden.
Tübingen -19.18, 121-140; r/cn..
Das
Wesen des Judentums. Darmstadt "1966.
294-308;
K. B a r t h . Rechlfertigung und Recht.
Zollikon/ZUrich
'1948; G. B o r n k am m . Das Ende
des
Gesetzes. Paulusstudien, München ^1966;
W. D . l i a v u ' s . Torah in the Messianic Agc and/or
the Age to Coine. Philadelphia 19.S2:
S. Härinn.
Das
Gesetz Christi. 3 Bde. Freiburg i.Br./München
'-1961, L Jacobs. A Jewish
Theology, London
1973,
211-230; O. H . Pesch. Gesetzund
Gnade,
in; C G G 13. hrsg. v. Franz Böckle u.a.,
Freiburg ^1981, 5-77; R . S. S a r a . w n . The Interpretation
of Jereiniah 31: 31-34 in Judaism, in;
J. J.
Petuchowski (Hrsg.). When Jews and
Christians
Meet, Albany (N.Y.) 1988, 99-123; G.
Scholem.
Die
Krise der Tradition im jüdischen Messianismus.
in;
ders,. Judaica III. Frankfurt a.M. 1973.
152-197;
Hh. Sifiiil.
The Halakhah
of Jesus of
Nazareth Acoording lo the Gospel of
Matthew,
Lanham
(MD) 1986: R . S m e n i l / U. L u z . Gesetz
(Biblische
Konfrontationen), Stuttgart 1981.
P» (Erweiterte 3. Neuauflage
1997, S.; verlinkende Hervorhebungen
O.G.J.)
|
[An, respektive unter oder
in, Kuppeln von San Marco
zu Venedig musifisch
(anstatt |
בראשיתfinished שמות פרק א Exodus Chapter 1 |
[Auch in einem wörtlichen Sinne
eine, durchaus lückenhafte Fortsetzung an Textauszügen der תורה] |
א. וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ:
1:1. And
these are the names of the sons of Israel, who came to Egypt, with Jacob,
every man
with his household.
‘
Namen’ / schemot das Wort nach der und-waw-Verbindungsformel,
daher/voramstehend Bezeichnung des ganzen zweitem Tora-Buches, das eben auch
mit ‚dem Auszug/Exodus‘ befasst – eine wesentliche Problematik von ‚Überschriften‘
bloßlegend.
_____________________________________________________________________________
ב. רְאוּבֵן שִׁמְעוֹן לֵוִי וִיהוּדָה:
1:2. Reuben, Shimeon,
Levi, and Judah,
Vier Söhne der zwölf-Zahl Jskobs/Israels.
_____________________________________________________________________________
ג. יִשָּׂשׂכָר זְבוּלֻן וּבִנְיָמִן:
1:3. Issachar, Zebulun, and Benjamin,
Plus drei ergen sieben der Stammväter.
_____________________________________________________________________________
ד. דָּן וְנַפְתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר:
1:4. Dan, and Naphtali,
Gad, and Asher.
Plus weiere vier sind elf zusammen mit dem bereits hier
befindlichen Josef alle zwälf Stammeslinien beisamen.
_____________________________________________________________________________
ה. וַיְהִי כָּל-נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ-יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם:
1:5. And
all the souls who came from the loins of Jacob were seventy souls; for Joseph was
in Egypt already.
70 leibliche Nachkommen Jakobs (gar eher, respektibe auch ‚all seine‘ bezeichnend. Als nur nummerisch
zumal Ajin) mitgebracht zu Josef nach Ägypten?
_____________________________________________________________________________
ו. וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל-אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא:
1:6. And Joseph died, and
all his brothers, and all that generation.
_____________________________________________________________________________
ז. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם:
1:7. And
the people of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied,
and
became exceedingly mighty; and the land was filled with them.
_____________________________________________________________________________
ח. וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ עַל-מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא-יָדַע אֶת-יוֹסֵף:
1:8. And
there arose up a new king over Egypt, who knew not Joseph.
Gerade wenn Bevöklerungen ihre Vergangenheiten vergessen
(verändert erinnern) sind/warden (auch noch so neue) Herrschende gehalten bis
verpflichtet sie zu kennen (was ja auch manipulative Absichten keinenwegs
verhindert).
_____________________________________________________________________________
ט. וַיֹּאמֶר אֶל-עַמּוֹ הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ:
1:9. And
he said to his people, Behold, the people of the children of Israel are more
and mightier than we;
Dietrologia-Vrtdacht
intregannten/trügerischen Vorgehens, dass/falls der Herrscher Hyperrealität/en begründet/verkündet
– obwohl er damit gemäß 1:7 nicht
etwa nur lügt! Auch
sind Genoziede nicht etwa etwa neu, auch falls hier kein, oder noch kein,
ausdrücklicher genannt bis beabsichtigt – bleigt/ist Vertreibung heftig (genug –
zumal gerade mittels Fronarbeitslasten und sklavischen Dienstbarkeitspflichten).
Als Moses und die Israeliten später bereit/gezwungen/willen ‚zu gehen‘ läßt der
König sie – gar durchaus erwartungsge,äß / doppelbindungslogisch – nicht gehen;
erst als er dazu gezwungen wird, und konsequent jegt er ihen nach, sie (nun
aber doch ausdrücklich) zu vernichten. Was in einer der wohl bekanntesten Szenerien
‚,ümdet‘ (als G’tt respektive Mosche das geteilte
Meer, wieder zusammenkommen läßt). ______________________________________________________________________
י. הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ פֶּן-יִרְבֶּה וְהָיָה כִּי-תִקְרֶאנָה מִלְחָמָה וְנוֹסַף גַּם-הוּא עַל-שׂנְאֵינוּ וְנִלְחַם-בָּנוּ וְעָלָה מִן-הָאָרֶץ:
1:10. Come on, let us
deal wisely with them; lest they multiply, and it may come to
pass,
that, when there would be any war, they should join our enemies, and fight
against us;
and so get them out of the land.
Mindestens Aufruf, wenn nicht Befehl. Zu dfem was der König für
weise erklärt/beansprucht, wenigstens aber für klug vorsorgenden Umgang, hält: Sie )zwar) aus dem Land kriegen. – Damit sie sich nicht
weiter vermerhren und gar im Kriegsfalle miz dem Feind verbünden (können); doch
nicht ohne, und indem, sie auszunützen:
_____________________________________________________________________________
יא. וַיָּשִׂימוּ עָלָיו שָׂרֵי מִסִּים לְמַעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלֹתָם וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה אֶת-פִּתֹם וְאֶת-רַעַמְסֵס:
1:11. Therefore they did set over them taskmasters to afflict
them with their burdens.
And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.
Also wurden Aufseher über die Israeliten gesetzt, um ihnen ‚ihre‘
Lasten aufzuerlenen/abzuverlangen. Und spe richteten sie dem Oharao die beidem
wertvollen hochangesehen erinnerten Städte.
_____________________________________________________________________________
יב. וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ וַיָּקֻצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
1:12. But
the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they
were
mortified because of the people of Israel.
Do je mehr die Israeliten geplagt wurden, desto starker vermehrten
sie sich. Und die Ägypter fühleten sich durch sie gekränkt.
_____________________________________________________________________________
יג. וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ:
1:13. And the Egyptians
made the people of Israel serve with rigor;
Und sie machten (sich) die Israeliten mit strenger Härte
dienstbar.
_____________________________________________________________________________
יד. וַיְמָרְרוּ אֶת-חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל-עֲבֹדָה בַּשָּׂדֶה אֵת כָּל-עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר-עָבְדוּ בָהֶם בְּפָרֶךְ:
1:14. And they made their lives bitter with hard slavery, in
mortar, and in brick, and in
all kinds of service in the field; all their service, which they
made them serve, was
with rigor.
Und sie machten ihr Leben durch harte Sklaverei bitter ……#hier
_____________________________________________________________________________
טו. וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ מִצְרַיִם לַמְיַלְּדֹת הָעִבְרִיֹּת אֲשֶׁר שֵׁם הָאַחַת שִׁפְרָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִית פּוּעָה:
1:15. And
the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, and the name of one was
Shiphrah, and the name of
the other Puha;
Einige bemerken, dass der beiden Hebammen Eigennahmen
überliefert, auch oder gerade falls es Vertretinnen ihres Berufstandes für alle
übrigen sind/repräsentieren, die der
König einbestellte.
___________________________________________________________________________________
טז. וַיֹּאמֶר בְּיַלֶּדְכֶן אֶת-הָעִבְרִיּוֹת וּרְאִיתֶן עַל-הָאָבְנָיִם אִם-בֵּן הוּא וַהֲמִתֶּן אֹתוֹ וְאִם-בַּת הִוא וָחָיָה:
1:16. And he said, When you do the office of a midwife to the
Hebrew women, and see
them upon the stools; if it is a son, then you shall kill him;
but if it is a daughter, then
she shall live.
Erahnbar was mit diesen Töchtern geschehen sollte.
___________________________________________________________________________________
יז. וַתִּירֶאןָ הַמְיַלְּדֹת אֶת-הָאֱלֹהִים וְלֹא עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶן מֶלֶךְ מִצְרָיִם וַתְּחַיֶּיןָ אֶת -
הַיְלָדִים:
2:17. But the midwives
feared God, and did not as the king of Egypt commanded them,
but
saved the male children alive.
‘Mehr’ G’ttesfurcht als Pharaonen-Furcht der hebräischen Geburtshelferinnern.
___________________________________________________________________________________
Ex. 25: 8+9
שמות פרק כה
Exodus Chapter 25
_____________________________________________________________________________
ח. וְעָשׂוּ לִי
מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם:
25:8. And
let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
_____________________________________________________________________________
ט. כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת
תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל-כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ:
25:9. According to all
that I show you, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all
its utensils, so shall you make it.
_____________________________________________________________________________
|
Dogaressa und ‚zofende‘ Edelhofdame ‚sto(o/)l/pern‘ sie – etwa über (Rand-) Schwelle hinaus, äh – hinein? |
Hoppela – bei so manchen Gedanken liegt es wohl nicht entscheidend an der – kaum bestritten – schweren Lesbarkeit von O.G.J.‘s (gleich gar Online-)Texten, sie lieber, besser erst überhaupt nicht ins/unters Heiligtum lassen zu s/wollen (erst recht falls, oder wo, sie bereits resch-waw-chet ר־ו־ח / vorhanden). |
|
|
alef אלף bemerkt(e ja schon länger), dass die (hand)schriftliche tora: ‚Mit/In/Am‘ (so manche der lexikalisch
konsensfähigen Verstehensmöglichkeiten der vordersten/rechten, dort gar etwas
größer geschriebenen, ‚Vor‘-Silbe, aus/in dem otijot) |
|
|
|
|
|
dessen Zeichen kalligraphisch fest
auf[ der Grundlinie / dem Erdboden ]liegt, und das orthographisch an einem
dagesch-Punkt darin ersichtlich ‚bewohnbar‘ grammatikalisch verstärkt, bis
verdoppelt, werdend) beginnt; während das alefbetisch erste Zeichen an
dritter Stelle (zudem nach einem resch) folgt. |
|
Nun aber – ‚am/seit/auf dem
‚Sinai‘/‚Horeb‘ – erfüllt G‘tt sein Versprechen / die Verheißung (an) des
alef‘s Position (in
der Reihenfolge der otijot – die
wichtigsten Wörter – oh Schrecken aller Schrecken über/von ‚sich Selbst‘
/‘an[och]i/ erschließend/öffnend) |
|
||
|
|
Das mit dem Schrecken (dass ‚selbst‘ Mosche, sogar
Adonais Vorbeigehen allenfalls nachträglich, ‚von hinten‘, ertrug) einerseits und was G’tt (zumal – außer und bis eben auf alef – nicht
ausdrücklich stimmhaft)
gesagt (bis gar
eigenhändig geschrieben) habe, weitererseits. |
|
|||
|
«Niemand[sic! – ‚innerraumzeitlich‘ konsensfähig; O.G.J.] weiß mit
Sicherheit, was auf dem Berg Sinai[sic!] geschehen
ist. Die Tora selbst enthält widersprüchliche Aussagen. Manche Menschen stellen sich vor, dass Gott Wort für Wort die gesamte Tora diktiert hat. Andere
glauben[sic!], dass Gott mit dem Finger die Zehn Gebote[sic!] in Steintafeln geritzt hat. Einige meinen, dass Gott Mose
zusätzlich[sic!] zur
Tora auch noch den Talmud[sic!] zugeflüstert hat. Andere wiederum glauben[sic!], dass Gott weder gesprochen noch geschrieben, sondern Mose inspiriert hat. Und
schließlich gibt es noch den Gedanken, dass Mose sich alles[sic!] ausgedacht hat. Jüdische Spiritualität[sic!] lässt all diese Deutungen zu und noch viel mehr. Natürlich[sic!] diskutieren
Juden über etwas so Wichtiges,
wie Gott sein
Selbst dem Menschen offenbart[sic!] und was Gott spricht. Unabhängig von der Deutung stimmen jedoch alle Juden darin überein, dass die Geschehnisse
auf dem Sinai ein für das[sic!]
Judentum eminent
wichtiges Ereignis waren[/sind;
O.G.J.]. Einmal debattierten einige Juden über diese Frage [im
Sinne einer ‚h/aggadusch-narrativen‘, eben
nicht (und gleich gar nicht überindividuell deckungsgleich verbindlich) verhaltensfaktisch entschieden
werdenden ‚Problemstellung‘;
O,G,J, mit R.G.D.]. |
[/aief/ אלף] |
«Kapitel 12 Ganz nah
verbunden Die
gesammelten Lebenslehren des Rabbi Jehuda Arjeh Leib aus der polnischen Stadt
Ger, Sefat Emet („Lippen der Wahrheit") genannt, gelten als die
höchste[sic!] Leistung des polnischen Chassidismus. Die Sefat
Emet lehren, dass Gott nicht
nur überall in der Schöpfung versteckt ist[sic! |
– andere/etliche gehen davon aus, dass der/die Mensch/en die. gar einzige( aktuell anwesende)n Spuren G-ttes darin/auf Erden; O.G.J. etwa
mit Ro.Sp.
formuliert, gar auf den eben durchaus strittigen Suchen, ‚was G’ttes Absicht
bis Wille(n sei; Wa,Ho. etc.], |
|
|
sondern dass wir seine
verborgene Heiligkeit auch durch unsere heiligen Handlungen zum Vorschein
bringen können {Schelach Lecha 5632). Der Mensch ist erschaffen, um den Willen seines Schöpfers
zu tun. [sic! |
– was gleichwohl, geradezu verdächtig, nahe
an die grundstrukturellen Vorstellungen / Axiome des Mythos, grenzt:
Go(e)tt(er) hätte/n Menschen als/zu Sklaven gemacht. Mechanisch-buchhalterisch ‚letztlich‘ / determiniert
dazu gezwungen deren / ‚der Natur‘ / Satans (dazu ohnehin erst mal als erkennbar/bekannt,
oder eben gar willkürlich, zu unterstellenden) Willen (und
sei/wäre es gerne gegen oppositionelles eigenes Widerstreben – aufopfernd) erfüllen zu müssen. – Dem aber ausgerechnet
der G-tt Jisraels (nicht
allein meines Erachtens – inklusive
Diskussions-, bis Verhandlungs- sowie Bündnis[fortschreibungs]- und
Dissens-Bereitschaften) ausdrücklich,
und (aus jedem
‚Sklavenhause‘)
befreiend, widerspricht; O.G.J. mit Mi.El., auch (etwa vor- und neben- bis untenstehende
Vielfalten Vielzahlen ermöglichend) nach . Babamezi'a 59b et al., sogar / gerade in verbindlichen /
halachischen Angelegenheiten, menschlicherseits ‚überstimmbar‘] |
|
Der erste betonte, Gott habe die gesamte Tora gegeben, Wort für Wort.
Der zweite sagte, dass Gott nur die zehn Aussprüche
gegeben habe, allgemein die Zehn Gebote genannt. Der dritte Jude
erinnerte an die alte Legende aus
dem Talmud (Makkot 23a-h), nach der Gott nicht zehn Aussprüche gab,
sondern nur die beiden ersten („Ich bin der Ewige, dein Gott ..." und
„Du sollst keine Götter haben neben mir . . . "). „Schließlich“, so fuhr er fort, „sind die beiden ersten Aussagen die
Grundlage des[sic!] gesamten Judentums. Jemand, der sich daran erinnert, dass es
einen Gott gibt, der Menschen befreit, und dass es keine anderen Götter gibt,
wird vermutlich gläubig[sic!] sein.“ Ein Vierter sagte, Gott habe nur den
ersten Ausspruch gegeben („Ich bin der Ewige, dein Gott"). Und alle vier stimmten darin
überein, dass selbst wenn Gott nur den ersten Ausspruch gegeben hatte,
dieser am wichtigsten war: Da
ist ein Gott. „Nein“, insistierte ein Fünfter, „Gott hat nicht einmal so viel gesagt.
Alles, was Gott gesagt hat, war das erste Wort der ersten Aussage: ,Ich‘ [hebräisch: anochi].“ Und alle fünf waren sich einig, dass
selbst wenn Gott nur
ein einziges Wort gesagt hatte, dieses Wort anochi war, weil es [vgl.
auch nebenstehend; La.Ku.s ‚Kapitel 12‘ mit O.G.J. et al.] die Wichtigkeit des Selbst bekräftigt. Da trat Rabbi Nendel Torum aus Rymanow, der die ganze Zeit zugehört
hatte, vor und sagte: „Nein, nicht einmal das erste Wort. Alles, was Gott
gesagt hat, war der erste Buchstabe[sic!] des ersten Wortes im ersten
Ausspruch, der im Hebräischen auch der erste Buchstabe des Alphabets[sic!]
ist: Alef.“» (Lawrance Kushner 2001, S. 30 f.) |
|
– die Akzeptanz/Verwendung (ins
griechisch-differenzierende Denken) übersetzender Unterteilungskategorien des
‚Lebens/Lebendigen‘ respektive ‚innersten Menschen‘, bis ‚göttlichen (Rest-)Funkens‘
erlaubt ‚gnostisch‘ anmutende
Nicht-Bindestrich-Ganzheits-Bedauerns-Paradigmata des Panteismus; O.G.J. mit
Ka.Ha.] |
|
|
|
an diese Aufgabe hingibt[sic!]. Um
sich selbst ganz[sic!]
diesem] Handeln zu überlassen[sic! |
– auch
/ gerade beimaximal möglichem (namentlich:
asketischem)
Verzicht auf eigene sowie Selbsterhaltungsinteressen, bis
Rücksichten, und/oder gar fernsteuerungsartig genau befolgten Weisungen / treuersten Inspirationsverständnissen (vgl. ‚Lebensübergabe‘ / ‚Bekehrung‘ pp.),
,keineswegs von den Verantwortlichkeiten für, und Folgen des/meines,
tatsächlichen Verhalten/s (gerade
‚auf Erden‘) entlastet oder frei zu sprechen; O.G.J.], |
|
|
|
muss[sic! |
–
was/wozu aber doch – keineswegs notwendigerweise oder gar zutreffend (etwa
gegen Paulus/Saul aus Tarsus [‚ohne Unterlass betend‘] – sowie wider Rabi Leib
selbst und La.Ku.‘s eigene, gar Pantheismus-anfällig
wirkende, Diskontinuitäten-skeptische
Eingangsthese / Verschiedenheiten zu/als Trennungsübel
ausdeuten s/wollende
(Grundlagen-)Argumentation gegen griechisch totalitäre
Abtrennung ‚des Heiligen ['Geistes / Ganzen]‘ von ‚Profanem [Materialismus / Teil]‘; vgl. La. Ku.
2001, S. 7 f.) – ‚exformativ‘ voraussetzend
(bis motivational
intendiert benötigend)
unterstellt, dass die
‚vita contemplativa‘/nicht-punktförmige, gar rundum, Aufmerksamkeit (bis als ‚Leistungsunfähigkeit‘
missdeutete Heiligkeit/Spiritualität) versus ‚vita activa‘ /
punktförmig singulär fokusierte Konzentration (Profanes wahrnehmend) dichotom-dual- entweder-oder-(Null-)Summenverteilungsparadigmatisch widereinander auszuspielen seien;
O.G.J. mit E.B.] |
|
|
«Alef ist
nicht vollkommen still. Alef ist das sanfteste, gerade noch hörbare Geräusch,
das es gibt. Es ist das Geräusch, das der Kehlkopf beim Öffnen von sich gibt.
Deshalb ist Alef der Urgrund allen Sprechens. Öffnen Sie Ihren Mund
und beginnen Sie, ein Geräusch zumachen. Halt! Das ist Alef! Alles, was das Volk[sic!] Israel auf[sic!] dem Sinai hören musste[sic!
|
|
der
Mensch jedoch bereit sein zu verlieren[sic! |
– gar/zumal (blamiert)
zu scheitern: O.G.J. etwamit Ko.We.] |
|
oder jedenfalls (zumal
auch unten am Fuss des Berges, im Lager) ‚konnte & durfte‘;
O.G.J. nicht etwa den Klang bestreitend / beurteilend], |
–
nicht sein Leben hoffentlich[sic! |
– das
Märtyrerwesen, bis Terrorunwesen, wo nicht überhaupt Opfer-Logiken (mythisch-ökonomischer
Grundstrukturen / Axiome kausalistisch-mechanischen Gerechtigkeitsausgleichs) drohen durchaus/gerade
dies anders (Leben ‚vernutzend‘
/ verbrauchend beenden) zu s/wollen; O.G.J. mit und wider so manch gängige
Deutungen des Todes Jeschua’s/Jesu], |
|
|
war der Klang des Alef. So konnten Gott und das[sic!] jüdische Volk sich
verstehen. |
|
aber
sein Selbst[sic! |
–
jedenfalls/immerhin als mit/durch maximal kontrastklar undurchdringliche
Grenze/n vom / zum Nicht-Selbst geschieden / fern; O.G.J.]. |
|
Der Nach einem Midrasch zum Buch Exodus hören Mose und sein Bruder Aaron
dieselben Worte Gottes. Für Mose lauten sie: „Geh nach Ägypten und befreie
die Juden.“ Für Aaron, der bereits in
Ägypten ist, heißen sie: „Geh in die Wüste zu deinem Bruder Mose, er braucht
deine Hilfe.“ [vgl. Ps. 62;12 ‚Eines hat G-tt
geredet. Zweierlei habe ich vernommen‘ – den
protokollarisch-verschriftlichten Beginn
talmudischer
Debatten; O.G.J. nicht verkennen s/wollend, welche
Heftigkeiten diese teils-‚innerjüdischen‘, doch oft basal-prototypischen Auseinandersetzungen
– ‚spätestens‘ japhetischer-Singzular-Entdeckung
/ ‚indoeuropäischer Rechthaberei‘ um
gnostisches-Denken / hellenistische
Kollonialisierungs- und Vormachtsansprüche, ‚und‘ zumal auch in/aus den, sowie um die, Apostolischen
Schriften, gleich gar nicht-jüdischerseits … Sie wissen schon]. Der Midrasch beschreibt Gottes Stimme als machtvoll und Ehrfurcht
gebietend, Gott lässt sie für jeden anders klingen. |
|
Er muss[sic! |
–
sogar und gerade ein (individueller, bis kollektiver)
Identitätsverzicht wäre / ist eben keine Abschaffung / Auflösung der Diskontinuitäten, käme
noch nicht einmal Raumverzicht
/ gnostischer Schöpfungsrücknahme
gleich; hinreichende Rechenkapazität/ein ‚Laplascher Dämon‘ solle gerade /
immerhin leisten die/das (bis zu zwei; vgl. physikalisches
Dreikörperüroblem) einzelne Atom(teilchen),
gerade / falls / solange ohne (gar selbstreflexive)
Individualität / Selbstbewusstsein zählbar, von den anderen / übrigen zu
unterscheiden / ‚Hütchen-Spiele‘ durchschaubar; worüber ja bereits Moleküle (und
gleich gar ganze ‚Tropfen‘) im Verdacht lokaler Verortbarkeit durch
phorensische Physik stehen (sollen); geht es bei den
‚Antiegoistischen‘-Bemühungen gar nicht notwendigerweise um die
üblichen/mächtigen Ersetzungen des/der ‚ich‘s‘ durch ‚Du’s‘ bis ‚vorgegebenes
Wir‘, sondern um Grenzübertrittshandhabungsregime qualifizierter Aufhebung
anstatt Abschaffung/Streichungen der ich-Selbsts/Individualitäten; O.G.J. mit kenegdo ‚Gegenüber‘, gar ezär
‚Macht‘] |
|
Und es gibt sogar eine ganz besonders klingende Stimme für das Ohr kleiner Kinder (Midrasch
Exodus Rabba 5,9). Die göttliche Aussage ist unendlich
bedeutungsvoll, sie lässt so viele Deutungen
zu, wie es Menschen gibt, die sie hören. Kapitel 7 Unendliches Verstehen Juden tauschen
sich immer wieder über das Verständnis der Tora aus, weil jeder ihre Worte
auf besondere Weise hört. Diese Diskussionen
sind nicht als
kämpferische[sic!] Auseinandersetzung misszuverstehen. Wenn Juden über die Tora diskutieren und sich nicht
über die Bedeutung einigen können, helfen sie sich damit aber gegenseitig,
bessere Juden zu werden. Was beispielsweise ist
damit gemeint, wenn die Tora sagt, Gott
habe die Welt[sic!] in sechs Tagen geschaffen? |
|
es zulassen können[sic! |
– denn
(einseitig / meinerseits) kräftig genug, äh
ganz / richtig, ‚zu wollen‘ genügt nicht – um überhaupt so/hinreichend (fähig)
‚wollen zu können‘ sind beziehungrelationale Wechselseitigkeitsfragen mit
den Umgebungen vorfindlich; O.G.J.], |
|
|
dass er sich auflöst[sic!] wie ein Wassertropfen, der ins Meer fällt
und nicht mehr [jedenfalls / immerhin ‚menschlicherseits‘
– doch nicht notwendigerweise
‚totalitär ‚überhaupt nicht / nie gewesen‘; O.G.J.] als getrennt[sic!] oder
eigenständig[sic! |
– was
er/ich nie (oder allenfalls analytisch-denkerisch /
reduktionistisch-scheinbar) umgebungslos / autistisch-autarl war/ist;
O.G.J.] |
|
|
|
zu erkennen[sic!] ist. Ein solches spirituelles Verlieren[sic? |
–
anstatt dreifach
qualifizierten ‚aufgehoben-Sein/-Werdens‘?
Oder doch nur/immerhin (gar heteronomistisch) der Unterwerfung? O.G.J. freinach
F.W.H. mit R.H. – vgl. auch allerlei Wi(e)dergeburts- (gar mit {zumal
‚vertraglichen‘, bis עולם olam/Schöüfungs-}Erneuerungs-)Konzepte(n)] |
|
|
Gab es etwa 24-Stunden-Tage so wie heute, bevor die Sonne und die Erde
entstanden sind? Oder ist [beispielsweise; O.G.J.] gemeint, dass unsere Welt[sic!]
jede Woche neu geschaffen
wird und wir am Sabbat (dem siebten Tag) mit dem Schaffen aufhören sollen, so
wie Gott aufgehört hat? [Nicht nur, andere sehen auch täglich ‚erneuerte Wiederbetretungsoptionen‘ der/von he-basierten-הֵא Realitäten;
O.G.J. mit La.Ku. Vergebung jährlich-‚entschuldigend‘-סליחה] |
|
des Selbst[/bewusstheitlichen sic!] und die Vereinigung[sic! |
–
vorherige/überhaupt (zugleich ‚eigentlich‘ in/nit/durch wichtige
antidualistische ‚Alles
sei Gott‘-Formeln bestrittene) Getrenntheit /
Nichtidentitäten (namentlich: ‚G’tt/Mensch‘) voraussetzend – vgl. gerade La.Ku.‘s
Ausführungen zur vom/im semitischen Otijot װ-WaW-qualifizierten
‚schrägstirchartig-erhaltender‘ anstatt
‚bindestrichmäßig-Teile-auflösend‘ verstandener
Einheit zunal inװder Pluralitäten desװder EINEN echad/achad
אחד (gar ‚einwohnend‘
bis שכינה) anstatt des/der
einsam-alleinigen-Einzigen יחיד jachid: O.G.J.] |
|
Im Hebräischen werden solche Diskussionen l'schem schatnajim genannt:
eine Debatte um des[sic!] Himmels [‚der Himmel‘,
gar des ‚G-ttesreiches und
seiner Gerechtigkeit‘; O.G.J.] oder um Gottes willen {Talmud
Awot 5,1 7). Der Versuch, die Tora zu verstehen, gleicht einer endlosen
Suche[sic! |
auch
einem derart endlosen ‚Finden‘; vgl. Picasso bis E.B.
etal]. |
mit dem Göttlichen heißt Dewekut. Es ist ein „momentanes [gleichwohl gar ‚nicht etwa leeres‘; O.G.J gar
mit Buddha.] Nichts", in dem nicht länger erkennbar[sic! |
dies
würde auch das ‚Futurum exavtum‘/Verantwortlichkeiten löschen, muss aber nicht
sein/werden: Erkenn- und Erinnerbarkeiten sind nämlich gar nicht das/von
Übel. Nicht einmal und\aber gerade nicht erlösungs-theologisch, sollte/muss
die Erlösungstat/Befreiung gerade mit ihrem Wovon doch wohl nicht verloren/vergessen werden;
O.G.J.] |
|
Ganz gleich, wie oft wir sie lesen oder wie oft wir überzeugt sind, verstanden zu haben - immer wird eine [zumindest
in dem Sinne] neue Deutung auftauchen, die [dass
sie; O.G.J.] uns herausfordert. |
|
ist, wo der Mensch (oder überhaupt irgendetwas) beginnt und endet. Der Mensch ist nicht aufgelöst, ohne Geist[sic!] oder ausgegrenzt.
Nein, nur die Grenzen des Selbst sind verschwunden[sic? |
gar
‚nur‘/immerhin als durchlässig bemerkt/überschritten; O.G.J. mit R.G.D.‘s
Grenzregimekonzeption] |
|
Nicht einmal Mose verstand die Tora vollständig. Nach dem[sic!] Talmud fand Mose auf dem Sinai Gott damit
beschäftigt. Letzte[sic!] Hand an die Tora zu legen. Er malte Tagin, kleine
Kronen, auf einige Buchstaben. „Was tust du[sic!] da?“, fragte Mose. „Ich dachte,
die Tora ist vollständig[sic! ‚Lückenlosigkeitsillussionen‘ schwarz-geschriebener Tora-?, äh Vollendetheitsvorstellungs-Forderung/en
des (Geistesmacht-
versus Naturmacht-)Universums, älter/basaler als ‚des mechanischen
Weltbildes Überblicks-Vollständigkeitsversprechen‘; O.G.J. fehlbar mit Di.Ha. & R.Ch.Sch-עולם]. Weshalb fügst du diese kleinen Kronen zu den
Buchstaben hinzu?“ „In ferner Zukunft“,
antwortete Gott, „werden Studierende und Lehrer [lamedim למדים] in jeder kleinen Krone lauter wundervolle Gesetze[sic!]
und bezaubernde[sic!]
Geschichten finden.“ |
|
und was stattdessen bleibt, ist die Einheit von allem. Der Mensch wird
gewahr, dass er im Göttlichen gegenwärtig ist (und schon immer war). Alles ist Gott!» Was menschlicherseits, na klar. Nicht zu erzwingen, einseitig
göttlicher Gnadenakt, sei, während der
Autor Rabbi La.Ku. eher implizit
unterstellt, dass G’tt diesbezüglich wolle bzw. Menschen sollten, also
anderenfalls nur negativ zu verstehende Opposition/en seien. (S.
51 f.) |
|
|
„Kann ich diese Schüler und Lehrer besuchen?“, fragte Mose. „Ja“,
erwiderte Gott, „wende dich einfach um.“ Und gleich fand Mose sich in einem Klassenraum, wo Schüler eifrig die
Tora studierten. Unsichtbar für sie, ließ Mose sich in der letzten Reihe
nieder. Aber er verstand nicht, was sie lernten. Nach einigen Minuten fragte
einer der Schüler den Lehrer nach der Bedeutung einer bestimmten Passage. Der
Lehrer erwiderte: „Ich bin nicht sicher, was diese Worte bedeuten. Aber wir
werden sie trotzdem studieren, weil wir alles im Gedächtnis behalten müssen[sic!
– immerhin vermögen manche Modalverben zu bemerken: dass/was ‚wollen‘,
‚können‘ und\aber ‚dürfen‘ respektive ‚sollen‘ hinzunimmt/unterscheidet;
O.G.J.], was Mose uns gelehrt hat.“ |
הַקָּדוֺשׁ־בׇּרוּךְ־הוּא – salutations needed? [Spätestens
hier halten so manche / gute Gründe die Zurückhaltungspflicht, zumal
bei den optischen, Illustrationen für zu.menschengleich
/ verletzt] Dass Mosche nicht gerade plump/tump, doch heftig, mit G’tt umging sei
… Sie wissen
schon. |
«Als Mose auf dem Berg Sinai ist, bittet er darum,
Gott zu sehen, aber Gott antwortet, dass niemand ihn sehen und leben kann.
„Stattdessen“, sagt Gott, „werde ich[sic!] dich in eine Felsspalte setzen und wenn
ich vorübergegangen bin, wirst du mir hinterhersehen.“ Der[sic!
hier verwendete] hebräische
Ausdruck für „mir hinterher“ heißt achorai Wir missverstehen die
Geschichte völlig, wenn wir sie wörtlich lesen und [‚menschengleich‘:
O.G.J.] annehmen, dass Gott einen Rücken hätte. Das Wort achor hat
aber noch einen anderen Sinn, nämlich einen zeitlichen. Gott scheint also
Mose zu sagen: Du kannst „mein Danach“ sehen (Exodus 33,23). Du kannst sehen,
wie es ist, nachdem ich da war. Wenn du jedoch wüsstest, wie es war,
während ich da war, würde das bedeuten, dass du noch immer[sic!] |
[Kernschwierigkeit
weniger der ‚menschengleiche‘ Aspelt/Teil (zumal G’ttes) sondern eher dessen
‚Gegenteil/e‘; zumal auf die im verhaltensrelevanten Sinne Fragen hinlaufend,
‚dass/was überhaupt, bis welche, Unterschiede sind/werden respektive
machen/bedeuten s/wollen?‘ O.G.J.] |
|
Zuerst fühlte Mose sich geehrt und war voller[sic!]
Stolz. Doch[sic!] dann wandte er sich mit
gequältem[sic!] Gesichtsausdruck
zu Gott: „Die Schüler und Lehrer hier sind so weise und doch hast dumich
ausgewählt, deine Tora zu überbringen.“ Und Gott antwortete: „Nicht einmal
du, Mose, kannst alles von der Tora verstehen“ (Menactiot 29b). |
|
ein wenig an deinem Selbstbewusstsein hängst[sic!], denn dieses sagt dir, dass
während meines Da-Seins
auch[sic!] du da
warst. Und das würde außerdem[sic!] bedeuten, dass ein Teil deines Bewusstseins abgetrennt[sic!] war und auf etwas Falsches[sic!] geschaut hat, dass du also[sic!] nicht vollständig da
warst[sic!]. |
|
|
Jede Generation gewinnt der Tora neue Bedeutungen ab. 1n unserem
Bemühen um ein besseres[sic!
– falls nicht immerhin ‚andere(s‘
oder gar eher ‚noch
weitere/s‘; O.G.J.] Verständnis verbessern wir uns
[oh Schreck;
O.G.J.] selbst. Juden haben keinen
besseren Weg gefunden,
über Gott zu lernen und hm nahe zu
kommen. Alles, was
wir lernen, und alles, was wir als Juden sind[/werden],
kommt aus der Tora. Es ist fast 2000 Jahre her, dass ein Lehrer namens Ben Bag Bag sagte:
„Wende es immer von Neuem, denn alles ist darin enthalten" (Talmud
Awot 5,22).» (Lawrance
Kushner 2001, S.
32-36; verlinkende, farbige Hervorhebungen O.G.J.) |
|
[…] Rabbi Levi Jizchak aus Berditschew deutet die Geschichte anders. Er
weist auf die offensichtliche[sic!] Redundanz in Exodus 34,6 hin. Der Text lautet: „Und der
Ewige ging vor ihm vorbei und rief: Der Ewige, der Ewige, barmherzig und voll
Gnade, langmütig und voller Güte und Treue ...“ Die Worte „der Ewige“ werden
wiederholt, so erklärt Levi Jizchak, weil die menschliche Seele[sic!] ein Teil Gottes ist und weil, wenn
die Seele nach Gott ruft, gleichsam ein Teil Gottes nach dem anderen ruft.
Deshalb wird der Mensch, wenn er Gottes [‚überraumzeitlich‘-qualifiziert
‚ewige‘; O.G.J. mit
P.W. & A.K.] Gegenwart
erfährt, von Ehrfurcht und Liebe überwältigt. Gott ruft nach Gott! Wir werden gewahr, dass wir Teil dessen sind, was wir wahrnehmen
wollen.» (Lawrance Kushner 2001, S. 52 ff.;
verlinkende, farbige und fettgedruckte Hervorhebungen O.G.J., kursiv im Original) |
[‚Person/en‘ im/vom
lateinischen Denken entwickeltes begriffliches
Vorstellungskonzept zur Repräsentation von (gar ‚trinitarischer‘, bis
‚hofstaatlicher‘ oder ‚erd-
und himmelheerischen‘ – zumal durchaus ‚Monotheismus-verträglicher‘)
‚Beisassen(-Pluralität)‘ G’ttes; ohne sogenannte ‚Teile‘ untereinander oder ‚Ganzem/n‘, bis ‚Anderheit/en‘, gegenüber mächtig,
äh hilfsfähig, ‚ausspielen‘ zu müssen; O.G.J. mit
E.B. und J.J.P. im ‚Dialog‘
mit Cl.Th.] |
|
|
Dass, wo, oder immerhin falls, einem Textseiten optisch irgendwie ähnlich vorkommen
sollten wie vor- bis nachstehende Tabellen … |
|
|
|
Wie bitte, Wunder seien
zunächst – und vor allem anderen
(also namentlich gerade schon bevor / ohne Tatsächlichkeitsfragen ihrer
Vorfindlichkeit derart heftig werden s/wollen, dass Verbote versucht werden)
– einmal(ige) Ausnahmen: Inklusive der ganzen Schwierigkeiten, die auf Reproduzierbarkeit
und/oder (gleich gar alltägliche) Dauer angelegte Besonderheiten
definitionsgemäß haben/machen, da und indem sie dann
eben nichts
Besonderes mehr sind/werden,
äh (ausgerechnet
die – spätestens von nun an – ao zu erwartende Regel) wären. |
|
|
«Einst stritten sich die Rabbinen um einen Punkt im Gesetz [sic!]. Rabbi Elieser
[hebrä.: ‚Eiferer‘;
E.A.S.] brachte alle möglichen Argumente vor, um seinen
Standpunkt zu beweisen. Doch die anderen Rabbinen ließen sich durch Rabbi Eliesers
Argumente nicht
überzeugen. Da sprach Rabbi
Elieser: „Selbst dieser Johannisbrotbaum hier kann beweisen, daß die
Entscheidung so ausfallen muß, wie ich es behaupte!“ Der
Johannisbrotbaum entwurzelte sich und rückte hundert Ellen weit fort. (Manche
behaupten sogar, es waren vierhundert Ellen.) Doch die
anderen Rabbinen sagten: „Von einem Johannisbrotbaum läßt sich kein Beweis
bringen.“ Nun sprach
Rabbi Elieser: „Wenn die Entscheidung so sein muß, wie ich es behaupte, dann
soll es der Wasserkanal hier beweisen!“ Da fing das Wasser im Kanal an, rückwärts zu fließen.
Doch die
anderen Rabbinen sagten: „Ein Wasserkanal kann nicht als Beweis dienen.“ Wiederum sprach
Rabbi Elieser: „Es sollen die Wände des Lehrhauses beweisen, daß ich recht
habe!“ Da fingen die
Wände des Lehrhauses an, zu stürzen. Aber Rabbi
Josua schimpfte sie aus und sprach: „Was geht euch Wände es denn an, wenn die
Weisen sich über einen Punkt des Gesetzes [talmudisch
wörtlich: ‚der Tora‘] streiten!“ Die Wände nun
haben sich nicht völlig gestürzt - aus Respekt vor Rabbi Josua. Aber aus
Respekt vor Rabbi Elieser haben sie sich auch nicht wieder völlig
aufgerichtet. Sie blieben wankend stehen. Rabbi Elieser,
der Verzweiflung nahe, schrie jetzt auf: „Wenn die Entscheidung so ausfallen
muß, wie ich es behaupte, dann soll Gott selbst es beweisen!“ Tatsächlich
ließ sich eine himmlische Stimme vernehmen, die sprach: „Was wollt ihr denn
von Rabbi Elieser! Die Entscheidung ist doch in allen Fällen so, wie er es
behauptet!“ Da sprang Rabbi
Josua auf und rief: „Sie ist nicht im Himmel!“ Was bedeutet dieses Zitat aus Deuteronomiurn 30, 12; „Sie ist
nicht im Himmel?“ Rabbi Jirmijah
erklärte: „Die Torah wurde ja schon auf dem Berge Sinai offenbart
[sic!]. Wir brauchen uns daher nicht weiter um himmlische
Stimmen zu kümmern. Schließlich enthält ja die Torah vom Sinai das Prinzip,
daß die Stimme der Mehrheit entscheidend ist.“ An diesem Tage
traf Rabbi Nathan den Propheten Elia. Er fragte ihn: „Was hat Gott eigentlich
in jener Stunde getan?“ Da antwortete
der Prophet: „Gott hat gelächelt und gesagt: ,Meine
Kinder haben mich besiegt! Meine Kinder haben mich besiegt!“ Nach b. Babamezi'a 59b» (So zitiert
von und bei J.J.P. S. 94ff.; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.) |
Na klar ereifert sich ein skeptisch
erklärender Theologe: ‚das Schilfmeer,
durch das Mose die Israeliten geführt habe, sei da nur 30 cm tief – also kein
Wunder, sondern eine
Frage besseren Wissens –gewesen. Die, nicht weniger überzeugte, kritische
Person fragt logischerweise: ‚Wie denn die ganzen
verfolgenden Ägypter in so wenig
Wasser ertrinken konnten?‘
|
Denn /emuna(h)/ אמנה ‚ist‘/bezeichnet,
bis betrifft primär, personale
Subjekt-Subjekt-Relationen (nach
dem Denkform- bis
Empfindungsmuster:
‚ich glaube Ihnen/Dir [nicht]!‘), in den/deren eben überhaupt nicht sekundär/formell – schon gar nicht durch (‚innerlich‘
noch so überzeugtes,
gutes logisches/rhetorisches, interessiertes
oder authentisch
geliebtes, äh nachdrücklichst wiederholt, klar ‚bekanntes‘)
‚Für-richtig/wahr-Halten‘
von Sätzen / (Sach-)Verhalten – ersetzbaren (oder,
gar kompensatorisch, ‚zu unterstützenden‘) Arten und Weisen zumal
(oh Schreck) kritischer (was bekanntlich immerhin nicht notwendigerweise ein
‚negatives, böses Urteil‘ bedeutet – Objekt-Subjekt-)Distanz/Unterschiede zudem/von dem was
‚Sie sagen/meinen‘, bis (ups
Auseinandersetzung) mit dem was ‚Du/ich behaupte/st respektive tu/st, also folglich komplementär sehr vieles unterläßt/eben
lasse/n‘. |
|
‚Fällt‘ eine,
hier ‚grün‘ eingefärbte, Kugel ‚durch‘
(was mindestens drei,
gar senkrecht zueinander befindliche Raumdimensionen voraus setzt) ‚Flachland‘ (gar euklidisch, auf
zweidimensionales reduzierter/beschränkter Gerematria, äh Geometrie) ohne dies(e ‚Realitätsvorstellung völlig) zu zerstören, erscheint solches Geschehen dortigen ‚flatland-Wesen‘, wie/als ein
zunächst aus/am einem ‚plötzlichen‘ Punkt ‚beliebig‘ größer, und\aber dann,
bis zu seinem ‚Verschwinden‘, wieder
kleiner, werdenden Kreis(eindruck). |
Images
© copyritght by PM-Magazin |
||
|
|
‚Bewegt‘ sich eine (dazu immerhin vierdimensionale) Hyperkugel(-‚Hülle‘ griechisch: ‚Sphäre‘, gar ‚verstörend‘) ‚durch‘ dreidimensional( wahrgenommen)en Raum, |
||
|
|
Nicht einmal das Gesetz verbietet Ausnahmen. |
Verhindern (wenigstens) Alles- äh allgemeinste
Niemand-Prinzipien (namentlich
logos plus momps)
suspekt subjektive, äh
singuläre, Individualität/en? |
|
|
של
החיים |
[Die beiden, wohl basalsten, Schwierigkeiten
bleiben: Zumal im Vorhinein/voraus keine intersubjektiv
konsensfähigen Gewissheiten haben zu können (gerade und auch der laplace’sche Dämon
|
Allein schon |
[Längst nicht nur eine bestimmte Einzelwissenschaft/Modalität,
bis sonst (überhaupt k)eine ‚passende Erklärung‘, ist fähig oder berechtigt allein Wahrheitsaussagen (gleich gar finale, etwa über/von ‚Leben‘) zu finden, bis zu machen] |
|
Antwortfall auf Wes(sen)-Fragen Genitiv Abstammung bezeichnend (של hebr.: /schel/ schin-lamed Partikel des
Genetiv und des Besitzes) Antwortfall auf Wem-Fragen
Dativ (indirektes Objekt) Empfänger
des Gegeben darstellend, auch statischer Zustand, Lage, Besitz Stelle/Habe/Gebe/Suche Wer,
(Nominativ) wegen Was oder an We(h)n (Wo Akkusativ)? |
Was diese (immerhin
noch etwas höherrangig eingeschränkte) Modalität biologischer |
– Gleich gar verglichen mit und von jenen Menschen Willkür/en, deren gegenwärtige, belebte
bis lebende, Körper zustande
kam/en Wohl eher noch befremdlicher
folglich, dass/wo
solch( unwahrscheinlich)e Ausnahmen respektive Regel(mäßigkeite)n, gleich gar in/von der /tora/ תורה oder was/wem sonst (wozu, bis wie auch immer verständlich /
auszudeutend)
bezeugte, längst nicht/nie
von allen Menschen deckungsgleich übereinstimmend akzeptiert und/oder
bewertet werden (schon
har nicht: |
|
|
Kommentare und Anregungen sind willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu). |
||
|
|
|
||
|
|
|
by |