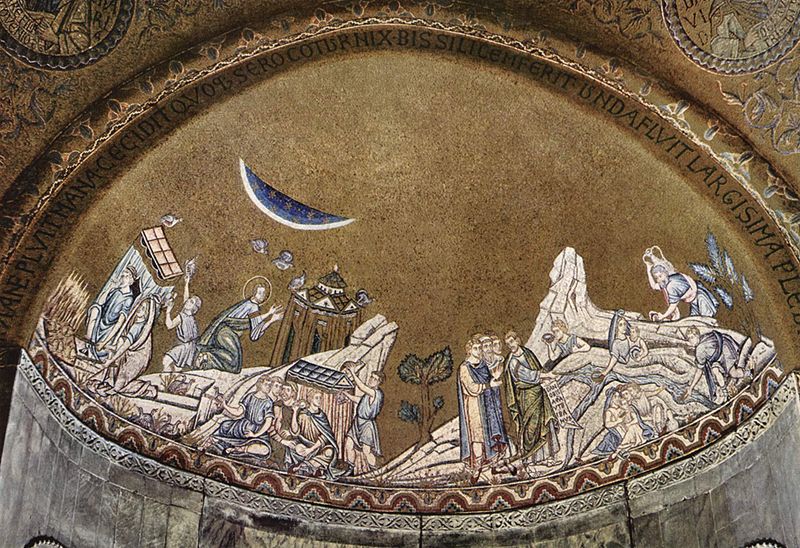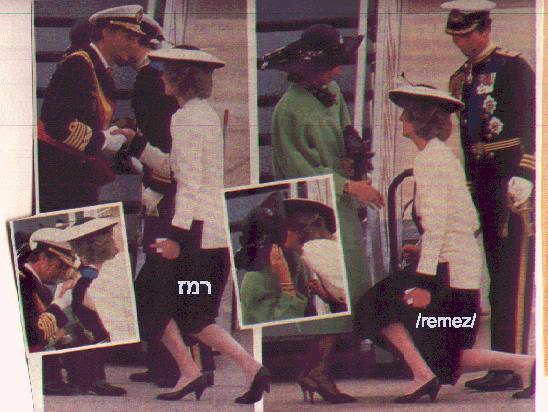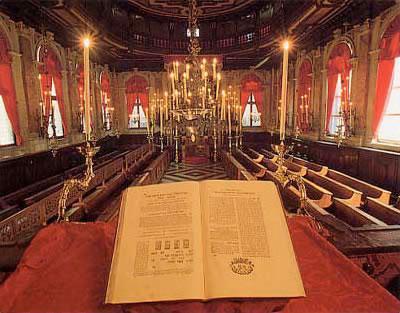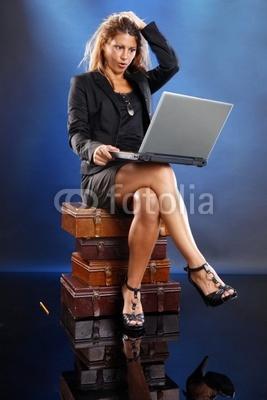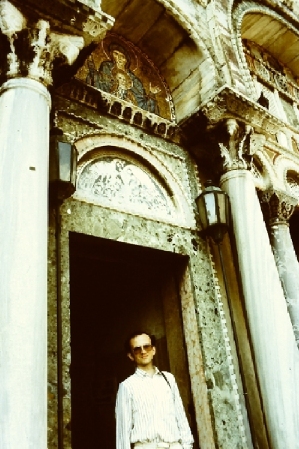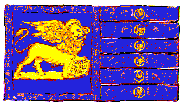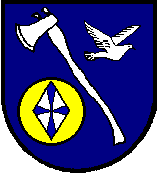![]() Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie
untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie
hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie
untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie
hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
|
Mosaiken, der Kuppel und der Lynette ‚unseres Vaters‘, (inzwischen . gar mehr als dreierlei ‚monotheistisch‘-nennbare) ‚so
zahlreicher Kinder wie die Sterne‘, mit Szenen westlich in (dieser
Nordeckedekenkuppel)/an/vor der ‚Goldenen
Basilika‘.
Hauptschwierigkeit bleiben den Bund Noas / der Menschenheit
mit G’tt –
in welchen Verhältnissen mit und zu den innerraumzeitlichen / jeweiligen ‚nimrodischen‘ /
gesellschaftsvertraglichen / hoheitlich-‚überindividuellen‘ Tauschhandels-Beziehungen:
‚an Gefolgschaftstributen gegen Ermöglichungen / Schutzaussichten‘ auch immer – einschränkende (mehr
vereinbarende), erneuernde /chadosch/, fortschreibende, überbietende (zumal / zumindest ‚partikulare‘)
Variante/n ‚seit / wegen‘ Avrams
und weiterer (‚persönlich-vererbter‘) G’tteserfahrung/en! |
Zu den |
s Von ‚Abrahamskuppel‘
aus, unterm ‚Turmbaubogem‘ durch und über
denm Hauptportalbereich des Atriums, westlich ‚vor‘ der Markusbasilika nach Süden ‚sehend‘, unterm ‚Flutbogen‘
des Noa[c]h, vor der ‚Schöpfungskuppel‘
in Richtung der Zeno-Kapelle, unter und hinter der ‚Lynette mit Kains Wut‘,
Naos und St. Klemens Seitenschiff links,
Piazza rechts, ‚neben dem Foto‘
vorstellbar. |

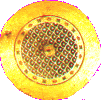

«Erst sekundär (weder das Sein dem Werden, noch Werden … Sein – oder
etwa jeweils umgekehrt – vorziehend) undװaber
allenfalls kritisch/distanziert werde ich mich auch (mal) auf (meine,
Deine, Eure, andere) Deutungen der/von
Beziehungsinhalte/n (Gesten, Mitteilungen –
Handlungen/Ereignisse überhaupt) verlassen können & dürfen.» (O.G.J. Martin Buber auslegend)
Bereits in
seinem ![]() Begegnungslexikonartikel formulierte Cl.Th.,
mit der Unterstützung durch J.J.P., deutlich
zum Stichwort: «Abraham
Begegnungslexikonartikel formulierte Cl.Th.,
mit der Unterstützung durch J.J.P., deutlich
zum Stichwort: «Abraham
Abraham, die Juden und die Proselyten
Was
die Bibel von Abraham zu erzählen
weiß, wird in der rabbinischen Literatur mit vielen legendarischen
Einzelheiten ergänzt, in denen dieser Erzvater alle die Tugenden
verkörpert, die von seinen Nachkommen nachgeahmt werden sollen; so etwa die
Bescheidenheit (PesR 7, hrsg. von Friedmann, 26b) und
die Gastfreundschaft (bSot lOb).
Nach BerR 14,6 wurden die
Welt und alle Menschen im Hinblick auf Abraham und seine Verdienste erschaffen.
Wichtig
für das jüdisch-christliche Gespräch sind folgende Züge des rabbinischen Abrahambildes:
1.
Abraham
gilt als der erste Konvertit zum
Judentum (bHag 3 a), nachdem er aus eigenen [sic!]
Stücken die Existenz des wahren Gottes entdeckt hatte (BerR
38, 13).
2.
Vor
Abrahams Zeiten galt Gott nur als „Gott des [sic!] Himmels“.
Erst durch Abraham wurde er auch als „Gott der Erde“ proklamiert (ebd. 59, 8).
Daher wird auch Abraham als der erste monotheistische [sic!] Missionar [sic!]
betrachtet (Sifoev 32, hrsg. von Finkelstein, 54).
3.
Deshalb,
genau wie im Neuen [sic!] Testament (z. B. Gal 3,7), werden auch im rabbinischen
Judentum diejenigen Nichtjuden, die zum wahren Glauben gekommen sind, „Söhne
Abrahams“ genannt; und der zum Judentum übergetretene Konvertit wird bis zum
heutigen Tag als ,,N.N. Sohn unseres Vaters Abraham“, zur Toravorlesung
gerufen. So ist im Judentum der Begriff ,,Sohn Abrahams“ nicht auf Menschen einer gewissen Abstammung beschränkt,
da man auch im
geistigen [sic!] Sinn ein ,,Sohn [sic! gar auch ‚eine Tochter‘; O.G.J.] Abrahams“ sein kann. Als ein zum Judentum übergetretener
Kreuzfahrer, Obadja, sich an Mose ben
Maimon (1135-1204) mit der Frage wandte, ob er denn,
der doch biologisch
nicht von Abraham abstammt, Gott als den ,,Gott unserer Väter Abraham, Isaak
und Jakob“ im Gebet ansprechen darf, bejahte Mose ben
Maimon diese Frage ganz entschieden. Abraham war ja
der erste monotheistische Missionar, und alle Proselyten zu seinem Glauben [sic!] machen seine Familie [sic!] aus (Mose ben
Maimon, Responsa Nr. 293,
ebd. J. Blau, II, 548-550).
4.
Abraham,
der lange vor der sinaitischen
Offenbarung der Tora lebte, hielt
sich schon an alle Bestimmungen der schriftlichen wie auch der mündlichen Tora (bYom 28b). Drei Motive
scheinen bei dieser Aussage mitgewirkt zu haben: a) Spätere, rabbinische
Generationen konnten sich nicht vorstellen, daß
Abraham, der ,,Freund Gottes“, weniger ,,fromm“ [sic!] und ,,gesetzestreu“ [sic!]
war als sie selbst [geradezu
‚fortschrittsparadigmatisch‘ wirkende Vorstellungen, dass ‚die Letzen‘
namentlich ‚Gemeinde/n herrlicher denn die ersten sein/werden‘, sind auch
jüdischen Messia-Konzepten vertraut; O.G.J.]. b) Der Gedanke, daß Abraham
sozusagen in seinem Leben das göttliche Gesetz [sic!] verkörpere, spielt auch in der hellenistisch-jüdischen Logos-Theologie von Philo aus Alexandrien (1. Jahrhundert) eine Rolle [sic!]
(Migr 127-130). c) Eine gewisse polemische Spitze
gegen das Christentum ist nicht ausgeschlossen. So erklärt z. B. der Apostel
Paulus Gen 15,6 in dem Sinn, daß Abraham allein durch
den Glauben, und nicht durch Werke, vor Gott gerechtfertigt wurde und daß das, was für Abraham möglich war, auch für seine
christlichen ,,Nachkommen“ möglich sein sollte (Röm
4, 13-25; Gal 3,6-14). Dagegen wandten nun die Rabbinen, auf Gen 26,5 gestützt,
ein, daß Abraham doch alle Satzungen der Tora noch vor der sinaitischen Offenbarung gehalten hatte.
{5. Abraham ist Freund Gottes, der
Gott selbst Licht gibt (BerR 30, 10). Er
besitzt messianische Würde und ist
daher
mehr als ein davidischer
Messias
( MTeh 2,
10 zu Ps 2, 8 ). Er ist Garant
für das Bestehen der Welt (BerR 41, 3)
und Herrscher des [sic!] Himmels und der
Erde (ShemR 15, 8). – Erweiterte 3. Neuauflage
1997, S. 3}
Islamisches Abrahambild
Es
blieb dem Islam überlassen, darauf hinzuweisen, daß
Abraham ,,weder Jude noch Christ war; vielmehr war er „lauteren Glaubens“
(Koran, 3. Sure, 60). Damit will der Islam Abraham für sich selbst in Anspruch
nehmen, wie es dann auch heißt: ,,Siehe, Abraham war ein Imam, gehorsam gegen
Allah und lauter im Glauben...“ (16. Sure, 121). Der Islam versteht sich selbst
nur als Wiederveröffentlichung der ursprünglichen Offenbarung des einzigen Gottes, d.h.
der wahren Religion, die schon vor Mohammed in der jüdischen Tora und christlichen Evangelium ihren Niederschlag
gefunden hatte.
Eine
Neubesinnung auf ,,abrahamitische“ Ursprünge mag daher
nicht nur das jüdisch-christliche Gespräch fördern, sondern auch zu einem ,,Trialog“ der beiden biblischen Religionen mit dem Islam
führen. P
Abraham und das Christentum
Im
Neuen Testament [sic! ‚In/Von den
Apostolischen Schriften‘; O.G.J.]
und in der christlichen Tradition wird Abraham - ähnlich wie im Judentum - als
Typus des wahrhaft Glaubenden und sich in Glaubensprüfungen Bewährenden gesehen
(Jak 2,20-24), dann aber auch als Garant der christlichen [sic! gar eher ‚auch der nicht-jüdischen‘;
O.G.J.] Mit-Erwählung. Dabei schwingen
viele Nebentöne mit, die Abraham relativieren und erhöhen. Außerdem werden auch
Polemiken gegen die nicht christusgläubigen Juden mit der Abrahamsgestalt
verknüpft.
Nach
Mt 3,7-10 par. hat der Täufer gesagt, es genüge nicht,
Kind Abrahams zu sein, um im Gericht bestehen zu können. Nach Mt 8,11 f par liegen Abraham, Isaak und Jakob beim
endzeitlichen Mahl im Reich Gottes zu Tisch, und mit ihnen viele aus den Völkern; die Erstberufenen aus Israel
sind aber vom Mahl ausgeschlossen. Laut Mt 3,9 par
macht Gott gleichsam aus Steinen Kinder Abrahams. Hier wird aufgrund der
Erfahrung des Scheiterns der Bekehrung ganz Israels zur Christusbotschaft [sic! hedenfalls
der, aus dem jeweils dafür Gehaltenen abgeleiteten, namentlich synchron
komplementär passenden, Verhaltenserwartungen
von/an Alle/n; O.G.J.] die missionarische [sic! gar jenen jpdischerseits
überhaupt nie abgesprochene ‚göttliche
Heils‘-]Zuwendung zu den Völkern
legitimiert und ihre Teilnahme am Reich Gottes begründet (auch Mt 8, 12; Lk 13,25-30).
Der
Evangelist Lukas zeichnet im Neuen Testament [sic!] das positivste Abrahamsbild.
Gottes Verheißungen an Abraham, die Väter und ihre Nachkommen beginnen sich im
Blick auf die Geburt Jesu und des Täufers zu erfüllen, und die Hoffnung
auf die endzeitliche Befreiung [sic!] Israels erwacht (Lk 1, 46-55,
68-79; 13,16). Jesus bringt den Zöllner Zachäus zur Umkehr und Liebe und schenkt ihm und
seinem Haus jene Befreiung, die den Söhnen Abrahams verheißen ist (Lk 19,9). Aber die Zugehörigkeit zu Abraham und damit zum
Bundesvolk bemißt sich nicht nur an physischen
Kriterien, entscheidend ist vielmehr das Leben nach dem Willen Gottes (Lk 3,3-14). Im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen
Lazarus (Lk 16, 19-31) wird Abraham sechsmal genannt
und es wird auf die Zugehörigkeit zu Abraham nach dem Tod verwiesen. Auch der
Reiche im Gleichnis ist ein physischer Sohn Abrahams, er hat aber die
endgültige Gemeinschaft mit Abraham durch sein Leben ohne Wohltätigkeit
verwirkt. Die Sicht des Lukas dürfte die Haltung Jesu zu Abraham widerspiegeln.
Bei
Paulus (bes. Gal 3 und Röm 4) erfolgt eine
Verschiebung der Perspektive. Er bedenkt die Figur Abrahams primär im Blick auf
die Völker und ihre Teilhabe am Heil Israels. Deshalb legt er bei Abraham alles
Gewicht auf den Gerechtigkeit bewirkenden Glauben. Die Abstammung von Abraham
verliert demgegenüber ihre Bedeutung. Wahrer Glaube erweist sich in Taten der
Liebe (Gal 5,6) und wird so an seinen Früchten sichtbar (Röm
6,22;7,4; Gal 5,22; Phil l,ll;
ähnlich Joh 8,39f). Nach Gal 3,6-14 ist in der Hebräischen Bibel (Gen 12,3; 18, 18) verheißen worden, daß Gott die Völker aufgrund des Glaubens rechtfertigen
wird bzw. daß alle Völker in Abraham gesegnet werden.
Der Segen Abrahams erreicht die Völker nicht automatisch, sondern er wird ihnen
im Glauben durch Jesus Christus erschlossen (Gal 3,6-9.14). Die Völker müssen
sich dem Gesetz, d.h. Den kommunal geprägten Zulassungsbedingungen des
jüdischen Volkes, nicht unterwerfen, da sie Jesus Christus [sic!] durch sein sühnendes [sic!] Sterben am Kreuz freigekauft [sic! Satisfaktionstheorie genügt bicht;
E.B.] hat (Gal 3,10-13; vgl. auch Gal
4,5). Um die Chance der Völker [sic!] im Zusammenhang mit Israel hervorzuheben, greift Paulus die
sich schon in Sir 44, 19 findende wertende Beobachtung auf, daß
Abrahams gläubige Vertrautheit mit Gott schon vor seiner
Beschneidung vorhanden war. Dementsprechend heißt es in Röm
4, 16; ,,Nur so bleibt die Verheißung für alle
Nachkommen gültig, nicht nur für die, welche das Gesetz haben, sondern auch für
die, welche wie Abraham den Glauben haben.“
Paradigmatik Abrahams
Auch
außerhalb der heiligen Schriften wird dem Abraham im Judentum, Christentum und
Islam ein hoher Rang zuerkannt. Seine Gastfreundschaft, seine Barmherzigkeit
gegenüber Sündern[sic!], sein Einstehen für den Monotheismus[sic!], sein
philosophisches [sic!] Können, seine Erfindergabe und sein
mystischer[sic!] Umgang mit Gott werden gerühmt (vgl. Jub, lQGenApocr, Test-Abr). Somit ist Abraham als jene religiös-archetypische
Figur zu betrachten, die an den Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam
samt deren ethischen und kulturellen Idealen steht. Alle[sic!] monotheistischen
Religionen sehen in ihm ihren beispielgebenden über der eigenen Konfession
stehenden Ahnherrn. T»
(Sp.
3 – 7; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
Akeda (selbes Basis-Lexikon, doch 3. Neuaufkage S. 7f. J.J.P.) ![]()
«Jüdische Auslegung
Während in christlichen
Bibelübersetzungen das 22. Kapitel des Buches Genesis oft mit dem Titel „Die
Opferung
Isaaks“ versehen wird, heißt dieses
Kapitel in der jüdischen Tradition„Akeda”, was „Das
Binden (des Isaaks)“ bedeutet, da nach Gen 22,9 Abraham zwar
seinen Sohn „gebunden“ auf den
Altar
legte, aber nach Gen 22,13 einen
Widder statt seines Sohnes opferte. In der
jüdischen Schrift Auslegung der
letzten
zwei Jahrtausende ist dieses
Kapitel oft
und sehr unterschiedlich
interpretiert
worden. So wird von einigen
Schriftauslegern - ähnlich wie bei Kierkegaard -
Abrahams Gehorsam betont, bei
anderen dagegen [sic!] hervorgehoben, daß Isaak
sich bei vollem Bewußtsein
seiner bevorstehenden Opferung freiwillig dem
Opfertod gestellt hat. Es gibt auch
moderne Apologeten eines „rationalen“
Judentums, die Gen 22 in der
Perspektive von Mi 6, 6-8 lesen und behaupten,
daß die „ Akeda“ als Protest gegen Menschenopfer verfaßt
worden ist.
Tiefer verwurzelt in der jüdischen
Tradition ist die Rolle, die dem Isaak bei
seinem „freiwilligen Opfergang“
zugeschrieben wird. Diese Auffassung der „Akeda” war
besonders unter den jüdischen Märtyrern des Mittelalters beliebt, die sich,
statt der christlichen
Zwangstaufe zu unterziehen, „zur
Heiligung des göttlichen Namens“ töten
ließen und auf diese Weise das
Verhalten Isaaks nachahmten. So wurde es
auch oft in der mittelalterlichen
synagogalen Dichtung dargestellt.
Akeda und Opfertod Jesu
An sich dem Wortlaut der Bibel
widersprechend, gibt es auch rabbinische
Auffassungen von der „ Akeda“, in denen der Sachverhalt so dargestellt wird ,
als ob das Opfer tatsächlich
stattgefunden hätte. Dazu kommt die weitere
Vorstellung, daß
Gott dieses Opfer
wohlgefällig aifgenommen
hat und,
dadurch veranlaßt,
Israels Sünden verzeiht und verschiedene
heilsgeschichtliche Taten vollbringt. So kann u. a.
auch das Bild von einem etwa
dreißigjährigen Isaak gezeichnet werden, der
sich freiwillig dem Opfertod
ergibt,
nachdem er das Holz, das zu diesem
Opfer benötigt wird, selbst zum Ort
seiner Hinrichtung schleppt. Es ist
klar,
daß sich diese
Darstellung der „Akeda“
in unmittelbarer Nähe zu den
christlichen Darstellungen vom Opfertod
Jesu befindet. So konnte auch
Hans-Joachim Schoeps von der „Akeda-Theologie“ des Apostels Paulus sprechen.
Dagegen hatte aber schon im
19. Jahrhundert Abraham Geiger
behauptet, daß eine derartige Auffassung
von der „Akeda“
nicht ursprünglich
jüdisch gewesen sein kann und nur
als
jüdische Reaktion auf den
christlichen
Gebrauch von Gen 22 verständlich
ist. [‚Schlimmstenfalls‘ nicht ohne Zusammenhang mit der Einsicht, dass selbst
bis gerade ‚die (wie auch immer zu vesregebde/definierte)
Wahrheit‘ geleignet werden kann, bis müsse, um im diesbezüglichen
Erpressungsfalle durch Mächtige, Menschenleben zu retten; cgl.
bis zur immerhin legendären ‚Begründung‘ der Tora-Übersetzung
ins Griechische als LXX Septuaginta pp. – ‚bestenfalls‘ als Anknüpfungspunkt
für Akzepranzvorstellungen/Tolleranz
von freiwilligen (gar Schukd-)Opfern für/durch andere
Menschen, immerhin göttlicherseits, durch Juden;
O.G.J.]
Die Frage , ob das Motiv der
„Selbstopferung Isaaks“ vom Judentum in das
Christentum übergegangen ist oder
umgekehrt, muß
offen bleiben, da, so
alt auch einige jüdische mündliche
Traditionen sein mögen, der schriftliche
Niederschlag dieser Wertung erst
Nach dem Abschluß
des neutestamentlichen Kanons zu datieren ist. Jedenfalls kann konstatiert
werden, daß es
im [sic!] Christentum und in
einigen jüdischen Kreisen parallele Ansätze zu
einer [sic! falls nicht sogar zu
verschiedenen, denn auch chrisrlicherseits werden
Bedenken laut, den Kreuzestod Jeus/Jeschuas (als solcher immerhin wesentliche
Kernbehauptung der Apostolischen Schriften) als ‚Opfertod‘ gedeutet,nicht hinreichend umfassend, bis gsr
irrig, verstanden zu haben; O.G.J. etwa mit E.B.] „Akeda-Theologie“
gegeben hat.
Holocaust und Akeda-Theologie
Aktuell ist das Thema „Akeda“ wieder
Nach dem „ Holocaust“ geworden.
Besonders unter christlichen Theologen
ist oft von der „Akeda“ (und ihrer vermeintlichen Parallele in der Passion
Christi) die Rede, wenn die
Vernichtung der europäischen Juden theologisch durchdaht
wird. Auf jüdischer
Seite steht man oft diesen
Gedankengängen mit einer gewissen Reserve gegenüber. Nach Gen 22 fand das
Opfer Isaaks nicht statt,
aber die europäischen Juden wurden tatsächlich ermordet. Selbst wenn man sich
der Interpretation anschließt, die in Isaak den
freiwillig zur Selbstopferung
bereiten
Menschen sieht,
so standen doch die
von den Nazis ermordeten Juden -
ungleich den mittelalterlichen
Märtyrern - vor keiner freien Wahl, die eine
Möglichkeit bot, dem Tode zu
entrinnen. Aber das Hauptbedenken auf jüdischer Seite besteht darin, daß durch
eine Verlagerung des „Holocaust“
auf
die theologische Ebene das Problem
der
menschlichen Verantwortung für
das
Verbrechen beiseite geschoben wird.»
Zum
Dritten/überhaupt, apropos ‚sonstige‘ Fürstlichleiten,
nicht zuletz gar unabwendlich
über gewöhlichen Raub hinausgehende soziale Machffragen politisch entscheidend. : ![]()
Ohnehin kaum eine biblische/tanachische
‚Figur‘ bis ‚Persönlichkeit‘ die nicht weitergehend verwendet wurde: Hier
interessiert (uns askeptisch)
Melchisedek König מֶלֶךְ zu Schalem שָׁלֵם.
Der
diesbezügliche Toraabschnitt der Genesis 14: 18 - 20 בראשית ist bekanntlich
knapp verdichtet.
בראשית פרק יד
Genesis Chapter 14
א. וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ-שִׁנְעָר אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם:
1. And
it came to pass in the days of Amraphel king of
Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer
king of Elam, and Tidal king of nations;
_______________________________________
… [kam
es zu Raub- und Kriegshandlungen der vebündeten
Könige, die Abram rückgänig machen zu lassen
vermochte]____________________________________________
טז. וַיָּשֶׁב אֵת כָּל-הָרְכֻשׁ וְגַם אֶת-לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב וְגַם אֶת-הַנָּשִׁים וְאֶת-הָעָם:
16.
And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and
his goods, and the women also, and the people.
_____________________________________________________________________________
יז. וַיֵּצֵא מֶלֶךְ-סְדֹם לִקְרָאתוֹ אַחֲרֵי שׁוּבוֹ מֵהַכּוֹת אֶת-כְּדָרְלָעֹמֶר וְאֶת-הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ
אֶל-עֵמֶק שָׁוֵה הוּא עֵמֶק הַמֶּלֶךְ:
17.
And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter
of Chedorlaomer, and of the kings who were with him,
at the valley of Shaveh, which is
the king's
valley.
_____________________________________________________________________________
יח. וּמַלְכִּי-צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן:
18.
And Melchizedek king of Shalem brought forth bread
and wine; and he was the priest of the Most High God.
/wumakij-tsedek melech schalem howtsij lechem wajajin wehu chohen leel
eljon/
_____________________________________________________________________________
יט. וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ:
19.
And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor
of heaven and earth;
/wajwarchehu wajomar baruch awram
leel elijon koneh schamajim waarets/
_____________________________________________________________________________
כ. וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר-מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן-לוֹ מַעֲשֵׂר מִכֹּל:
20.
And blessed be God the Most High, who has delivered your enemies into your
hand. And he gave him a tenth of all.
/wuwaruch el eljon ascher –migen tsarejach
bejadecha wajiten-lo maser mikol/
Und wer gab wem ein Zehntel von all( d)em?
_____________________________________________________________________________
כא. וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ-סְדֹם אֶל-אַבְרָם תֶּן-לִי הַנֶּפֶשׁ וְהָרְכֻשׁ קַח-לָךְ:
21.
And the king of Sodom said to Abram, Give me the persons, and take the goods
for yourself.
_____________________________________________________________________________
כב. וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל-מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל-יְהוָֹה אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ:
22.
And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand to the Lord, the
Most High God, the possessor of heaven and earth,
_____________________________________________________________________________
כג. אִם-מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ-נַעַל וְאִם-אֶקַּח מִכָּל-אֲשֶׁר-לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת-
אַבְרָם:
23. That I will not
take from a thread to a sandal
strap, and that I will not take any thing that
is yours, lest you should say,
I have made Abram rich;
_____________________________________________________________________________
כד. בִּלְעָדַי רַק אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים וְחֵלֶק הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא
הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם:
24. Save only that which the
young men have eaten, and
the share of the men
who went with me, Aner,
Eshkol, and Mamre; let them take
their share.
_____________________________________________________________________________
בראשית פרק טו
Genesis Chapter 15
א. אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה דְבַר-יְהוָֹה אֶל-אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה לֵאמֹר אַל-תִּירָא אַבְרָם אָנֹכִי
מָגֵן לָךְ שְׂכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד:
1.
After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear
not, Abram; I am your shield, and your reward will be great.
…
|
[An, respektive unter oder
in, Kuppeln von San
Marco zu Venedig musifisch (anstatt |
|
[In einem wörtlichen Sinne (nach / von Genesis 2:25 בראשית her) eine, durchaus lückenlose
Fortsetzung des Textverlaufes des ersten Mosebuches
der תורה] |
|
Da, bis warum oder wie auch immer, diese bildliche respektive textliche ‚Darstellung‘ hier aufzuhören scheint / auf der ‚nächsten‘ site weitergeht, braucht sich ja niemand an eigener (‚Lektüre‘- bis etwa Denk-)Fortsetzung hindern zu lassen. – Dieser Text mag den heiligen G’ttesnamen enthalten, wir bitten um Beachtung. |
|
|
Dogaressa und ‚zofende‘ Edelhofdame
‚sto(o/)l/pern‘ sie –
etwa über (Rand-) Schwelle hinaus, äh
– hinein? |
Hoppela –
bei so manchen Gedanken liegt es wohl nicht entscheidend an der – kaum bestritten – schweren Lesbarkeit von
O.G.J.‘s (gleich gar Online-)Texten,
diese lieber, besser erst überhaupt nicht ins/unters
Heiligtum lassen zu s/wollen
(erst recht falls, oder wo, sie
bereits resch-waw-chet ר־ו־ח / vorhanden). |
Der vergleichsweise neue, gar entscheidend (indoeuropäisch / japhetisch) von griechischen und lateinischen Denkformen
geprägte/definierte
Aus- und Eindruck ![]() Monotheismus
wird eher manchen Erwartungen an den, und Vorstellungen von deren Singular-Ansichten,
gerecht – als etwa all jenen Menschen (deren Figurationen, wie etwa
‚Religionen‘ / ‚Sprachen‘ etc.), die damit kategorisiert werden sollen, bis
sogar/durchaus wollen.
Monotheismus
wird eher manchen Erwartungen an den, und Vorstellungen von deren Singular-Ansichten,
gerecht – als etwa all jenen Menschen (deren Figurationen, wie etwa
‚Religionen‘ / ‚Sprachen‘ etc.), die damit kategorisiert werden sollen, bis
sogar/durchaus wollen.  Vergrößerte Ausdauer bis Rewichweite manches
Beobachtens. [Die gleich gar ‚real
existierenden Montheismen‘ – ups plural zumindest in Unterschieden von Idealen /
Widerspruch zu
Denkerfordernissen – אחד׀ת zu verstehen
/ über-setzen]
Vergrößerte Ausdauer bis Rewichweite manches
Beobachtens. [Die gleich gar ‚real
existierenden Montheismen‘ – ups plural zumindest in Unterschieden von Idealen /
Widerspruch zu
Denkerfordernissen – אחד׀ת zu verstehen
/ über-setzen]
Doch sogar/auch denkerische Bedeutungen und Reichweiten – namentlich des, vom semitischen א־ח־ד alef-chet-dalet/f,
EINEN, respektive
schon der/von (eher schrägstrichartig verbundenen, statt auflösenden) EINHEITskonzeption
des und\aber/oder-waw װ(-Hakens) – sind/werden vom/im
‚Monotheismus‘-Begriff (und seinen
philosophischen/theologischen Verwandten wie ‚ monolatrisch[e Offenbarung]‘) zu engführend, bis einseitig einiges übersehend,
ja unvollständig/verfehlend, repräsentiert/übersetzt.
 [Verdachtsmomente dualistischer Klarheitenüberziehungen als(zu absolut-zwingend
erwarteter ‚falsch gegen richtig‘ Konfrontation/Summenverteilung lassen grüßen]
[Verdachtsmomente dualistischer Klarheitenüberziehungen als(zu absolut-zwingend
erwarteter ‚falsch gegen richtig‘ Konfrontation/Summenverteilung lassen grüßen]
Na klar, wird sich so
etwas/ein Ausdruck, bis דבר /dawar/, wie der / für den
neuzeitliche/n ‚Pluralismus‘-Begriff
eben so wenig – in der ‚Bibel‘ – finden lassen, wie, diese
Bezeichnung des Buches (der Bücher[rollen]) selbst, genau so auch nicht im Tanach/Text geschrieben
steht (‚Bücher‘, ‚Tora‘
etc. hingegen durchaus wiederholt, auch selbstbezüglich). Freilich ermächtigt(sic!) und befähigt der G’tt (Terachs) Abra(ha)ms (Isaaks und Jakobs), der sich (noch später auch) Mosche und ‚ganz Jisrael‘, paradox genug, zugleich als ‚Befreier (aus/von überwältigender Herrschaft/Sklavereien) und (erwählbarer,
anstatt etwa ‚zwangsläufiger‘) Herrscher‘, vorstellt/erschließt,
dazu: ‚(überhaupt) keine (anderen) Götter neben ihm, haben/(be)dienen zu
müssen‘. Als ‚Belegstellen‘
wider deren existenzielle Vorfindlichkeit(svorstellungen) eignen sich Exodus/schemot 20:2 und Parallelen ja ohnehin kaum besser, als
zu – ihrerseits ebenfalls
zumindest prekären (soweit nicht
gefährlichen: ‚Ist Dein/Euer Schwurgott/Wert[e]system stärker als …? -Konfronta- äh Konstellationen) – Machtunterschiedserwartungen, oder (über)himmlischer Rangunterschiede (zumal ‚auf Erden‘ erwarteten/reklamierten). Heftiger (auch als schon לא
‚Befähigungen zu‘ anstelle von ‚gebietenden Zwängen‘) die beiden Schriftstellen in Bereschit/der
Genesis wo G‘tt ausdrücklich im uns-Plural
(gar eher ‚pluralis drei und mehr‘ denn nur ‚pluralis majestatis‘?), wenn
auch/zumal verbal singulär handelnd, sowohl / überhaupt Menschen/heit zu machen,
als auch (nach/wegen/wider noachidischer
Erneuerung und Turmbauversuch/en,
ausgerechnet/prompt) deren ‚Sprache‘, Denkweise/n und Behavioreme bis ‚Kulturen‘, zu vervielfältigen/‚verwirren‘,
Ethnien respektive (über, bis) die Erde zu verteilen, … Zwei
Textstellen an denen, zumal hellenistisch
denkende, Juden (namentlich einander,
inzwischen/nachapstolisch seit ‚dem christlichen
Mittelalter‘) intensiv, bis gemeinwesenkonstitutiev,
vor /schittuf/-Gefahren
der ‚Vermischung/Verbindung‘, zumal mit Vorstellungen/Lehren warnen, ‚Gott habe
dabei (ohne Menschen) Gefährten /
Beisitzer / Begleiter gehabt, oder sogar (Ruhm teilend Hilfe) benötigt‘ (der tanachische
Text belegt allerdings Anwesenheit von
‚Gottes Windbrausen‘ רוח /ruach/, bis gar
explizites Hervorbingen durch die / seitens der Erde, auch Erschaffung des ‚Heeres der Himmel‘ [nicht
etwa durch dieses selbst] pp.). Und\Aber wobei, bis wovon dennoch, sowohl das häufige ‚biblische‘
Wortfeld אלוהים /‘elohim/, als
auch sogar (der/die/)das (geradezu Bekenntnis-)konstitutive אחד /‘echad/ (oder gar inklusive /‘axat/
- gar eher unidentisch mit יחיד /jaxid/) in/aus der Selbsterschließungsformulierung Adonais, grammatikalisch Plural – und manche (zumal singuläre Gewissheiten), so manches Mal (nicht
etwa allein in/an der ‚Liturgie‘ des Yom Kipur), durchaus entsprechend
verstörend – bleiben. – Die
Apostolischen Schriften stehen ja nicht allein wegen
der vielen Wohnungen (ausgerechnet
‚griechisch‘) in / (immerhin) aus Johannes 14:2 (zumal als
menschenseitiger Vielheiten Vielzahlenaspekt deutbar/passend) ohnehin eher unter ‚Pluralitäten‘- äh
‚Beisassen‘-Verdacht.  [‚Mit G-tt
zurande zu kommen‘ geht onehin nicht, mit nenschenverständlichen,
einander also
ausschließenden/widersprechenden, Denkweisen/Sprachformen
schon eher]
[‚Mit G-tt
zurande zu kommen‘ geht onehin nicht, mit nenschenverständlichen,
einander also
ausschließenden/widersprechenden, Denkweisen/Sprachformen
schon eher]
Zu den, auch tanachischen, weiter
vorherrschenden, bereits (indoeuropäisch) logisch konsequenten Hauptschwierigkeiten derartiger Denkansätze gehört eben: Dass
wenn/da mein Gott der allerhöchste und/oder allermächtig(st)e
wäre, jene/r aller anderen, ein und derselbe sein müsste, um nicht – was jetzt eigentlich: ‚stärker oder schwächer‘? – heraus findbar, äh beweispflichtig,
zu erscheinen; – was ja manche
Leute, mit dem (inhärenten) Gewalt-Vorwurf meinen mögen, die (dann) aber dem indoeuropäischen
Denken/Entdecken und (inflationär vergottenden) Verwenden des/vom/im Singular/s überhaupt gelten müss(t)en; ohne damit/so die zwischenmenschlichen, bis zwischenethnischen, Gewalttätigkeiten, etwa in
Ostasien, befriedigend erklären
zu können/müssen. (ob)wo(hl/da die(se ‚westlich/abendländische‘) Rechthaberei, dort grammatisch unausdrückbar
/ denkerisch unfasslich nicht empfunden / verstehend nachvollzogen werden
könne.
Eher noch heftiger die ‚Wahl‘-Fragen,
namentlich als ‚Erwählung‘ durch/von G’tt (bis sogar/gerade welches/wen sich wer zu/als seinem/n
Allerhöchsten[-Schwurbezug] erwählt). Zumal was
zwischenmenschliche Beziehungsrelationen angeht, erweisen sich Wahlen nämlich
stets als auch wechselseitige Akte, was gerade nicht bedeutet, dass diese nicht
asymmetrisch sein/werden
können, und gleich gar nicht, dass es keine Ablehnungsmöglichkeiten
einer (oder mancher) Wahl geben würde/dürfe/könne. Gerade der G’tt Abrahams, bis Israels
(und solchen Bündnissen /beritot/ בריתות betretender Menschen), widerspricht nämlich
durchaus auch der (mythologisch gängigen /
grundstrukturellen) Erwartung, ‚seine Berufungen/Wahlen
überhaupt nicht ablehnen zu können, dies jedenfalls nicht zu dürfen‘, trotz
oder gerade wegen all der (zumal
negativen) Folgen die dies durchaus haben
kann, bis nicht selten vielfach und vielfältig hat/te
– scheint Gott weder seine
Wahl/en zurückgenommen (wobei G’ttes
Reue erhebliche Folgen bis eben hin zu solch Bundesvertraglichen Verhältnissen
grundlegend mit/nach Noach und
erneuernd/fortschreibe4nd seither), noch keine
anderen Person, bis sonstige Wege, als (wie auch immer
genannte) ernsthaft (zwar
loyaler, doch opoositioneller) Freiheits-Vernichtung/en, ‚gefunden werden zu haben‘. Nicht einmal, respektive
gerade, seine Tora woll(t)en
die Menschen / Völker (zumal
‚inhaltlich‘) nicht haben - bis
schließlich auf … (vgl. etwa Midrasch Pesikta Rabbati 21).
 ‚Echter‘, körperlich tiefer Hofknicks sogar einer (immerhin
gespielten) Königin zu Venedig. [Hier
zwar/zumal mit ihrem (immerhin/wenigstens
unterstellbarem) Einverständnis, und im beruflich-künstlerischen (also besonders
beargwöhnten/verdächtigten)
Auftrag/Aussehen, allerdings/sogar ‚dem/ihrem Publikum‘ –
Gemein- bis Staatswesen und oder als deren Repräsentationsperson/en (kaum
nachstehend) – vor- bis zugeführte Schauspielerin
/ Schönheit / Weiblichkeit bei Reverenz gegenüber dem sie inszenierenden Herrn]
Genuflection of beuty.
‚Echter‘, körperlich tiefer Hofknicks sogar einer (immerhin
gespielten) Königin zu Venedig. [Hier
zwar/zumal mit ihrem (immerhin/wenigstens
unterstellbarem) Einverständnis, und im beruflich-künstlerischen (also besonders
beargwöhnten/verdächtigten)
Auftrag/Aussehen, allerdings/sogar ‚dem/ihrem Publikum‘ –
Gemein- bis Staatswesen und oder als deren Repräsentationsperson/en (kaum
nachstehend) – vor- bis zugeführte Schauspielerin
/ Schönheit / Weiblichkeit bei Reverenz gegenüber dem sie inszenierenden Herrn]
Genuflection of beuty. 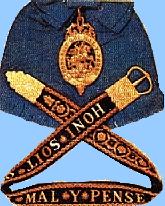
Zudem zeichnet die Tora/‚Bibel‘, gerade
Abraham, Protpyp gottgefälligen Vertrauens/Glaubens,
auch dadurch ‚aus‘ / so, dass er sich erlaubte mit G’tt
zu (ver)handeln (sogar ‚nach-zu-verschlechtern‘ – jedenfalls bei/um Lot’s zeitweilige/r Wohnstadt), aber auch – etwa wiederholt/erneut
Pharaonen gegenüber ‚dietrologisch‘ / mistrausch / vorurteilsgemäß (immerhin seiner Schwester und/aber Gattin Sara’s Identität
verschleiernd, bis diese Fürstin für Ägyptens Herrscher verfügbar; und
schließlich ihre zofende
Edelmagd zuerst, aus Altersgründen biologisch
wahrscheinlich(er gewesen), zur Mutter, und dann
Übelstes mit Hagar und Ismael, machend)
– nicht zu erwarten, dass sich (auch) andere, gar besonders mächtige, Menschen gottesfürchtig verhalten,
indem sie Noachs
basalen Bundesvertrag einhalten wollen
(und dies ermöglicht bekommen).  [Wie (äußerlich)
tiefe, und welch (‚innerlich‘)
ernsthaftest( bemüht)e/überzeugte, Verbeugungsreverenzen das (seinerseits eben/immerhin/schon) Fürstenpaar sowohl dem
jeweiligen Pharao der Groeßerenmacht und den
Priesterkönig Melcisedek (besuchend
bis zu-Diensten), als auch ihren Besuchern /
Freunden / Gästen (##inklusive G’tt[esboten#hierverslink]
in Menschengesalt ‚auf Erden‘ – respektive,
oder sei es gerade/spätestens, deswegen) erwiesen hat (sic!) –
ist/sei im Altertum,
zu biblischen Zeiten der Tora (gar noch bis
zum Ende des Äthiopischen Kaiserreichs im 20. Jahrhundert exemplarisch
belegt/überboten) nicht nur sittlich üblich
(gewesen) – somder
dabei und dafür (ihrer ehrfurchts-Handhabungung[sform]en[ / Würdebewahrungs-Früchte]
wegen-?) hätten/haben
sie einander/sich auch nicht etwa (manch manch heutigen Vorstellungen
ähnlich/verdächtig: vgl. R.Ch.Sch.)
beschämt/geschämt]
[Wie (äußerlich)
tiefe, und welch (‚innerlich‘)
ernsthaftest( bemüht)e/überzeugte, Verbeugungsreverenzen das (seinerseits eben/immerhin/schon) Fürstenpaar sowohl dem
jeweiligen Pharao der Groeßerenmacht und den
Priesterkönig Melcisedek (besuchend
bis zu-Diensten), als auch ihren Besuchern /
Freunden / Gästen (##inklusive G’tt[esboten#hierverslink]
in Menschengesalt ‚auf Erden‘ – respektive,
oder sei es gerade/spätestens, deswegen) erwiesen hat (sic!) –
ist/sei im Altertum,
zu biblischen Zeiten der Tora (gar noch bis
zum Ende des Äthiopischen Kaiserreichs im 20. Jahrhundert exemplarisch
belegt/überboten) nicht nur sittlich üblich
(gewesen) – somder
dabei und dafür (ihrer ehrfurchts-Handhabungung[sform]en[ / Würdebewahrungs-Früchte]
wegen-?) hätten/haben
sie einander/sich auch nicht etwa (manch manch heutigen Vorstellungen
ähnlich/verdächtig: vgl. R.Ch.Sch.)
beschämt/geschämt] 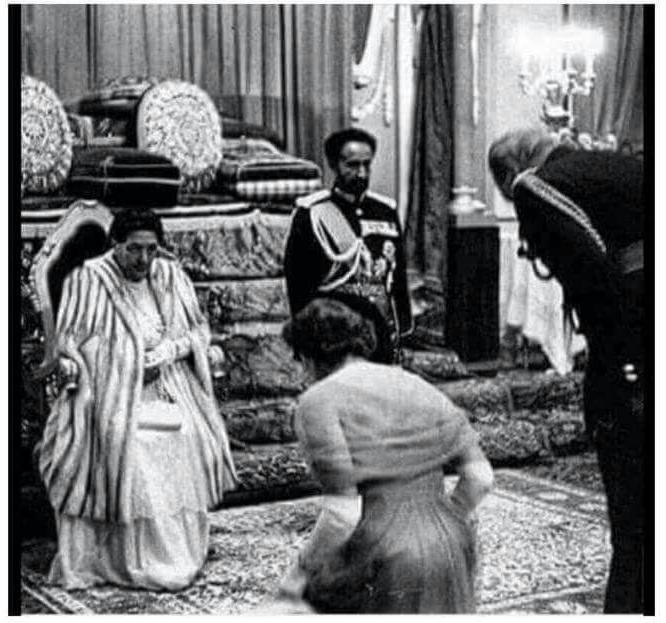
Gerade solch wichtige, verhaltensfaktisch durchaus zwischen/für
‚schwarz(e) oder weiß(e Dame verschieden, chet-spannungsreich
bis widersprüchlich)‘, über, wieweit und zwischen, ‚richtig, falsch oder diesbezüglich so nicht‘,
also Ziel(erreichungs-
und -qualitäts)fragen (eben nicht allein solche der Überzeugungen, gleich gar von
Sätzen/Sachverhalten) entscheidende, ‚inhaltlich‘ zu
nennende Aspekte der Beziehungsrelation/en bleiben jedoch ‚sekundär‘ hinter
deren (deswegen ja gleichwohl davon nicht etwa unabhänigen
/ abzutrennenden / zusammenhanglosen – doch eben manchmal geradezu
‚kontrafaktischen‘, gar auch im Widerspruchssinne ‚oppositionellen‘) Loyalitätsfragen (der/an/nach durch Weisheit galifizierten
Glauben) zurück: Beziehungsrelatonenen
(gleich gar zwischen Subjekten) sind/werden nicht mit Verhalten (nicht
einmal mit deren gemeinsamen / gar daraus resultierenden) identisch/selbig. 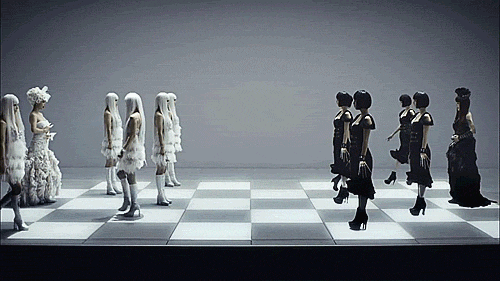 Auch
dass/falls/wie die Fortschritte/Änderungen für und von Heute das/diese
Problem/e von Morgen (erst) ermöglichen darf,, kann und wird Wandel nicht verhindern. [‚Askese versus Libertinismus‘-Maßurteile sind eben nicht
alleine/erst ‚ein Luxusproblem‘ gnostischer Grundlagen(irrtümmer)]
Auch
dass/falls/wie die Fortschritte/Änderungen für und von Heute das/diese
Problem/e von Morgen (erst) ermöglichen darf,, kann und wird Wandel nicht verhindern. [‚Askese versus Libertinismus‘-Maßurteile sind eben nicht
alleine/erst ‚ein Luxusproblem‘ gnostischer Grundlagen(irrtümmer)]

|
[Ach Bitte/n – Opferangelegenheiten und
Opferungen, bis Verzweckung/en, gerade auch aus/in Zusammenhängen
mit den ‚Erzmütteren und Gründungsvätern‘ /
‚Generationen‘ verhaltensrelevant
(alef-mem-nun+he)
qualifizierter Glaubens(beziehungsrelationen) /
Bundesverträgen unter/von/zu ‚dem Einen‘ ECHaD/ACHaT
G’tt/ HaSCHeM\‚vielerlei
Namens‘ japhetisch,
jedenfalls griechisch singularisiert/später, ‚Monotheismus‘ genannt: Terach – Abra(ha)m – Ismael
/ Isaak – Jakob (Israel) plus einige/r Leute mehr heftig und wichtig] |
Wie bitte – zum, wenn
auch unterschiedlichen, doch gleich heftigen, Entsetzen gar aller ‚Töchter Jerusalems‘ – entblößt
der Text-תורה nicht allein, dass unser Vater Abraham, zwar seinen zweiten Sohn dafür vorbereitend ‚gebunden hat‘,
aber eben nicht opferte (wie
bestimmte Bibelüberschriften irrend/medial,
bis interessiert, titeln): während er seinen
erstgeborenen – und zwar
zusammen mit dessen Mutter Hagar,
der (selbst diesbezüglich) fügsamen/gezwungenen
Edelmagd
(bis sklavische ‚Ammen-Überbietung‘) Sahras, gar ägyptische
Prinzessin,– zum Streben(srisiko)
in die Wüste schickte/zwung: So dass diese beiden wundersam (durch
Gottes Tiere) gerettet
werden konnten/mussten. Sondern auch
die, ja von Aposteln
durchaus, gar satisfaktionstheologisch
(gerecht), geäußerte, Deutung des Todes Jeschuas / Jesu – als Ereignis
bekanntlich die am besten belegte Aussage der apostolischen Schriften überhaupt – als/zum Opfertod (gar daher/dazu ‚Christus/Erlöser‘
genannt / bekenntnisrelevant) reicht – gleich gar endgültig vollzogene / vollkomme Aufhebung /
Erfüllung / Beendigung jedes Menschenopfers – (bestenfalls) zu kurz. |
Die zumal christlicherseits bis
emblematisch/hyperreal als (geplante/vorzeichenhafte) Opferung Isaaks bekannt
gewordene Bindung und Schlachtungsbereitschaft durch Abraham (wider sich selbst maximiert – zumal da ‚in höherem Auftrag / auf
allerhöchsten Befehl‘: sind auch/sogar diesmal gegenwärtige Mord-Kriterien
nicht erfüllt); wird von
desselben Vaters und Fürsten (vielen
[fehlenden; vgl. etwa nit bis wider Ba.Br.]
Erwähnungen / Hinweisen nach, anscheinend
eher un)bekanntliche, vorhergende Vertreibung Hagars und Ismaels in die
tödliche Wüste gar eher noch überboten (zwar
aus ‚niederen Beweggründen‘ seitens der eifernden/verspottezen
Fürstin Sarah – zunächst ebenfalls gegen abrahams
Willen, doch mit g’ttlicher Zustimmung, und, doch
unzureichender, Bevorratend ausgerüstet) –
deren Tod/Tötung ebenfalls (bereits)
durch G’ttes Eingreifen verhindert wurde –
eben ohne Abrahams/Ibrahims – zugleich [teils/ja] durchaus
lobend/vorbildlich athestiertes – Verhalten ((zumal
nahen Angehörigen / Schutzbegohlenen gegenüber) zu
ändern oder zu löschen (der sich durchaus
ohnehin in der [‚manchenteils‘ besonders strittig ‚vergleichsweise‘ kontrastiert
werdenden] wichtigen
Reihe ethisch-moralisch
versagt-habender ‚biblischer Gestalten‘, ‚Person[ifikation]en‘
seit Adam von Isch
und Ischa ups,
die – allenfalls bis auf weniege ausdrückliche
Ausnahmen wie [den ‚entrückten/unverstorbenen‘] Henoch und Elia, so änlich wie
der [sterbliche] Nochchide / Nichtchrist / Nichtjude
/ Nichtmuslim Hiob,
oder ähnlich, anstatt uniwok, apostolisch der Jude / G‘ttesknecht Jeschua – auch und obwohl g’ttesfürchtig, bis ‚dessen ‚Herzen nahe/entsprechend‘, der [gar gegenwärtigen,
äh ‚innerraumzeitlich‘/zwischenmenschlich,
zumal einseitig, verweigerbaren]
Vergebung bedürfen /bis\ fähig). Was mit Fürstin
Sara und Prinzessin/Sklavin Hagar … Sie
wissen ohnehin schon. |
|
|
Kommentare und Anregungen sind willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu |
||
|
|
|
||
|
|
|
by
|