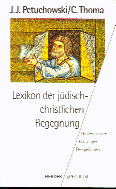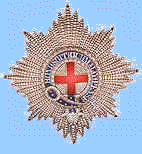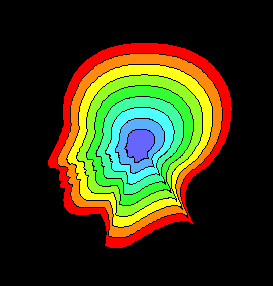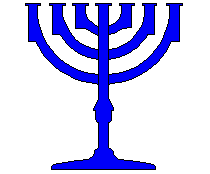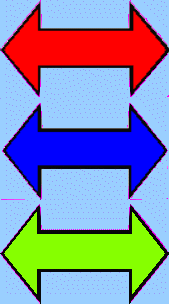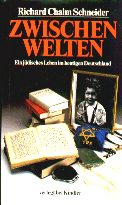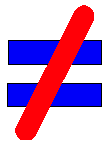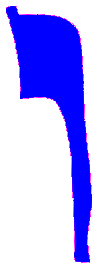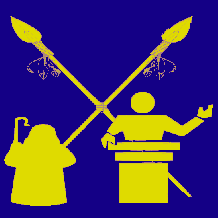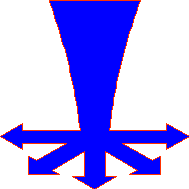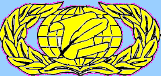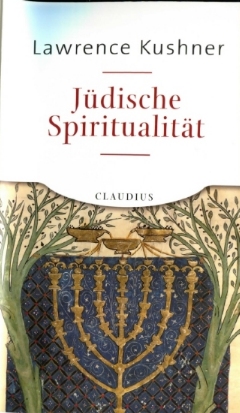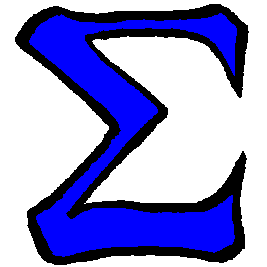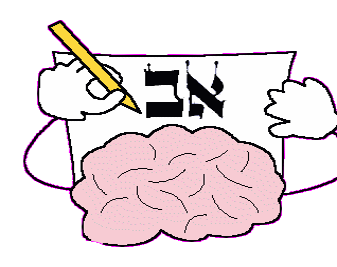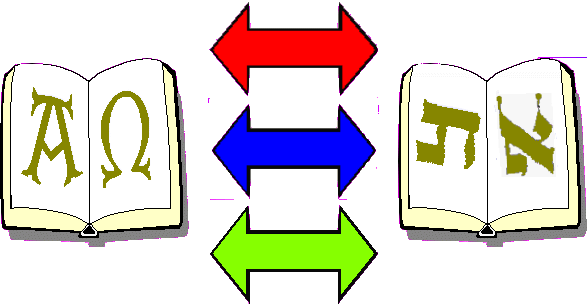![]()
![]() Sollte
Ihr Monitor bzw. Browser (nebenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft
darstellen - können Sie hier mehr darüber finden.
Sollte
Ihr Monitor bzw. Browser (nebenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft
darstellen - können Sie hier mehr darüber finden.
|
Hebräer / iwriim / (J)Israel Hellenen / Griechen / Gojim |
|
|
Der sebr alte, basale
Kampf um/gegen, zumal
existenziell-verbindende,
Selbst-Verständlichkeiten,
insbesondere Ungleichheiten zwischen sozial figurierten
Ethnien (GoJiM גויימ versus ישראל JiSRaEL)
beziehungsweise 'kultureller',
bis zivilisatorischer, Anderheiten,
ist und wird gerade hier – ob nun eher
prototypisch oder einzigartig - scharf zugespitzt, in/zu, so
häufig aufgerichteten dichotom maximal klaren .entweder schwarz oder aber weiß . Kontrasten |
|
|
Den andragogisch-didaktischen Widerspruch/Konflikt, der - gar engstirnigen - Dummheit, wie
der – zumal hinterhältigen -
Absicht Böswilliger, bis Wohlmeinender, zwar keine (weitere) Munition liefern zu s/wollen,
dies aber - selbst durch noch so
gut widerlegte Darstellung/Aufklärung falscher Thesen. Mythen und Strategien - dennoch zu
riskieren, vermögen wir hier
nicht aufzuheben.
Es ist auch kein Trost, dass / wo es unseren, weit kompetenteren und
erfahrenen. womöglichen
Vorbildern, etwa der 'Antisemitismus'-Forschung, nicht viel
besser ergeht; und auch Sie
sich am liebsten / eigentlich
gar nicht mit dem Gegenstand / Thema der Judendiskriminierungen
befassen würden.. |
|
|
«Spaß beiseite, aber kein Zweifel: Das uralte Problem der Judenfeindschaft ist auch heute nach wie vor aktuell.» |
«"Kennen Sie den? Ein armer Jude kommt am Hauptbahnhof an, sein ganzes Hab und Gut in zwei alten, abgewetzten Koffern. Er geht auf einen älteren Mann zu, der in der Bahnhofshalle die Fahrpläne studiert, und fragt ihn: Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, sind Sie ein Antisemit?' Der Mann kann sich vor Empörung nicht fassen. 'Was fällt Ihnen ein, werden Sie nicht unverschämt!' - 'Nichts für ungut', sagt der Jude, 'entschuldigen Sie bitte vielmals', geht ein paar Schritte weiter und spricht eine Frau an. 'Sind Sie vielleicht Antisemitin?' - Dieselbe Reaktion. Das Spiel wiederholt sich mehrmals. Schließlich gerät der Jude an ein Ehepaar. 'Pardon, sind Sie vielleicht Antisemiten?' - 'Jawohl', antwortet der Mann, 'wir können die Juden nicht ausstehen, dieses widerliche Pack!' -'Schön, Sie sind ehrliche Menschen, können Sie bitte einen Moment auf meine Koffer aufpassen?' - Ich würde gerne einen anderen Versuch unternehmen", so Henryk M. Broder, aber: "Ich bin sicher, niemand würde sich melden. Genausogut könnte ich fragen, wer seine Frau betrügt oder seine Kinder prügelt." (H.M. Broder 1986a) – Nebbich.» [E.R.W. S. 12; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] |
|
|
Zunächst, bis scheimbar anschedinend: Hellenismus im ptolemäischen Ägypten und griechische Denkformen in Jisrael, zumal - doch weder 'nur' noch 'erst' - unterm Imperium Romanum: (längst nicht die erste derart existenzielle Begegnug / Vergegung für und mit Juden, doch betreffen diese 'Übersetzungen' – ihrer Botschaftsinhalte - und Chanukka - selbst der 'Leuchter' – der/zur 'bürgerlichen' Zeitenwende auch heute haggadische / narrative Horizonte) – mit/als (auch 'innerjüdisches' und 'innerchristliches' zumal 'universalistisches', bis 'ein- ausschließendes'), Konflikt(e)syndrom: |
|
Immerhin und ausgerechnet reichen/weisen sprachliche Formen / grammatische Zähloptionen (wie Kollektiveinzahlen und Einzahlvielheiten pp,) offenen semitischen Denkens / Ausdrückens sogar über den engsten indoeuropäischen Vorstellungshorizont der und von (zumal mit Monotheismus verwechselter / gleichgesetzter) Singularität hinaus. |
|
Die richtige Reihenfolge Heiliger Bücher entspricht nicht etwa notwendigerweise allein zeitlicher Chronologie (namentlich darin erwähnter Wesen respektive Ereignisse), sondern auch nach dieser Schrift(gattung)en Verbindlichkeit, in einer/ihrer Bedeutugsrangfolge geschreiben stehen. So ordnet rabbinisches Judentum die Prophetenbücher (heb.: Nevi'im) kanonisch früher/wichtiger ein, als im griechischen Denken – namentlich 'vom/fürs Christentum' - vorgezogene historische Bücher (gr. Hagiographen) der Hebräischen Bibel. |
||||||
|
Daher endet die Tanach/Tenach mit dem 2. Buch die Chronik Kapitel 36, Vers 23, in dem immerhin Jisrael ermutigt wird, nach Jerusalem hinaufzuziehen, um das Haus G-ttes (für alle Ethnien/Menschen) wieder aufzubauen. Und eben (erneut, wie schon 'das' fünf - bis sogar sieben (vgl. vor, nach und Num. 10: 35 - 36) - 'Buch' der תורה Tora i.e.S.) mit/in einem lernenden למד lamed als 'letztem' Zeichen/ל auf. Sprachliche Anmerkung einer Hebraistin, wie deutungsbedürftig der Eigenname des Zeichens endet – überflüssig? |
Das dort sogenannte 'Alte Testament'
gemäß christlicher Reihenfolge endet dagegen (mit mm
ם) in Maleachi 3, Vers 24, mit der Androhung
eines Bannfluches. - Gar «ein Schelm, wer etwas Arges dabei denkt»? |
|||||
|
Überhaupt 'trennen' gerade ihre gemeinsamen Grundlagentexte Ekklesia und Synagoge kaum weniger als 'sie' Beit-Knesset und Beit-Jirea 'zu verbinden vermögen'. Darauf – auf die selben 'Offenbarung' und/oder identisch erscheide. bis seiende, Vernunft(en) – abzustützen versuchte Konfrontationen sind/werden besonders heftig, nachdrücklich und dauerhaft (namentlich weitaus mehr und tiefer, als andere, die übrigen - inner- und zwischen ethnischen bzw. persönlichen – Feindschaften). - Gerade die Auseinandersetzungen zwischen semitischen Ethnien (innerhalb der Meschpoke / Familie / Sprachgruppe versteht/verständigt man[n]/frau sich ja keineswegs immer nur friedlich) bleiben deutlich hinter der Verbitterung / Frage zurück: |
||||||
|
Wie, was (unter, welcher) ToRaH äøåú – gleich gar deren 'Erfüllung / Mündlichkeit, äh Tötigkeit' - (zu verstehen) ist? |
||||||
|
Juden wissen und reden von etlichen, in der Tora (bis im Sinne von Tanach) erwähnten, Bündnissen, zumal G''ttes – darunter erneuerbare, bis erneuerte, gar unkündbare, sowie neue (gar geradezu individuell passend 'geschnittene') sowie Kernelemnete zwischenmenschlicher / gesellschaftlicher Rechtsnormen - und zwar längst nicht etwa nur, und auch nicht chronologisch zuerst, mit Juden als Gegenüber/n (wo die Vereinbarungen zumindest dazu neigen, die mit schwereren/einschränkenderen Verpflichtungen zu sein – diese Verträge sind jedenfalls weder notwendigerweise wichtiger, noch besser als jene mit/unter Menschenheit oder den jeweiligen Nichtjuden). |
Im (antiken, gar vasallenvertraglichen Uterwerfungs-)Denken, ja in der Überzeugtheit, vieler, zumal führender, Christen, geht/ging es dabei – bei der ganzen Bibel überhaupt – um, auf höchstens zwei reduzierte, wie auch immer aufgeteilte (und zudem vom/zum 'alten' Überlieferungsbestand, respektive dessen rabbinischen Auslegungen, kpntrastierte) 'Bünde', die beide gerne als Testamente bezeichet/verstanden werden (wobei wohl weder Gott der dauerhaft verstorbene Erblasser sein darf/soll, noch die überlieferten Übersetzungsirrtümmer tragen müssen). |
|||||
Recht unterschiedliche Messiasvorstellungen, bis Erlösungskonzeptionen (die immerhin/aber weitgegend gemeinsam haben, dass deutlich erkennbare Unterschiede zwischen der vor und der nach dem Eingreiffen G'ttes vorfindlichen Weltwirklichkeiten für/von allen offen erkenbar zeigen) versus Christologie/n zu denen insbesondere – und ausschließlich in (zunächst schlechtes) Altgriechisch 'übersetzt' überlieferte – Aussagen des Apostels Paulus gedeutet/ausgelegt und 'dem (sich entwickelnden/findenden/durchsetzenden rabbinischen) Judentum' maximalkontrastiert entgegen gestellt wurden/werden:
Dabei geht es weder um die
Streichung von Kreuzestod und/oder Auferstehung (dieses
bis der Toten), noch um die faktische Bestreitung, dieser, immerhin am
weitaus besten bezeugten, Aussagen der (auch als
'Neues Zrstament' bezeichneten) Apostolischen
Schriften übergaupt - sonderen zentral sehrwohl (jedenfalls
was gerade zwischen den Evangelisten divergierende Prozessmotive, die
diesbezügliche Rechts- und Machtlage in der römischen Provinz Judäa, textliche
und gleich gar sonstige bildliche Hinrichtungsabbildungen und zumal Person und
Topoi des Judas
Ischariot angeht – schließlich erscheint der Auferstandene 'den Zwölfen
leibhaftig/verklärt', bevor der vorgebliche 'Ersatzapostel' Mathias erst 40
Tage nach der Auferstehung berufen wurde) bereits/gerade um deren
darstellende Schilderunge/en (wo immerhin und
huptsächlich Juden inzwischen heraus gearbeitet haben, wie wenig judenfeindlich
eine Mehrzahl – eben nicht jeder - der apostolischen Texte ist; zumal
falls/wo insbesondere Evangelien – gar wieder - in den
hebräisch-aramenischen – oh Schreck - Diskussionskontext, nicht
einmal nur/immerhin der Zeitgenossen, 'zurückübersetzt'/gebracht
werden; vgl. Jerusalem School for
Synoptic Research et al.) und gar noch entscheidender um deren
deutende Interpretationen/Verständnisse, bis theologisch-argumentative
und liturgische Verwendungen (also eben weder
notwendigerweise noch erst mit den zumindest logisch wichtigen
Argumenten/Denkformeln des Romans von Walter Jens – insbesondere, dass im
Sündenbock-/Opfertodfalle jZielverfehlungen er 'bezahlte' ursächlich und
verantwirtlich wären). 
|
Träger, namentlich, äh na klar Empfagende, der Heils-Verheissung G-ttes, seieb/sind nämlich (doch nur und immer – vgl. Max Weber's 'Heilsgüterverwaltung' durch/in Hirokratien) wir. Doch unheimlich dabei/daran: Welche, äh auf welcher, Seite werden wir gewesen sein? – Subsitutionstheologien und Ablösungstheorien Israels. |
Welch unerträglicher Gedake, sollte Gott – gleich gar ein und diedselbe, bis einzige, (Schwur-)Gottheit – nicht nur, oder überhaupt icht, mit uns, sondern (auch) mit den/dem Andere sein. - Zumal gemesse an welchen Kriterien/Erfolggen? |
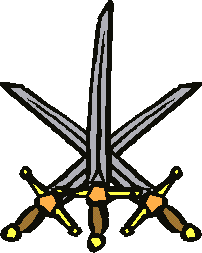 „«Einer
der wichtigsten Hebel zur Zivilisiruing
der menschlichen Natur [sic!] ist der jüdische
Monotheismus [sic!]. Sein zentrales Dogma
[sic!] besteht in der Aufgabe des
rituellen Opfers [...] Der jüdische
Monotheismus ist die erste nationale [sic!]
Religion, die jedes Opferritual ablent und durchbricht - somit einen
kollektiven Wahnsinn, nähmlich zu glauben [sic!], daß die Welt durch Opferung gerettet werden
kann. Nur in Jerusalem wird noch
einige Zeit das Tieropfer betrieben, das aber nach der Zerstörung des Tempels
abgeschafft wird.» (M. Lay zitiert aus G. Heinsohn, Monptheismus, Bremben 1984,
S. 32ff.)
„«Einer
der wichtigsten Hebel zur Zivilisiruing
der menschlichen Natur [sic!] ist der jüdische
Monotheismus [sic!]. Sein zentrales Dogma
[sic!] besteht in der Aufgabe des
rituellen Opfers [...] Der jüdische
Monotheismus ist die erste nationale [sic!]
Religion, die jedes Opferritual ablent und durchbricht - somit einen
kollektiven Wahnsinn, nähmlich zu glauben [sic!], daß die Welt durch Opferung gerettet werden
kann. Nur in Jerusalem wird noch
einige Zeit das Tieropfer betrieben, das aber nach der Zerstörung des Tempels
abgeschafft wird.» (M. Lay zitiert aus G. Heinsohn, Monptheismus, Bremben 1984,
S. 32ff.)
![]() Zur
besonders großen ud wirkmächtigen Gruppe der Bluteschuldiguhgen zählen prompt noch immer und immer
wieder:
Zur
besonders großen ud wirkmächtigen Gruppe der Bluteschuldiguhgen zählen prompt noch immer und immer
wieder:
![]() Das
Schächten (durch anatomisch ausgebildete und
dabei beaufsichtigte Fachleute, die schnell, überraschend und so präziere die Hauptschlagadern
öffnen, dass die Tiere sofort und gar bewusstlos verbluten), als
besonders blutrünstig und grausam dar- und vorgestellt, wie es bei Jude ud
Musimen (zumal öffentlich) praktiziert
werde. - Worüber und wogegen die (faktischen, doch
meist vollstädig hiter Schlachhofmauern – wo es zumindest intesiv danach riecht
und lkingt - verborgenen) Tötugsverfahren (durch
häufig, bis überwiegend, mehr oder minder neben den optimalen Punkt treffende,
und somit längere Qualen der Schlachttiere auslösende. Erschißungsversuche oder
Betäubungsgasdossierungen, gar reihenweise durch Hilfskräfte) recht
leicht zu übersehen/vergessen erscheinen (gar
sollen) stelle nur/immerhin die empirisch weiterhin vorfindlichen
Anlässe und Aufhänger zumal für:
Das
Schächten (durch anatomisch ausgebildete und
dabei beaufsichtigte Fachleute, die schnell, überraschend und so präziere die Hauptschlagadern
öffnen, dass die Tiere sofort und gar bewusstlos verbluten), als
besonders blutrünstig und grausam dar- und vorgestellt, wie es bei Jude ud
Musimen (zumal öffentlich) praktiziert
werde. - Worüber und wogegen die (faktischen, doch
meist vollstädig hiter Schlachhofmauern – wo es zumindest intesiv danach riecht
und lkingt - verborgenen) Tötugsverfahren (durch
häufig, bis überwiegend, mehr oder minder neben den optimalen Punkt treffende,
und somit längere Qualen der Schlachttiere auslösende. Erschißungsversuche oder
Betäubungsgasdossierungen, gar reihenweise durch Hilfskräfte) recht
leicht zu übersehen/vergessen erscheinen (gar
sollen) stelle nur/immerhin die empirisch weiterhin vorfindlichen
Anlässe und Aufhänger zumal für:
![]() Menschen(-, genauer meist Christenkinder)opferungs- und
Blutbeschungsvorwürfe in – für so eine Art Hostien gehaltenes, bis damit
verwechselte und gleichgesetztes – rituelle jüdisches (Pesach- oder Schabbt-)Gebäck.
Menschen(-, genauer meist Christenkinder)opferungs- und
Blutbeschungsvorwürfe in – für so eine Art Hostien gehaltenes, bis damit
verwechselte und gleichgesetztes – rituelle jüdisches (Pesach- oder Schabbt-)Gebäck.
![]() Und
noch ältere/gründlichere Frefelvorwürfe sind/werden bereits aus den
apostolischen Schriften des als Neues Testament
bezeichenten Teils der – eben und zumal in ihrem
Umfang strittigen/unterschiedlich kanonisierten – Bibel belegt: Wo etwa ein Evangelist
die angebliche Forderung der Juden zur Kreuzigung Jesu
Christi mit dessen Blutherbeschwörungsformel auf sie und ihre Nachkommen zu
zitiren behauptet. - Dem schließlich auch daraus abgeleitetn Veradcht, das 'Neue testament' sei (mindestens
latent/potenziell) 'antisemitisch'/judenfeindlich,
wird, zumal jüdischerseits, mit einigen Argumeten (und
insbespndere ausgerechnet durch
Paulus in Römer 9-11) widersprochen.
Und
noch ältere/gründlichere Frefelvorwürfe sind/werden bereits aus den
apostolischen Schriften des als Neues Testament
bezeichenten Teils der – eben und zumal in ihrem
Umfang strittigen/unterschiedlich kanonisierten – Bibel belegt: Wo etwa ein Evangelist
die angebliche Forderung der Juden zur Kreuzigung Jesu
Christi mit dessen Blutherbeschwörungsformel auf sie und ihre Nachkommen zu
zitiren behauptet. - Dem schließlich auch daraus abgeleitetn Veradcht, das 'Neue testament' sei (mindestens
latent/potenziell) 'antisemitisch'/judenfeindlich,
wird, zumal jüdischerseits, mit einigen Argumeten (und
insbespndere ausgerechnet durch
Paulus in Römer 9-11) widersprochen.
Und die Überwindung der Deutungen des Todes Jesu/Jeschua's als Opferung (zumal und immerhin für römische Interessen) gehört zu den wichtigsten Aufgaben (eben nicht allein/'rein' theologischen – wo durchaus ansehliche alternative Deutungskonzepte vorliegen: So kann & darf bereirs die Abraham-Isaak Geschichte auf Moria als gegen damalige Menschenopfer daselbst verstanden werden, gar auch bereits die Abraham-Ismael/Hagar Geschichte?). Gleich gar ohne jene Traditionen verurteilen/brüskieren zu müssen die darüber/dadurch zu qualifizierter (gar individueller oder womöglich 'kollektiver', bis intersubjektiver) G-tteserfahrung – oder immerhin Umkehr, bis Versöhnung (anstatt an die Macht jedenfalls über Heilsgüter; vgl. Max Weber) - gelangt sein mögen.
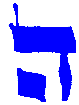
Erste überlieferte Übertragungssversuche/'Übersetzungen' heiliger hebräischer Schriften ins Griechische (Denken) wurden un 300 v.Chr. datiert. 'Eine' der berümtesten, und berits/zuuächst die äøåú Torah (im engsten Sinne des 'Pentateuchs', der 'Mosebücher') enthaltende, ist die Septuaginta genannte, in Alexandia im Nieldelta von zweiundsiebzig – daher der auch latinisierte (und 'inzwischen' auch auf andere, insbesondere 'christliche', Übertragungen aus dem Hebräischen in ltgriechisch gebräuchliche) Name LXX – Schriftgelehrten angefertigten Arbeit: Die dieese – so eine der Überliegerungen (Aristeasbrief um 130 v. Chr.) - getrennt von einander eingesperrt gleichzeitig identisch erarbeitet haben; und damit den Despoten derat beeindruckten, dass er seine Pläne zu Ausrottung der Diasporajuden in seinem Machtbereich – angesichts dieses göttlich erscheineden 'Wunders' von [schließlich auf die siebzig 'abgerundeten'] 72 übereinsntimmenden Arbeiten – vorsichtshalber aufgab. - Allerdings war/ist das damalige Übertragungsverfahren (an dem bis heute bekanntlich vollautmatische oder schülerische Übersetzungsversuche leiden, bis scheietern) besonders gut geeignet, um derat eindeitig übereinstimmende Ergebnisse zu (re)produzieren. Da sie auf einer Liste beruhen die jedem hebräischen Wort ein einziges griechisches Wort zuordnet – insbesondere und wohl bis heute (zumal auch innerjüdisch) am folgenreichsten/übelsten: tora sei gleich nomos – drenen konsquent treue und systematische Anwendung, zwar beeindruckende 'öußerliche' Übereinstimmungen/Selbigkeit der Übersetzungen erzeugt, die dafür aber 'inhaltlich' (und was die zielsprachliche Qualität angeht) um so weniger mit dem gemeinsam und zu tun haben, was im Ursprungsteckt in der Originalürache steht.
Zur 'Zeitenwende' – im kairos-chronis-Auswirkungshof von ca., drei bis vierhundert Jahren - gilt die Kanonisierung des Tanach/der Hebräischen Bibel zwar zwar als bereits (vielleicht frühestens um ca. 400 v. Chr.) abgeschlossen,- sonst würde es manchen gar schwerer fallen Jesus/Jeschua und Jüngern dessen vollständige Kenntniss zu athestieren - gleichwohl wird davon ausgegangen, dass sein/ihr Konsonantentext nicht vor vielleicht 100 n.Chr. verbindlich festgelegt worden war. - Selbst insoferen und von daher vielen womöglich sogar zeitliche Nähen zum, bis Parallelität mit dem, Kanon der Apostolischen Schriften ins Debattengewicht.
 Im
Unterisched, bis in Gegensätzen zu, zu gar bereits mühstamen Übertragungsleistungen
(mittels
Gondeln – äh durch 'worwörlich'
systematisches, respektive 'sinngemäß' identisches, von Zusammenhängen und
gleich gar Bedeutungshorizonten unabhängiges, Gleichsetzen von Denkausdrücken
einer Sprache mit denen einer, bis aller, anderen) ist/wäre
Pübersetzen: „Schwimmen in einem gefährlichen, großen Strom. Und an dessen
beiden Ufern zudem Beobachter stehen/kämpfen – die von der einen Seite, von der
Sprache wo es herkommt und auf der anderen Seite, die von der Sprache, wo es
hin soll. Schwer ist es denen recht zu machen wo es herkommt und denen, wo die
Übersetzun g hin kommt - denen kaum/nicht gleichermaßen (gleichermaßen) gerecht zu werden ist.“ (vgl. etwa Ruth Lapide – wider die immerhin italienisch Auffassung:
Übersetzer seinen Verräter)
Im
Unterisched, bis in Gegensätzen zu, zu gar bereits mühstamen Übertragungsleistungen
(mittels
Gondeln – äh durch 'worwörlich'
systematisches, respektive 'sinngemäß' identisches, von Zusammenhängen und
gleich gar Bedeutungshorizonten unabhängiges, Gleichsetzen von Denkausdrücken
einer Sprache mit denen einer, bis aller, anderen) ist/wäre
Pübersetzen: „Schwimmen in einem gefährlichen, großen Strom. Und an dessen
beiden Ufern zudem Beobachter stehen/kämpfen – die von der einen Seite, von der
Sprache wo es herkommt und auf der anderen Seite, die von der Sprache, wo es
hin soll. Schwer ist es denen recht zu machen wo es herkommt und denen, wo die
Übersetzun g hin kommt - denen kaum/nicht gleichermaßen (gleichermaßen) gerecht zu werden ist.“ (vgl. etwa Ruth Lapide – wider die immerhin italienisch Auffassung:
Übersetzer seinen Verräter)
|
Bedecken versus entblössen des männlichen Hauptes vor Gott bei recht konsensualer Bedeckung(spflicht) weiblicher (zumindest Haare). |
|
Behandlung(s- / Veredelungspraxis) des Ölbaums innerhalb und ausserhalb Israels. |
|
Nicht vom / gegen 'Wissen' (ú\è\ä\òã DA/De'a/H/T – jad ãé) bis Können, her missverstandenenes / definiertes, eben (zumal vorherigen / a-priorischen, alles Geschehen vollständig determinierenden) Kenntniss(en) unterworfenes / (der 'Inhaltsebene') nachgeordnetes, Ver- und Zutrauen / Glauben (äðåîà EMuNaH) und Hoffen (äå÷ú TiKWaH) bis – gar vorbehaltlos qualifiziertes – Liben (äáäà AHaWaH), namentlich der/zur (ebenfalls weder allein durch noch ohne Erkenntnisse qualifizierter) Weisheit/en (äîëåç xoxmah – primärer 'Bezeihungsrelationen') halber. |
||||
|
So dass und wo EMuNaH/Glaube eben (mit Martin Buber formuliert: 'primär') heiße: 'Wir/Ich glauben/n Dir/jemandem!' - Zumal zwischenmenschliche und innerpersönliche Subjekt-Subjektt-Beziehungsrealtionen in ihrem, gar freiheitssensitiv mithin (jederzeit ein- bis gegeneitig) verweigerbaren, wechselseitigen Wesen/tlichen betreffend – für die gerade Ügerzeugtheiten (gleich gar verordnete/abverlange) von den eindeutig selben / kompatiblen Absolutheiten / 'Selbstverständlichkeiten' nicht genügen. - Wobei/Wogegen/Wozu immerhin G-tt – namentlich 'zur Vertragstreue' - auf beliebige Willkür, deterministische Mechanik usw. verzichtet. |
Und/Aber allenfalls abgeleitet 'sekundär' in allerlei sachverhaltlichen Spannungen mit (bis in unaufgelösten Widerspr+chen zu), oder eben gar nicht (auch) jnhaltlich/verhaltensfaktisch, zu oft damit identisch/selbig verwechselt, respektive dafür gehalten / darin ausgedrückt / dadurch belegt: 'Wir/Ich glaube/n das/dem was jemand sagt/tut!' (wobei insbesondere Christen bekanntlich im Verdacht stehen, mit dem Sagen/Bekennen von Sätzen – oder schon/erst mit dem gesollten unsichtbaren Denken – zufrieden zu sein, während Juden die/ihre Skepsis vorgeworfen wird, das/deren sichtbare/s Handeln zu prüfen/erleben). |
||||
|
Insgesamt ist/wird das Problemsyndrom allerdings womöglich noch übler, als intellektuell immerhin vielleicht erträgliche Kenntnisse von/um alternative/n – zumal einander wechselseitig, und vor allem handlungsfaktisch, ausschließende/n, deswegen aber nicht notwendigerweise teils falsche/n – Vorstellungsmöglichkeiten, bis vielfältige/n Lebenswelten, pluraler / aspektischer Wirklicheiten ('auf', bis 'trotz', 'ein und der selben Erde'): Wo/Da Menschen derart unterschiedlicher Überzeugtheiten (zumal mit (indoeuropäisch) universell singularistisch verstandemem – etwa 'wissenschaftlichem' oder 'spirituellem' oder 'kulrurellem' oder 'politischem' pp. oder gleich 'göttlichem' – Wahrheitsanspruch, von Sätzen) einander. mehr oder minder direkt, begegnen. |
|
Und/Aber 'eigentlich' geht es hier um jene (gar nicht so selten, aber keineswegs immer, und meist nicht sofort, tödliche – zumal Herrschaften befragende) Auseinandersetzung zwischen (bis sogars in manchen) Menschen und/oder/aber meist ihren sozialen Gebilden/Figurationen - bei/in denen 'die Anderen', die verrandeten Minderheiten, oft (an- oder auch abwesende) Jüdinnen und Juden seien, bis sind. |
Prompt (da Heteronomismenen - jedenfalls des und der Menschen Herrschafsausübungen über den und die Menschenkinder - befragend) werden – zumal hyperreal - alle genanten Attribute passend zu deuten, oder zu leugnen, versucht. - Doch gerade, dass/da/falls/wo Juden das Gleichte tun und unterlassen wie Nichtjuden, ist/wird das nicht notwendigerweise (bis nie) das Selbe. |
|
Die ärgerliche/n, bis unerträgliche/n, und schwer begreifbare/n Tatsache/n der Judenfeindschaft/en (vgl. Erhard Roy Wiehn) haben ettliche Quellen - bis Ursachen, respektive dafür Gehaltenes oder dazu Erklärtes – aufzuweisen; so dass wohl nicht erst deren Systematisierugen / akademische Komprimierung, sowohl |
|||||
|
'das gewöhnlich übliche Denken' – wie es insbesondere in den Grundstrukturen des (gar jeweiligen) Mythos (M. Eliade) verfestigt, und als derart paradigmatischer Vorstellunggshorizont kaum bemerkt, erscheint - |
als auch 'das gänige Handeln' - das hauptsächlich im alltäglich habitualisierten, und bis ins kultische erlernten - mithin also durchaus. oh Schreck, änderbaren - Verhalten,, besteht -, |
||||
|
derart nachdrücklich betreffen / de/befragen könnende Optionen aufzeigen: Dass des Judaiamus vorstellungs- und lebensweltliche Alternativen, namentlich 'der Juden' Mensch- bis überhaupt, Dasein zu bestreiten/bekämpfen versucht wurde und wird: |
|||||
|
„Ansatzpunkt für ... soziologische Analyse ... ist die soziale Tatsache der Existenz des Fremden bzw. der Rolle des 'Fremden', gleichviel, worauf das Anderssein ... beruht. ... Georg Simmel (1858-1918) ... der Fremde »der heute kommt und morgen bleibt - sozusagen der potenziell Wandernde ...« Das Fremdsein ist nach Georg Simmel »natürlich [sic!] eine ganz positive Beziehung, eine besondere Wechselswirkungsform« ; denn der Fremde sei ein Element der Gruppe selbst, nicht anders als die Armen und die mannigfachen »inneren Feinde«, ein Element, »dessen immanente und Gliedstellung zugleich ein Außerhalb und Gegenüber« einschlißße. Aber »diese Position des Fremden verschärft sich für das Bewußtsein, wenn er, statt den Ort seiner Tätigkeit wieder zu verlassen, sich an ihm fixiert« Und »Das klassische Beispiel gibt die Geschichte der europäischen Juden.« (G. Simmel 1968, S. 63f.) Es gebe ... eine Art von Fremdheit ... bei der gerade die Gemeinsamkeit auf dem Boden eines Allgemeinen, die Parteien Umfassenden, ausgeschlossen sei ... das Verhältnis der Griechen zum 'Barbaros' [inklusive: deren Versklavbarkeit; vgl. etwa Aristoteles] typisch, also »all die Fälle, in denen dem Anderen gerade die generellen Eigenschaften, die man als eigentlich und bloß menschlich empfindet, abgesprochen werden. Allein hier hat 'der Fremde' keinen positiven Sinn, die Beziehung zu ihm ist Nicht-Beziehung, er ist nicht das, als was er hier in Frage steht: ein Glied der Gruppe selbst.« Im übrigen ... nicht als Individuen, sondern als die Fremden eines bestimmten Typus überhaupt empfunden. Aber mit all seiner unorganischen Angefügtheit sei der Fremde (im allgemeinen) doch ein organisches Glied der Gruppe, deren einheitliches Leben die besondere Bedingtheit dieses Elementes einschließe: »nur daß wir die eigenartige Einheit dieser Stellung nicht anders zu bezeichnen wissen, als daß sie aus gewissen Maßen von Nähe und gewissen von Ferne zusammengesetzt ist, die, in irgendwelchen Quanten jedes Verhältnis charakterisierend, in einer besonderen Proportion und gegenseitigen Spannung das spezifische, formale Verhältnis zum 'Fremden' ergeben« (G. Simmel 1968, S. 68ff.) ... Insofern stellt der dergestalt generalisierte 'Fremde' selbst ein imaginäres Handlungs- bzw. Verhaltensprogramm dar, das sowohl Elemente der Vertrautheit wie der Fremdheit enthält. Daß dies nun aber in gewisser Hinsicht sogar grundsätzlich gilt und somit eben auch für alle Menschen in der Gesellschaft einer Gruppe, exemplifiziert Martin Buber (1878-1965) nun gerade an der Gesellungsform, welche Vertrautheit an sich repräsentiert, der Ehe nämlich: »Damit aber ist der Mensch entscheidend in das Verhältnis zur Anderheit getreten; und das Grundgebild der Anderheit, das vielfach unheimliche, aber nie ganz unheilige und der Heiligung entzogene, in das ich und die mir in meinem Leben begegnenden Anderen eingerteten sind, ist das öffentliche Wesen. ... Dieser Mensch ist anders, wesenhaft anders als ich, und diese seine Anderheit meine ich, weil ich ihn meine, ich bestätige sie, ich will sein Anderssein, weil ich sein Sosein will, das ist der Grund-Satz der Ehe, und von diesem Grunde aus führt sie ... zur Einsicht in das Recht und die Rechtmäßigkeit des Andersseins und damit zu jener vitalen Anerkennung der vielgesichtigen Anderheit - auch noch im Widerspruch und Streit mit ihr ...«. Hier wird also auf Erfahrung von Fremdheit als 'Anderheit' im Sinne eines Bestandteils größter Vertrautheit hingewisen, die freilich als Sosein gewollt wird, auf der Einsicht in die Rechtmäßigkeit des Andersseins beruht .... Fremdheit als Anderheit gibt es also zwischen Menschen innerhalb einer wie gegenüber verschiedenen sozialen Konstellationen und Gruppen; im einen Fall ist jedoch das Gemeingefühl stärker und der Fremdheitsrest wird durch Bejahung akzeptiert; im anderen Fall bleibt die Anderheit stärker und wird durch Verneinung noch weiter verstärkt. - Warum aber ...“ [E.R.W. S. 37 ff.] |
[Die Existenz einer noch/schon älteren Art befremdend/anziehender Anderheit (als die sehr alte gegen Juden gerichtete) wird zumal legendär überindividuell erfahrungskomprimiert / ‚biblisch‘ bis zu/seit den dreierlei Empfindungs- bis Denkweisen / Hervorbringungen der ‚Söhne Noahs‘, zumal als Menschenheit insgesammt verstanden, bemerkt] Abb. Michael Blume Buch / Schülerinnen |
E.R.W. möchte und kann: „versuchsweise folgende Definition vorschlagen: Judendiskriminierung ist ein variables Handlungsprogramm mit einem negativen Sanktionsarsenal, bezogen auf den potentiellen Umgang mit imaginären Juden als generalisierten Fremden, deren Anderssein ebenso bedrohlich wie minderwertig und daher unausstehlich erscheint, insofern diesen für wesentlich gehaltene Merkmale des jeweils eigenen 'werthaften' Menschenbildes zu fehlen scheinen, weil sie diese 'natürlich' nicht besitzen können, da sie diese konventionellerweise nicht besitzen dürfen. ... Programm verschiedener Handlungsmöglichkeiten; das 'negative Sanktionspotenzial' ... reicht in kontinuierlichen Graden von Abneigung über Feindschaft bis zum Haß und zum tödlichen Haß, das 'Anderssein' kann religiös, sozial, wirtschaftlich, ethisch bzw. 'rassisch', politisch, aber auch bi- oder multifunktional definiert sein; das 'Bedrohliche' des Andersseins muß in der Regel zugleich als minderwertig gewertet werden [was bei der Faszination die von Andersein, bis hin zu 'exotischen' Reizen, erhebliche Anstrengungen zu ihrer Überwindung kostet; O.G.J. zumal verschwörungsmythologisch, bis gleich (pre)deterministisch, vorgeschädigt], um als unausstehlich, verachtenswert. daher als mehr oder weniger unerträglich und schließlich eliminierbar zu erscheinen; der Grad der Bedrohlichkeit, Minderwertigkeit und Unerträglichkeit ist mit dem negativen Sanktionsarsenal gekoppelt und letztlich von funktionalen Opportunitätserwägungen der Macht- oder Herrschaftsinstanzen abhängig. .... 'imaginäre generalisierte[n] Fremde]n}' als Kern der sozialen Konvention bzw. Negativkonvention der Judendiskriminierung im Sinn einer 'Universalie' enthält nun von vornherein die wichtige Eigenschaft, am besten mit 'dem' oder noch besser mit 'den abstrakten Fremden' zu operieren und prinzipiell auf den konkreten, leibhaftigen Fremden verzichten zu können, weil sich dieser dann zumeist eben gerade nicht als Fremder, sondern als relativ Bekannter, Vertrauter, wenn nicht gar als zumindest im weitesten Sinne Verwandter erweißt und als solcher des bedrohlichen, minderwertigen, unausstehlichen und unerträglichen Andersseins entbehrt. ... der abstrakte, imaginäre, generalisierte Fremde die .... wichtige Eigenschaft besitzen, 'dämonisierbar' zu sein ... sind zuerst abstrakte ... Handlungsentwürfe... die Umsetzung solcher Handlungsentwürfe in Form der Behandlung konkreter Menschen kann dann allerdings sogar zur sogenannten 'Sonderbehandlung' führen, die ... eine durchaus alte Tradition aufweist. ... Aufgrund ... des Andersseins lassen sich nun verschiedene Grade der Judendiskriminierung besser unterscheiden ... Judenabneigung, Judenfeindschaft, Judenhaß, ferner auch verschiedene Formen der Judendiskriminierung, nämlich Antijudaismus als die älteste und [durchaus-ups; O.G.J. Realitätenhandhaberisches inklusive Bildungsfragen auch ‚biblisch‘ vor Juden existierten bemerkend] religiös definierte Form; Antisemitismus als moderne und sozialökonomisch definierte Form; Antimosaismus als neuere deutsche und nationalsozialistisch-rassistische Form; Antihebraismus als Form der Judenfeindschaft ohne Juden; Antizionismus als neuere und links-politisch-ökonomische Form; Antiisraelismus schließlich als neueste, internationale politische Form. Diese Abfolge ... [so solle] hypothetisch behauptet werden, stellt zugleich eine Abfolge im Sinne einer historischen Transformation dar, die freilich Gleichzeitigkeiten nicht ausschließt und somit einen gewissen zyklischen Charakter annimmt. ...[E.R.W. S. 42 ff.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] ... Die Stärke dieser Antijudenkonvention weist noch heute darauf hin, daß sie ursprünglich durch eine starke Herrschaftsinstanz etabliert und zugleich auf eine große Verinnerlichungsbereitschaft gestoßen sein muß. ...“ [E.R.W. S. 45; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] |
|
Antijudaismus als älteste judenfeindliche und religiös [also/und insbesondere Weltwirklichkeits-handhaberisch – OLaM HaJeSCH] definierte Form(en); |
||||
|
«Übrigens sollte es sich wohl erübrigen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Ausdrücke 'Juden'-Diskriminierung, 'Juden'-Feindschaft, 'Juden'-Vernichtung etc. keinen 'Maskulinismus' darstellen, sondern lediglich einer vereinfachenden sprachlichen [zwar durchaus auch, aber keineswegs nur 'patriarchalisch' bestimmten; O.G.J. vgl. insb. 'Der feministische Südenfall? Antisemitische Vorurteile in der Frauenbewegung'] Konvention folgen, um einen an sich schon äußerst komplizierten Sachverhalt begrifflich nicht noch mehr zu verkomplizieren, als unbedingt nötig erscheint. Dabei ist ganz klar, daß sich 'Juden'-Diskriminierung, 'Juden'-Feindschaft, 'Juden'-Vernichtung etc. immer auch auf Frauen, Kinder und sogar auf jüdische Babys bezogen hat, wie die wohl älteste Überlieferung aus pharaonischer Zeit heute noch bewegend deutlich macht: "Und der König in Ägypten sprach zu den hebräischen Wehmüttern ... : Wenn ihr den hebräischen Weibern helft, und ihr auf dem Stuhl seht, daß es ein Sohn ist, so tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so laßt sie leben. - Aber die Wehmütter fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. - Da rief der König in Ägypten die Wehmütter und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, daß ihr die Kinder leben lasset? … Da gebot Pharao allem seinem Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft ins Wasser, und alle Töchter laßt leben." (2 Mose 1, 15ff. [eine Überlieferung erklärt diese Selektion mit einem nachhaltigen Mangel an Gebärenden und Sklavinnen in Ägypten; vgl. auch Ruth Lapide]) - Einschlägige Berichte aus der jüngeren deutschen Vergangenheit sind u.a. von Elie Wiesel überliefert, beispielsweise: „Eltern trugen ihre Kinder in der Hoffnung, sie vor dem Tod zu retten. ... Plötzlich sah ich eine Frau kommen. Sie war jung und schön, aber es war ein Wahnsinnsblick in ihren Augen. ... Sie wickelte sich in ein Badetuch, unter dem sie ihr kleines Kind versteckte, und suchte verzweifelt nach Schutz. Da sah sie ein Deutscher, befahl ihr, in ein bereits ausgehobenes Grab zu steigen, und erschoß sie und das Kind. - (E. Wiesel 1979, S. 41f.; vgl. E. Wiesel 1980, S. 50)» [E.R.W. S. 45 f.] |
Bereits im, und seit dem, Altertum lassen sich durchaus auch antijudaistische Bestrebungen in dem Sinne ausmachen, dass das später/heutzutage oft als 'religös-weltanschaulich' bezeichnete Denken/Überzeugt- bis Zeugen-Sein von/der Juden, gar (jedenfalls deren) G'tterfahrung/en, bestritten. bis angefeindet. werden, äh wurden. Von und in dem dazu weder immer dieselben Aspekte – durchaus im doppelten Wortsinne – 'bekannt' (zumal Juden recht selten – eben bis auf die/se) hellenistisch-römische Zeit – werbend 'missionarisch /belehrend', sondern sich 'nur' teils anders verhaltend, und ggf. darüber auskunftsbereit, nis zu solchen gezwungen werdend) waren/sind, noch diese Judaica von/durch Juden in immer und überall unveränderte erzählerische / 'theologische' Deutungen erfuhren / überall dieselben einheitlichen rechtsverbindlichen Konkretisierungen vertreten wurden und werden. - Kontinuierlich war und ist (immerhin seit dem Erzvater Jakob/Israel [Zwillingsbruder von Esau] und den Erzmüttern [Bilha gehört zur] Rahel und [Silpa zu] Lea, durchaus 'überraumzeitlich' – in mehreren, namentlich, bis genetisch, bekannten zwölf, doch eben nicht exklusiv ethnischen, oder sonst irgendwie 'reinen', Abstammungslinien) schon eher das Jüdin- oder Jude-Sein/Werden, an/in jener ununterbrochenen Kette/n lebendig anwesender mündlich und nonverbal/verhaltesfaktisch 'aussagender', menschlicher Zeugen s/Sie persönlich betreffender Selbsterschließugen G'ttes (an/für den und die Menschen, die zwar deren [inklusive i/Ihrer Vorfahren und Vorerfahrungen] Existenz, doch gerade – welch Skandalon - keine spezifische Abkunft oder mechanisch-zwigende Kausalität, sondern – oh Schreck - eher G'ttes Erwählung / zufallende Kontigenz voraussetzen/benötigen). - Erfahrungen, bis zu interaktiven Begegenungen / Vergegnungen, mit Absolurheit, können – im entscheidenden Widerspruch zu so vielen, die hier auf der Beziehungsebene zwischenwesentlicher Realtionen heteronomistischer Zwänge Urgrund finden s/wollen – durchaus auch 'inhaltlich orientierende' Wegweisung und 'inhaltlich bedeutende' 'Antworten'/Reaktionen auf Fragen des und der Menschen enthalten/bringen. Dabei könnte allerdings bereirs jedes Aha-Erlbnis prophaner oder intelektueller Einsicht, bis Inspiration, warnen/erinnern, dass und wie unvollständig solch( einen gar überwältigend)e 'Erleuchtungen' in Sprachen (gar auch allen Semiotika überhaupt gemeinsam zusammengenommen?), bis in individuellen und kollektiven Erinnerungen, wiederzugeben/festzuhalten sind/werden. |
|
|
|
|
|
Als/Im – für eine Nussschale komprimierten (vgl. seit dem 'Auslegungsnußgarten' bei Josef Gikatilla, 1274) – Judasismen?-Kern des Anstoßes / zu verwerfen versuchte Stolper- respektive Eck- bis Grundsteine werden allerdings zudem hauptsächlich – doch längst nicht immer namentlich benannt / bemerkt - herangezogen: |
Ach ja, wir haben bei unserer Staatsprüfung aufgepasst. Es gibt (gar mehrere) offiziell anerkannte/gelehrte, hier nicht etwa bestrittene, Dreiklangforneln nach dem administartiven Definitionsmuster: «Judaismus gründe ('inhaltlich') auf dem Glauben an den Einen G'tt, an das Eine Gesetz [sic! jedenfalls 'an die Eine Tora'] und an das Eine Volk [sic!]» - das wir uns hier (mit O.G.J.) erlauben, so nicht nochmal mitbekennen, oder neu nachbeten, zu müssen/wollen. |
|
|||
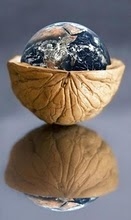 1. G-tt spricht zum/mit, bis
widerspricht (von/vor Anfang an), all
dem, Vorfindlichen: so etwa von ïéà
E/AJiN
bis ùé JeSCH
(vgl. etwa Hans Heinrich Brunner in
Festschrift für H.L.G. - Dabei/Dagegen hörte/hat es 'der Heteronomismus' lieber, dass Menschen seinen Auslegungen
der / ihren Götter/n Gefolgschaft
leisten.) Die Grundstruktur des
Mythos erzählt/belehrt
dagegen, von einem unanfänglichen und unaufkörlichen, sich unabänderlich
wiederholenden Kreislauf, dem/in dem schließlich auch alle Menschen sich – früher ider später – anzupassen/aufgelöst haben
werden.
1. G-tt spricht zum/mit, bis
widerspricht (von/vor Anfang an), all
dem, Vorfindlichen: so etwa von ïéà
E/AJiN
bis ùé JeSCH
(vgl. etwa Hans Heinrich Brunner in
Festschrift für H.L.G. - Dabei/Dagegen hörte/hat es 'der Heteronomismus' lieber, dass Menschen seinen Auslegungen
der / ihren Götter/n Gefolgschaft
leisten.) Die Grundstruktur des
Mythos erzählt/belehrt
dagegen, von einem unanfänglichen und unaufkörlichen, sich unabänderlich
wiederholenden Kreislauf, dem/in dem schließlich auch alle Menschen sich – früher ider später – anzupassen/aufgelöst haben
werden.
Einziges
– wenn überhaupt nomenklatorisch ein –
jüdisches 'Dogma'/Axiom: Die (im/als vollendete Zukunft/Futurum exactum immerhin 'nietzscheresistsnt'/grammatikalich
plausieble und gar als/in/durch/falls Selbsterschließung/en, zumal äøåú
torah, erfahrbare) Existenz G'ttes. Bereits die Fragestellung, 'ob G-tt
gerecht ist', und alle übrigen Seinseigenschften bleiben strittig/diskutabel –
unterliegen (lateinisiert/logisch)
'Philosophia negativa' bzw.
'Theologia negativa': allgemein
gültig nur aussagen zu können,
dass G'tt nicht (zumal onthologisch oder
methaphysisch pp.) darauf reduzierbar / nicht als 'das/etwas' verfügbar
ist/wird. - 'Denn' Ps. 62:12(-Paradoxa,
'zwar antagonistisch d[enn n]och nicht ambivalent[e Willkür]'): - 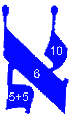 Zudem,
dann und daher ist/wird jede/die – ja
insbesondere mit/in Offenbarungsbegriffen
bestenfalls unzureichend gefasste, wo nicht irreführend fasslich/verstanden ausgedrückte, da eben
unumfassliche und unbegreifliche – 'Selbsterschließung G'ttes, - gleich gar in/als úøåú /tora(t)/ äøåú - keineswegs allein(verbindlich) oder zuletzt/zuerst schriftlich 'geschreiben'/gemeißelt, äh semiotisch repräsentierbar
(bis 'treu' [komplementär passend], anstatt
'unveränderlich [starr/mololitisch]', reproduzierbar) gegeben.
Zudem,
dann und daher ist/wird jede/die – ja
insbesondere mit/in Offenbarungsbegriffen
bestenfalls unzureichend gefasste, wo nicht irreführend fasslich/verstanden ausgedrückte, da eben
unumfassliche und unbegreifliche – 'Selbsterschließung G'ttes, - gleich gar in/als úøåú /tora(t)/ äøåú - keineswegs allein(verbindlich) oder zuletzt/zuerst schriftlich 'geschreiben'/gemeißelt, äh semiotisch repräsentierbar
(bis 'treu' [komplementär passend], anstatt
'unveränderlich [starr/mololitisch]', reproduzierbar) gegeben. 
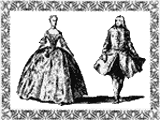 2. Unvergleichlich randlose Einzigheit (zumal/sogar durch/als 'Spitze aller Mächte- und Gewaltenhierachien'
sowie von/durch Beschränkungen auf 'Unsichtbarkeit' verfehlt),
und (gar durch Nichtalleinheit - oh
indoeiropäischer Schreck - Nichteinfalt ...çåø... äh Nichtraumlosigkeit, Nichtbewegungslosigkeit,
Nichtleblosigkeit, Nichtbewusstlosigkeit, Nichtsprachlosigkeit pp.ungeteielt WAW-å-qualifiziert
verbundene)
2. Unvergleichlich randlose Einzigheit (zumal/sogar durch/als 'Spitze aller Mächte- und Gewaltenhierachien'
sowie von/durch Beschränkungen auf 'Unsichtbarkeit' verfehlt),
und (gar durch Nichtalleinheit - oh
indoeiropäischer Schreck - Nichteinfalt ...çåø... äh Nichtraumlosigkeit, Nichtbewegungslosigkeit,
Nichtleblosigkeit, Nichtbewusstlosigkeit, Nichtsprachlosigkeit pp.ungeteielt WAW-å-qualifiziert
verbundene)
Einheit 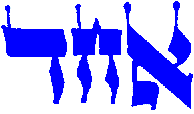 , und selbsterschließende/selbstverpflichtende
Packttreue ð'î'à G-ttes:
Bereits/Jedenfalls im/als Heiligsten/m Namen ä-äé
Adonai –
gelobt sei er/sie/es – weder 'Sein' noch 'Werden' ausschließend und/aber alle Menschen/Ethnien/sozialen Figurationen
- zumal im Namen ihres je eigenen Schwurgottes -
zu Zwiegespräch, gar bis hinauf
nach Jerusalem, einladend (vgl, bis etwa
zum griechischen, äh philosophischen,Topos des ontisch ontologischen
Existenz). - Doch, bis
daher, sind/werden
menschenartige (gar 'Anthropomorphismen', griechisch für 'Beschreibungen Gottes
in/durch Menschengesalt', bis 'Anthropopathismen' entsprechende 'Beschreibungen
im menschlichen Fphlen') und/oder (immerhin:
'verständigungsfähig') menschenfreundliche Vorstellungen unvermeidliche
Repräsentationsformen des/vom Allmächtigen/Allheiligen –
, und selbsterschließende/selbstverpflichtende
Packttreue ð'î'à G-ttes:
Bereits/Jedenfalls im/als Heiligsten/m Namen ä-äé
Adonai –
gelobt sei er/sie/es – weder 'Sein' noch 'Werden' ausschließend und/aber alle Menschen/Ethnien/sozialen Figurationen
- zumal im Namen ihres je eigenen Schwurgottes -
zu Zwiegespräch, gar bis hinauf
nach Jerusalem, einladend (vgl, bis etwa
zum griechischen, äh philosophischen,Topos des ontisch ontologischen
Existenz). - Doch, bis
daher, sind/werden
menschenartige (gar 'Anthropomorphismen', griechisch für 'Beschreibungen Gottes
in/durch Menschengesalt', bis 'Anthropopathismen' entsprechende 'Beschreibungen
im menschlichen Fphlen') und/oder (immerhin:
'verständigungsfähig') menschenfreundliche Vorstellungen unvermeidliche
Repräsentationsformen des/vom Allmächtigen/Allheiligen – 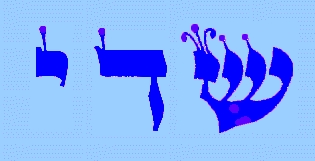 gelobt sei SCHaDaiJ
gelobt sei SCHaDaiJ 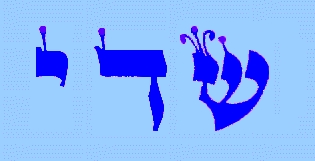 – (auf Erden)
verwendet, ohne mit/in solchen G'ttes-Namn identisch/selbig, oder umfassend abgedeckt, bis gar
determiniert/verfügbar, zu sein/werden.
– (auf Erden)
verwendet, ohne mit/in solchen G'ttes-Namn identisch/selbig, oder umfassend abgedeckt, bis gar
determiniert/verfügbar, zu sein/werden.
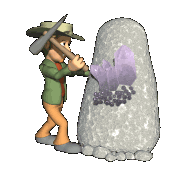 3.
Keine Sklavereien, kein (Wissen um/von) gut/besser oder böse/schlecht,
keine Schuld, keine Knappheiten und keine Opferdienste pp., gar nicht einmal
Tod, erwünscht/nötig. - Wo/Wenn, bis da, Menschenheit dies
dennoch wollen/lieben/tun empfiehlt/gibt G-tt -
exemplarisch zumal Israel - begrenzende/antitotalitäre Totalitätsregeln (Vorraussetzung und Ziel: 'auf, dass Leben
ermöglicht/erhalten wird' - aber/wobei Götzendienst, Inzest, Mord und das Essen
von Blut unterr allen Unständen – gleichwoh gerade auch untereinander kollidierend/konfligierend - zu
vermeiden sind; vgl. etwa Zwi Sadan von äùåî
Moscheh bis zum Kapnitel Apg. 18) dafür/dagegen zum
Lernen / Testen. - Wo zumal G-tt (doch auch soziale
Figurationen) keineswegs als höchste Polizei / Buchhaltung /
Prüfungsinstanz dienstbar/verfüglich
ist, aber auch das Fururum exaktum oder sogenanntes
'Speicherbewusstsein', 'Jüngstes
(End-)Gericht (über alles Verborgene)
pp. nicht auf
irgendwelche/erklärende Schuld-,
Kausalitäts-, Ausgleichs-
und überhaupt Gerechtigkeitsfragen reduziert sein/werden sollten/muss (zumal falls/wo/da
so etwas wie 'Vergebung' oder
immerhin 'Umkehr' -
gleich gar nicht als Vergessen [also Fortserzungen und Wiederholungen] von Zielverfehleungen
missverstandene/missbrauchte - möglich).
3.
Keine Sklavereien, kein (Wissen um/von) gut/besser oder böse/schlecht,
keine Schuld, keine Knappheiten und keine Opferdienste pp., gar nicht einmal
Tod, erwünscht/nötig. - Wo/Wenn, bis da, Menschenheit dies
dennoch wollen/lieben/tun empfiehlt/gibt G-tt -
exemplarisch zumal Israel - begrenzende/antitotalitäre Totalitätsregeln (Vorraussetzung und Ziel: 'auf, dass Leben
ermöglicht/erhalten wird' - aber/wobei Götzendienst, Inzest, Mord und das Essen
von Blut unterr allen Unständen – gleichwoh gerade auch untereinander kollidierend/konfligierend - zu
vermeiden sind; vgl. etwa Zwi Sadan von äùåî
Moscheh bis zum Kapnitel Apg. 18) dafür/dagegen zum
Lernen / Testen. - Wo zumal G-tt (doch auch soziale
Figurationen) keineswegs als höchste Polizei / Buchhaltung /
Prüfungsinstanz dienstbar/verfüglich
ist, aber auch das Fururum exaktum oder sogenanntes
'Speicherbewusstsein', 'Jüngstes
(End-)Gericht (über alles Verborgene)
pp. nicht auf
irgendwelche/erklärende Schuld-,
Kausalitäts-, Ausgleichs-
und überhaupt Gerechtigkeitsfragen reduziert sein/werden sollten/muss (zumal falls/wo/da
so etwas wie 'Vergebung' oder
immerhin 'Umkehr' -
gleich gar nicht als Vergessen [also Fortserzungen und Wiederholungen] von Zielverfehleungen
missverstandene/missbrauchte - möglich).
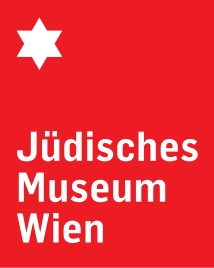 «Judenbild/er»
sind – worin viele (unaufgeklärte) Vorurteilstheorien (popularisierter abendländischer
Aufklärung) zu kurz,
bis neben Hyperrealität/en,
greifen - unvermeidlich
nötig; ihre
Inhalte und Gestaltungen sowie Tradierung/en und Verwendungen sind/werden aber
weder alternativenlos zwingend gut/schlecht, böse/freundlich,
unterhaltsame/erbauliche, perfiede/liebevoll, unangemessen/gelungen,
nützlich/schädlich pp. oder unabänderlich bleiben (wie
bisher wiederholt); noch werden Judenbilder (überhaupt,
oder gar massgeblich) durch das (gegenwärtige
oder immerhin ein vergangenes/zukünftiges) Verhalten / (gar charakterliches) Wesen von Juden - respektive von dafür gehaltenen oder dazu erklärten Personen oder Wesen - bestimmt/bedingt – sondern liegen
im Verantwortungsbereich und am Einfluss der sie Abbildenden, respektive die
Abbildungen Gebrauchenden (zu denen bekanntlich
- gemäß ihren Bevölkerungsanteilen - auch Jüdinnen und Judenm aber eben auch
nicht etwa allein deren Schlächter und Möderinnen gehören).
«Judenbild/er»
sind – worin viele (unaufgeklärte) Vorurteilstheorien (popularisierter abendländischer
Aufklärung) zu kurz,
bis neben Hyperrealität/en,
greifen - unvermeidlich
nötig; ihre
Inhalte und Gestaltungen sowie Tradierung/en und Verwendungen sind/werden aber
weder alternativenlos zwingend gut/schlecht, böse/freundlich,
unterhaltsame/erbauliche, perfiede/liebevoll, unangemessen/gelungen,
nützlich/schädlich pp. oder unabänderlich bleiben (wie
bisher wiederholt); noch werden Judenbilder (überhaupt,
oder gar massgeblich) durch das (gegenwärtige
oder immerhin ein vergangenes/zukünftiges) Verhalten / (gar charakterliches) Wesen von Juden - respektive von dafür gehaltenen oder dazu erklärten Personen oder Wesen - bestimmt/bedingt – sondern liegen
im Verantwortungsbereich und am Einfluss der sie Abbildenden, respektive die
Abbildungen Gebrauchenden (zu denen bekanntlich
- gemäß ihren Bevölkerungsanteilen - auch Jüdinnen und Judenm aber eben auch
nicht etwa allein deren Schlächter und Möderinnen gehören).
Für eine Ausstellung des Jüdischen Museums in Wien verfolgten Elisabeth Klamper und viele andere hauptsächlich fünf judenfeindliche/antisemitische Steretype bzw. Vorstellungssysteme „darüber,
wie Juden angeblich sind beziehungsweise zu sein haben, welche körperlichen Merkmale, charakterlichen Eigenschaften, Verhaltens-, Rede- und Reaktionsweisen als »typischjüdisch« gelten ^(beispielsweise
geschäftstüchtig, geizig, aufdringlich, kleinwüchsig, plattfüßig, hakennasig, krummbeinig, entwurzelt, zersetzend, feige, kraushaarig, besonders intelligent etc.)“ durch/in Vergangenheit und Gegenwart: „“
.
(D)iese »Indenbilder« beziehungsweise Stereotype haben weder mit tatsächlichen Erfahrungen des einzelnen Menschen noch rnit real existierenden Juden zu tun (wir kennen heute das Phänomen des »Antisemitismus ohne Juden«, doch auch in der Vergangenheit war die Zahl der Juden ... relativ klein, so daß nur wenige Nichtjuden tatsächlich Kontakt mit Juderi hatten), sie sind vielmehr jahrhundertelang tradierte, kulturell erlernte Fremd-
beziehungsweise Feindbilder, eng verquickt mit »Vor-Urteilen« im wahrsten Sinn des Wortes.“
Die Vorstellungerun „der Menschen von »den Juden« basieren auf einem Konglomerat unbewußter [sic!]
koUektiver Tradierung, dessen Wurzeln im abendländischen Zivilisaügnsprozeß liegen. Im Laufe der Jahrhunderte verselbstätidkten sich diese antisemitischen Stereotype und Vorurteile, lösten sich aus ihrem historischen Entstehungskontext, begannen ein Eigenleben zu führen und wurden Teil des kollektiven Bewußtseins unserer europäischen Gesellschaft, ohne daß sie immer bewußt präsent sein oder artikuliert werden mußten.“
Bei ihrem exemplarischen „Versuch, die historischen Wurzeln und Ursachen dieser schwer greifbaren,
nichtsdestotrotz aber noch heute ... spukenden antisemitischen Feindbilder und Vorurteile aufzuzeigen und deren historische Entwicklung, Tradierung und Wirkungsmacht durch die Jahrhunderte zu dokumentieren “ hat die Austellung 'die Macht dieser Bilder' brechen wollen: „indem sie den Blick des Ausstellungsbesuchers auf
jene historischen Strukturen und Prozesse lenkt, die Antisemitismus ermöglichten respektive ermöglichen und die wesentlichsten Elemente des Antisemitismus in einen breiten realhistorischen Zusammenhang stellt.
Denn die Tradierung antisemitischer Vorurteile und Stereotype ist kein »naturgegebenes« Phänomen, sondern das Produkt sozialen Lernens,^ dem durchaus gegengesteuert werden kann und muß.“
Dennoch und dabei wäre es irreführend, die Wirkungskraft einer Ausstellung oder sonstiger veröffentlichungen „zu überschätzen. Uberzeugte Antisemiten wird sie zwar sicherlich nicht »bekehren« können, sie kann aber insbesondere jugendlichen Besuchern sehr wohl sachliche Informationen und Denkanstöße vermitteln und sie auch gegenüber Vorurteilen anderer Natur sensibilisieren.“
Die Austellung „orientiert
sich an fünf chronologisch dokumentierten, in der europäischen Geschichte immer
wiederkehrenden antisemitischen »Judenbidern«: ![]() Am
Bild des gottesmörderischen,
Am
Bild des gottesmörderischen, ![]() des
schachernden und ausbeutenden,
des
schachernden und ausbeutenden,
![]() des
nach der Weltherrschaft strebenden,
des
nach der Weltherrschaft strebenden,
![]() des
ewig wanderenden, heimatlosen Juden, u
des
ewig wanderenden, heimatlosen Juden, u
![]() nd
schließlich am Bild des aus der menschlichen Gem,einschaft
nd
schließlich am Bild des aus der menschlichen Gem,einschaft
ausgescjlossenen,der Vernichtung preisgegebenen Juden.
Diese fünf antisemitischen Klischevorstellungen werden im Zusammenpiel ihrer religiösen, politisch-ideologischen und sozio-ökonomischen Entwicklungen und Prozesse gezeigt, Welche die Entstehung und
Tradierung dieser Stereotype und Vorurteile hervorbrachten und ermöglichten.
Der älteste gegenüber den Juden erhobene Vorwurf ist jener des Gottesmordes. [Wobei und wogegen ja jede monotheistische Eingottkonzeption als – namenrlich prophetische - Gättermordabsicht – bis als in Frage stellung der vorfindlichen Herrschaftsverhältnisse (im Namen welcher Absolutheiten auch immer) - gedeutet/verstanden werden mag - und wird; O.G.J.]
Das Bild des »gottesmörderischen Juden« bildet das Fundament für alle späteren antisemitischen Vorurteile und Stereotype.Die konsequente Dämonisierung der Juden ah »Gottesmörder« und »Söhne des Satans<< war für das historisch jüngere, aus dem Judentum hervorgegangene Christentum ein Prozeß der Identitätsfmdung und Selbstdefinition.Die meisten Judenstereotype wurden bereits in der Frühzeit des Christentums formuliert, so beispielsweise jenes, daß die Juden mit dem Satan im Bunde seien und ihr gesamtes Handeln einzig darauf abziele, den Christen Schaden zuzufügen und die Herrschaft über sie zu_erlangen.Die im Mittelalter grassierenden Vorwürfe, die Juden würden die Pest verursachen beziehungsweise Brunnen vergiften, oder die
vor allem im 19. Jahrhundert virulent gewordenen Theorien einer »jüdischen Weltverschwöruiig «, basieren letztlich auf diesem Vorwurf.Die 1905 erstmals erschienenen »Protokolle der Weisen von Zion«
bezeichneten die Juden als Sendboten des Satans und Gefolgsleute des Antichrist.
Freilich darf nicht übersehen werden, daß es bereits innerhalb der Frühkirche stark divergierende Meinungen bezüglich der 'Juden gab.
Die antijüdischen Polemiken der christlichen Literatur hatten auj^rund der Machtlosigkeit der sich nur langsam
entfaltenden kirchlichen Antnrjtfjten vorerst keine realen Konsequenzen.
Diese Situation änderte sich, als unter Kaiser Konstantin (324-337) das Christentum zur Staatsreligion wurde und begann, Einfluß auf die Reichsgesetzgebung zu nehmen; Unter dem Einfluß der Kirche wurdenjuin
sukzessive judenfeindliche Gesetze erlassen, um die Verdammung und Isolation der Juden als »Ungläubige« auch im weltlichen Leben zu demonstrieren und durchzusetzen.
Diese theologische beziehungsweise die daraus resultierende ökonomische und soziale Ausgrenzung der Juden
setzte sich auch in der mittelalterlichen Gesellschaft fort, in der das religiöse und weltliche Leben vom christlichen Dogma durchdrungen war.
Die Reduzierung und Beschränkung der Juden auf ökonomische Sonderfunktionen wie den Geldhandel, ihre soziale Ausgrenzung, die ihnen nur gegen Bezahlung und nur für eine kurze Z^itspgnpe das Wohnen _in^ einer Stadt oder an einem Ort erlaubte und sie ZLL^'nem unsteten Leben zwang, bildeten die Basis für weitere Judenstereotyߣ._ nänilich die des geldgierigen, schachernden beziehungsweise des »heimatlosen « Juden.
Das Bild des »Schacher- und Wucherjuden« wurde in der Neuzeit durch das Bild des Hausierers, des unredlichen Kaufmanns sowie des Rankiers und Börsenspekulanten ergänzt und erweitert;
Das Bild des »ewigen«, »wandernden«
Juden vvürde später dahingehend modifiziert, daß die Juden als »fremde Nation« beziehungsweise als »fremde Rasse« stigmatisiert * wurden Bereits im ersten Jahrtausend hatte die Kirche die meisten der später relevanten
Judenstereotype formuliert
Die Tatsache, daß Juden immer wieder - und zumeist unwidersprochen ~ als Urheber aller Widrigkeiten und Übelstände beschuldigt wurden, trug wesentHch zur Verfesfigung der Judenstereotype bei . Die antisemitischen »Judenbilder« hatten sich - ursprünglich vojnBjJjxhuslanU^
formuliert - bereits im Mittelalter in hohem Aus.- maß im kollektiven Bewußtsein der europäischen Gesellschaft etabliert, so daß sie in Zeiten gesellschaftlicher Krisensituationen gleichsam »auf Abruf« vorhanden waren und eine wohlfeile Erklärung für scheinbar ausweglose und unüberschaubar gewordene Situationen boten.
Im Laufe der Jahrhunderte fand eine Säkularisierung der ursprünglich theologisch motivierten Judenstereotype statt, der christlich-jüdische Antagonismus verschwand immer mehr aus dem Bewußtsein der Menschen und wurde vom ökonomisch, sozial und rassistisch motivierten Antisemitismus überlagert.Der im 19. Jahrhundert aufkommende,sich als Wissenschaft gerierende Rassismus verlieh dem Antisemitismus eine neue
Dimension.Jahrhundertelang tradierte, den Juden kollektiv unterstellte negative Wesenseigenschaften mutierten nun zu angeblich unverrückbaren physischen und psychischen »Rasseeigenschaften«, die ihrerseits als »Erklärungsmuster« für die angebliche »Fremdheit« und »Andersartigkeit « der Juden verwendet w urden.Als letztes »Judenbild« wird in der Ausstellung »der zu vernichtende Jude« erläutert.
Bereits im Mittelalter kam es immer wieder zu grausamen Pogromen.
Im Zeitalter der Aufklärung, als die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden zur Debatte stand, wurden sie von den Gegnern der Emanzipation als Ungeziefer und Abschaum der Menschheit diffamiert und da mit außerhalb der menschlichen Gesell-
Schaft gerückt.Durch den Rassismus erhielt der Antisemitismus eine neue Qualität: der Rassismus griff bereits vorhandene antisemitische BeVorurteile auf und versah sie mit dem Nimbus der »biologischen Wissenschaftlichkeit«.
Juden sind nicht mehr nur »Fremde«, sondern »Fremdrassige« mit angeblieh unwandelbaren, weil »biologisch«
festgeschriebenen »Rasseeigenschaften«.
Trotz der augenscheinlichen Kontinuität erbeziehungshielt der Antisemitismus nach der MachtÜbernahme der Nationalsozialisten eine neue, historisch einmalige Dimension:
Er wurde ein wesentlicher Teil der Staatsideolo^e und mündete schließlich im industrialisierten, systematisch
durchgeführten Massenmord an sechs Millionen europäiAntisemitisschen Juden.
Es wäre falsch, das Phänomen redudes Antisemitismus als eine von der Antike albis zur Gegenwart ablaufende Kausalkette zu verstehen, die gleichsam tolgerichtig in Antisemidie Katastrophe des 20. Jahrhunderts mün dete.
Daß Menschen zu verschiedenen Zei
motiten Wahnvorstellungen hegten, die das gleiche Objekt betrafen, reicht nicht zur Erhe Erhellung von historischen Zusammenhängen oder deren Folgen aus.Eine umfassende Erklärung der Judenverfolgungen des Mittelalters sowie des 20. Jahrhunderts kann hier nicht geleistet werden, sind doch zweifellos die Ereignisse des Mittelalters rnit denen des 20. Jahrhunderts in keiner Weise vergleichbar.
Die Leugner des Holocaust bezeichnen die historisch singulären Massenmorde des Nationalsozialismus als Kriegspropaganda der Siegermächte und als Erfindung einer »jüdischen Weltverschwörung«, mit der »die Juden« die nichtjüdischen Staaten angeblich erpressen und TM
Wiedergutmachiingszahlungen zwingen sollen.
D i e j t e - reotype des »betrügerischen«, »verschwörerischen « Juden erhielten damit nach 1945 eine neue und schreckliche Modifizierung.“
[Elisabeth Klamper Zur Ausstellung »Die Macht der ^Bilder - antisemitische Vorurteile
und Mythen« S. 15-]
|
«Die ursprüngliche Form der Judendiskriminierung schon in der hellenistischen und römischen Antike [sowie bereits im vorhergehenden 'Altertum'; O.G.J.] und sodann seit der frühchristlichen Zeit in den Graden von Abneigung, Feindschaft oder Haß war der 'Antijudaismus', insofern sich diese Diskriminierung gegen Juden als solche gerichtet hat, nämlich als Angehörige einer Schicksalsgemeinschaft, die sich durch eine unverwechselbare religiöse Tradition begründet wußte. Kern des Andersseins und der Fremdheit war der Glaube [sic!] an einen einzigen, unsichtbaren Gott sowie die strikte Einhaltung der von ihm erlassenen Gebote, die bereits sehr früh dem alltäglichen Zusammenleben scharfe Grenzen zogen und mithin auch zu politischen Problemen führen mußten [sic? jedenfalls 'konnten und es – zumal unterm Synchronisierungsparadigma - tataen'; O.G.J.]. Als sich die ['dazu, bis deshalb, maßgeblich werdebde'; O.G.J.] christliche Glaubensgewißheit schließlich immer deutlicher aus der [sic? eher 'aus den'? O.G.J.] traditionellen jüdischen Glaubensgewißheit herauszuentwickeln begann, entstand eine neue Fremdheit, deren Andersheit geradezu den Kern beider Glaubensgewißheiten betraf, nämlich die Identität Jesu im Kontext der alten bzw. neuen Theologie. Mit der Etablierung des Christentums als Staats- bzw. Weltreligion mußten [sic!] sich auch die Grade der Judendiskriminierung verschärfen, insofern sich nun diese ursprünglich sozial-religiöse Negativkonvention zunehmend als multifunktionales Macht- und Herrschaftsinstrumentarium nutzen ließ. Vor allem die frühe religions-politische Etablierung dieser antijudaistischen Negativkonvention innerhalb eines bis heute fortbestehenden Weltchristenums hat deren Handlungs- bzw. Verhaltensprogramm einschließlich des negativen Sanktionsarsenals zweifellos als potentielle 'Universale' tradieren geholfen, aber der alte, ursprüngliche Antijudaismus ist der stets virtuelle Kern jedweder Form der Judendiskriminierung geblieben, und zwar zumeist mit den Graden der Feindschaft oder des Hasses.» [E.R.W. S. 44 f.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] |
|
«"Im
hellenistischen Ägypten und in anderen Mittelmeerländem hatte der Judenhaß
viele Gründe, aber er war nur funktionell", schreibt Manes Sperber:
"Erst im Christianismus wurde er häufig zum totalen Haß, denn da ging es
um die Frage einer beanspruchten, doch bestrittenen Identität. Traten die Juden
nicht zum Christentum über, fuhren sie fort, die göttliche Identität Jesu zu
bestreiten, so bewiesen sie damit nicht nur, daß sie einem Irrtum verfallen
waren, sondern sie spiegelten diesen Irrtum entgegen besserem Wissen vor,
weil sie, Todfeinde des neuen Bundes, die Christen nicht als legitime Erben
des alten Bundes anerkennen wollten." - Der Kirchenvater und
Kirchenheilige Johannes Chrysostomos (354-407), der 'Redner mit dem goldenen
Munde' habe daher den erbarmungslosen Krieg gegen die Juden gepredigt, um die
Legitimität des christlichen Erlösungsanspruchs zu retten: "Die Juden
sollten Jesus als Messias endlich anerkennen oder ausgerottet werden, wenn
sie in ihrer christfeindlichen Verstocktheit zu verharren wagten. Dieser
Priester, der ebenso unversöhnlich wie erfolglos die Paganisierung der Kirche
bekämpfte, war der bedeutendste Initiator des organisierten Hasses gegen die
Juden, der sich aus einer funktioneilen Feindseligkeit in einen totalen Haß
verwandeln sollte. Wer solches Gefühl hegt, bringt es zustande, den Gehaßten
hemmungslos zu verachten und ihn dennoch so maßlos zu überschätzen, als ob
dieser über eine geheime und um so gefahrlichere Macht verfügte." - Seit
dem 9. Jahrhundert gab es Schutzbriefe und Privilegien für die Juden. Aber
"man weiß, daß mit den Kreuzzügen die Epoche des namenlosen Martyriums
begann, eine fast lückenlose Abfolge von Unterdrückung und Leiden, aber auch eines aussichtslosen und dennoch
sirmvollen Widerstandes. -... - Nie vorher waren die Juden ihren Gesetzen so völlig und bedingungslos treu geblieben, nie hatten sie der Lehre so viel Zeit und solch geradezu leidenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet wie in der Diaspora - angesichts einer Welt, in der die Gewißheit, kein Jude zu sein, noch dem verächtlichsten Christen Stolz einflößte und ein unerschütterliches Gefühl der Überiegenheit gegenüber der ganzen Judenheit."(M. Sperber 1979, S. 17f., 50, 23 u. 25; vgl. H. Kühner 1976; L. Poliakov 1979; D.D. Runes 1981; W. Klein 1988; M. Schoch 1988) |
|
"Angesichts des Unfaßlichen - grauenhafte Szenen des Massenselbstmords von Juden im Rheinland, wo unter Einwilligung aller Beteiligten die Männer lieber ihre Frauen und Kinder und dann sich selber mit dem Schlachtermesser töteten, als sich taufen zu lassen - greifen die Kreuzzugschroniken wiederholt nach dem Bild von Abraham auf dem Berg Moria, wenn er bereit ist, Isaak zu schlachten," schreibt Yosef Hayim Jeruschalmi: "Akedá, das 'Binden Isaaks', wird Paradigma und Leitmotiv für diese ganze Literatur und erfüllt für die Generation der Überlebenden eine wichtige Funktion. Dabei sind sich die Chronisten des objektiven Unterschieds natürlich bewußt. Hören wir als Beispiel den Aufschrei Salomo ben Simsons, wenn er vom Schicksal der Juden in Mainz berichtet: 'Denn wer hätte solches je vernommen und dergleichen je gesehen! Fraget doch nach und sehet zu, ob von der Zeit des ersten Menschen an eine so vielfache Opferung (Akedá) je gewesen ist, daß 1100 Opferungen (Akedót) an einem Tage stattfanden, eine jede gleich der Opferung des Isaak, des Sohnes Abrahams. Wegen jener einen Opferung auf dem Berge Moria erbebte die Welt, wie es heißt: 'Die Himmelscharen schrien weithin, und der Himmel verdunkelte sich.' Warum verfinsterte sich nicht auch jetzt der Himmel, warum haben die Sterne ihren Lichtglanz nicht verloren,... als an einem Tage ... 1100 Personen ermordet und hingeschlachtet wurden, darunter so viele Kinder und Säuglinge...! Wirst Du bei diesen schweigen, oh Herr!' - ... - Das berühmte Nürnberger Memorbuch, 1296 begonnen und bis 1392 fortgeführt, enthält neben einem Gedicht zu Bau und Einweihung der Synagoge und einem von hebräischen und altfranzösischen Gedichten begleiteten Verzeichnis der Wohltäter der Gemeinde auch eine Martyrologie, in der die Judenverfolgungen in Deutschland und Frankreich vom ersten Kreuzzug von 1096 bis zur Pest von 1349 aufgeführt sind." (Y.H. Jeruschalmi 1988, S. 50 u. 58; vgl. H.A. Oberman 1981) |
|
"Drei Zahlen" nach Manes Sperber: "Es gab fünf Millionen Juden zu Beginn der christlichen Zeitrechnung, tausend Jahre später waren es nur noch zweieinhalb Millionen, im Jahre 1490 nur eineinhalb Millionen. - Die aschkenasische, das heißt die nordeuropäische, deutsche und französische Judenheit schien zum Untergang verurteilt, doch fand sie Zuflucht und Rettung in Polen. Die ersten Familien siedelten sich dort im Jahre 1264 an, aber die massenhafte Einwanderung begann erst siebzig Jahre später, als König Kasimir der Große die Juden einlud sich in seinem Königreich niederzulassen." (M. Sperber 1979, S. 101; vgl. E.R. Wiehn 1984) - Rund 600 Jahre später hatten die Deutschen ihre ehemaligen Landsleute eingeholt, um ihnen und ihrer Kultur ein mörderisches Ende zu bereiten. - Warum? » [E.R.W. S. 46 f.] |
|
„Die zur Unterscheidung verschiedener Formen der Judenfeindschaft benutzten Begriffe sind teils bekannt, teils noch unbekannte neue Vorschläge, die als solche diskutabel erscheinen mögen oder nicht und also auch wieder zurückgenommen werden können, wenn sich die damit bezeichneten Phänomene anderweitig besser unterscheiden lassen sollten.“ [E.R.W. S. 44] |
|
Antisemitismus als [neuzeitlich] moderne und sozialökonomisch definierte Form [insbesondere seit der bürgerkuchen Judenemazipation des 19. christlich-europäischen Jahrhunderts, im Zusammenhang mit der pseudowisseschaftlichen Rassenlehre von Gobineau und H. St._Chamberiain]. |
«Antisemitismus ist die ebenso späte wie klassische Form der
Judendiskriminierung des christlich-säkularistisclien Bürgertums der
Industriegeselischaft. Der antijudaistische Kern des Antisemitismus erscheint
iiierbei durch ethno-sozialökonomisch-politische Merkmaie überlagert, weil in
einer sich 'entzaubernden' und verweltlichenden Gesellschaft der verbleibende
religiöße Kern das Anderssein einer aufrechtzuerhaltgnden Fremdheit nicht
niehiLbsgriäjden konnte. Im übrigen ist der Antisemitismus zwar vordergründig
auch die scheinbar klassische Form der 'Judendiskriminierung mit Juden', deren
Anwesenheit jedch für ihre [sic?] Genese
keineswegs erforderlich erscheint. Auch der 'Judendiskriminierung mit Juden'
geht Judendiskriminierung als solche vorraus; auch für den Antisemitismus sind
leibhaftige Juden nicht Ursache, sondern nur Gegenstand. Paradoxerweise ist die
Anwesenheit von Juden für alle Grundformen der Judendiskriminierung nur bedingt
wichtig, also weder eine notwendige, noch eine zureichende Voraussetzung, wie
bald noch deutlicher werden mag. Denn vielleicht kann man gerade eben in diesem
Zusammenhang erneut behaupten, daß sich keine einzige Form der
Judendiskriminierung überhaupt in einem direkten negativen Kontakt~mit einem
oder mehreren Juden eatwickelt, sondern_erst durch 'Verabredung_mit anderen' im
Zuge der Aktivierung der Antijudenkonvention. Erst 'danach' kehrt der Akteur
als Judengegner, Judenfeind oder Judenhasser zu 'den Juden' zurück, um seine antijüdische Aktion ins Werk zu setzen, am
liebsten übrigens nicht allein, sondern mit anderen, weil jnan sich nur mit
anderen, d.h. kolleldiv,_der Richtigkeit der Negativkonvention verssichem kann,
- und wenn man es dabei mit mehreren Juden zu tun hat, entgeht man noch am
ehesten dem Risiko, in__einem einzelnen Juden_plötzlich einen Mitmenschen oder
gar sich selbst_zu erkennen. Gerade beim Antisemitismus als
Judendiskriminierung mit Juden ist also der Plural wichtig und natürlich [sic? 'logischerweise';
O.G.J.] auch zumindgst die Möglichkeit der Anwesenheit leibhaftiger
Juden. Die Konvention der Judendiskriminierung scheint wie jede Konvention,
zumindest von Zeit zu Zeit ihrer konkreten Exekution zu bedürfen, um ihre
virtuelle Gültigkeit aktuell unter Beweis zu stekken und dadürch zu bestärken.
Schalom
Ben-Chorin weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das Phänomen
''mythischer Archetypen'' hin, und überaus typisch für die Unwirklichkeit des
"mythischen Juden" erscheinen ihm 'Ahasver' und 'Shylock'; denn beide
Namen seien völlig unjjüdisch: "Ahasver, der ewige Jude, der auf eine
Mißdeutung von Matthäus 16,28 zurückgeht, trägt den Namen des Perserkönjfls aus
49
dem Esther-Buche, der in dieser biblischen Legende als Gegenspieler des Juden Mordechai erscheint. - Der Name Ahasver oder Ahasverus ist niemals bei Juden vorgekommen, wird aber in der antisemitischen Legende zum Inbegriff des Juden schlechthin. ... Das zeigt, wie solche Sicht des Juden aus einem abgrundtiefen Fremdheitsgefühl der Erzähler zur Verfremdung des Juden geführt hat." - Auch der Name 'Shylock', den es bei Juden nie gegeben habe, erweise das aus der Fremdheit geborene Phantasiegebilde, das aber stärker als die Wirklichkeit wirke (S. Ben-Chorin 1988, S. 112; vgl. dazu D.D. Runes 1981, S. 257; M . Horkheimer 1963).
Inzwischen_gjbt_es
übrigens andere Formen von Phantasiegebilden, wie die folgende aktuelle
Angelegenheit zeigt: Als Direktoriumsvorsitzender des Zentralrats der Juden in
Deutschland und als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wandte sich
Heinz Galinski vor kurzem mit einem Schreiben an die Berliner
Bürgermeisterin
und Senatorin für Schulwesen, Berufsausbildung und Sport, Dr. Hanna-Renate
Laurien, sowie an den Senator für Justiz, Ludwig A. Rehlinger, berichtet die in
Bonn erscheinende 'Allgemeine jüdische Wochenzeitung' am 16.12.1988: "Des
öfteren brachte ich in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit meine
Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß die Aktivitäten der Rechtsradikalen vor
allem an den Schulen keineswegs nachlassen, sondern vielmehr neue
Tätigkeitsgebiete erschließen. Das mehr als ärgerliche und gefährliche
Zeugnis davon legt der andauernde Handel mit Computer-Disketten sowie Video- und Tonbandkassetten rechtsradikalen und neonazistischen Inhalts auf den Schulhöfen ab. Auch massive Störungen des schulischen Ablaufs, insbesondere der Schulfeiern durch Skinheads und andere, der rechtsextremen Szene zuzurechnenden Gruppen häuften sich in der letzten Zeit. ... Sie wissen, wie sehr mir und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin daran liegt, gegen diese, unsere Demokratie bedrohende Helzpropaganda der Unbelehrbaren energisch vorzugehen. ... Ich würde eine Gelegenheit begrüßen, diesen unerfreulichen Themenkomplex mit Ihnen persönlich zu_erörtem, damit gemeinsam nach Wegen gesucht werden kann, die Atmosphäre in den Berliner Schulen zu verbessern." (Allgemeine jüdische Wochenzeitung, 16.12.1988, S. 13)
"Trotz
einiger 'antisemitischer Blitze', die wir zur Zeit am Himmel der Schweiz mit
Sorge betrachten, haben sich die Zustände seit dem Holocaust und seit der
Gründung des Staates Israel grundlegend geändert", schreibt Erich
Goldschmidt am 15.12.1988 in der Baseler 'Jüdischen Rundschau Maccabi'. Die
Kirchen und die Behörden hätten umgelernt; aber christliche Redner betonten,
"daß aufgrund
50
ihrer täglichen Erfahrung ein latenter Antisemitismus auch in der Schweiz nicht ausgestorben ist und jederzeit wieder virulent werden kann. Die Gründe seien Neid, Jjnwissenheit, Primitivität, Fremdenhaß, ausländische Hetzschriften , zumeist aus den USA, wie auch lügenhafte Behauptungen." (E. Göldschmidt, 15.12.1988, S. 2) '
Soviel hier zu aktuellen Aspekten des alten Problems im Jahre 1988
unter seinem passenden Namen oder nicht, das einschlägige Handlungs- und
Verhaltensprogramm ist lange schon vorbereitet und gründlich erprobt: "Die
säkularisierten Antisemiten_...
ersetzten mühelos die traditionelle religiöse Begründung ihres Judenhasses
durch eine rassistisch, national oder sozial begründete Ideologie. 'Die Gründe
des Hasses erschöpfen sich niemals; die von ihm inspirierten Taten und deren
unvermeidliche Folgen vermehren im Gegenteil beinahe täglich seine
Vorwändeund_Gründg... Der Mensch, der gehaßt wird, vermag nichts gegen den
totalen Haß. Es ist nicht einmal sicher, daß dieser erlöschen würde, wenn sein
Opfer sich selbst vernichtete.' -... - So geschah's auf christlicher Erde zum
ersten Male, daß man sich rüstete, Juden in Massen zu töten - ohne Berufung auf
den
Gekreuzigten. Und zum ersten Mal sollten die Juden Europas für nichts,
im Namen von nichts sterben." (M. Sperber 1979, S. 53, 66, 26; vgl. H.A.
Strauss u. N. Kampe 1984; D. Claussen 1987»
[E.R.W. S. 48- 48-50]
|
Antimosaismus als neuere deutsche und nationalsozialistisch-rassistische Form; |
«'Antimosaismus' steht hier für die neuere und spezifisch deutsche, nationalsozialistisch-rassistisch-völkische Form der Judendiskriminierung, bei welcher der ursprüngliche antijjudaistische Kern samt den antisemitischen ethno-sozialökonomisch-politischen Überlagerungen nun noch durch sogenannte 'rassisch-yöJkische' Merkmale überhöht und damit gleichzeitig potenziert werden. Dieser Antimosaismus bezieht seinen Namen über das damals sogenannte 'mosaische Bekerintnis' bzw. die 'mosajsche Herkunft', wie er auch in den Zwangsnamen Israel' und 'Sara' zum Ausdruck kommen mochte. - Der Antimosaismus war zunächst eine 'Judendiskriminieimg mit Juden', die sich bald über den Grad der Feindschaft zum Haß, zum tödlichen Haß und zur Vernichtung steigern sollte, um somit zur 'Judenfreiheit' bzw. 'Judenreinheit' zu führen. - Während nun Feindschaft und Haß durch eine starke emotionale Note gekennzeichnet sind, zeichnet sich hingegen das Handlungsprogramm der 'Sonderbehandlung'^, d.h. der Vernichtung durch eine prinzipielle Emotionslosigkeit aus, und zwar offenbar sowohl bei den 'Schreibtischtätern' wie auch bei den professionellen Exekutoren. Hier_ist der generalisierte Fremde in seinem Anderssein sogar über jede Dämonisierung hinaus bis zu einem Grade 'versachlicht', also 'entmenscht' und zur Sache geworden, daß er als der 'total Andere' erscheint, dehumanisiert, semi- und subhumanisiert, zur Vernichtung prä- und determiniert. - Insofern ist der Antimosaismus eine Art Übergangsform der Judendiskriminierung, nämlich einer Form mit zu einer Form ohne Juden, und zwar eigentlich schon während sie teilweise noch leibhaftig vorhanden sind, da das Negativbild der Juden nun 'tatsächlich' überhaupt keinerlei Ähnlichkeit mehr mit irgendwelchen konkreten Juden aufweist. - Und waren seinerzeit zunächst übrigens 'Fremdartigkeit' und 'Materialismus' wichtige Merkmale der nationalsozialistischen Antijudenkonvention, so kam für Hitler später das Argument des 'jüdischen Internationalisnius' hinzu; aber schon früh hatte er sich zahlreicher Ausdrücke aus dem Bereich der Parasitologie bedient und bekanntlich noch ganz am Ende "zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum" aufgefordert (vgl. E. Jäckel 1981; dazu A. Schickedanz 1927; R.N. Coudenhove-Kalergi 1935).
"Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen
letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen (sic). Der Ant€ der Vernunft
jedoch muß führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung
der Vorrechte des Juden, die er zum
Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt
(Fremdengesetzgebung). Sein letztes Ziel aber muß unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein." - So
Adolf Hitler^ nach Eberhard Jäckel bereits am 16.9.2020. - In 'Mein Kampf hieß
es etwas später: "Mit_den Juden
gibt es kein Paktieren, sondern nur das harte Entweder-Oder. Ich aber beschloß nun, Politiker zu werden." Und
"So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem
ich mich der Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn." - Am 30.
Januar 1939 hatte Hitler - wieder nach Eberhard Jäckel zitiert - dann feierlich
und öffentlich vor dem Großdeutschen Reichstag in Berlin erklärt: "Ich
will heute wieder ein Prophet sein: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum
inner- und außerhalb Europas gelingen sollte,
die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis
nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums
sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa." Das Protokoll, so Eberhard Jäckel, habe an dieser Stelle vermerkt: "Anhaltender stürmischer Beifall." (E. Jäckel 1981, S. 55, 63, 72, 75; vgl. C.-E. Barsch 1988, S. 40; S. Haffner 1978, S. 172ff.; M. Postone 1988)
"Doch es haben sich für Deutschland keinerlei Vorteile finden
lassen, die sich aus der Vertreibung und Vernichtung des deutschen Judentums ergeben
haben könnten, nicht einmal die höchst fraglichen, die sich Antisemiten erhofft
hatten, geschweige denn andere, die
sich aus heutiger Sicht und so objektiv wie möglich betrachtet, emstlich als
solche bezeichnen ließen", fand Bemt Engelmann in seiner umfangreichen Schrift Deutschland ohne
Juden'. Der einzige Vorteil der großen Judenverfolgung der dreißiger und frühen
vierziger Jahre, die erheblich beschleunigte Staatwerdung Israels, liege
eindeutig nicht auf seiten der Verfolger: "Die totale Ausplünderung und
Versklavung von Millionen hat nämlich gar nichts erbracht, außer den tiefen
Abscheu der zivilisierten Menschheit. Und daß einzelne Mitbürger noch heute
davon profitierren, daß sie damals, bei dem großen Ausverkauf, gierig zugegriffen haben, kann sich in der
volkswirtschaftlichen Gesarntrechnung nicht als Gewinn auswirken, belastet nur
das moralische Konto des einen oder anderen Nachfolgestaates, was aber
angesichts der Höhe des Debetsaldos kaum noch zu Buche schlägt... - Nein,
die_nahezu totale Vernichtung_des Judentums im gesamten einstigen Machtbereich
der nationalsozialistischen
Fühmng
hat, wie man es auch betrachtet, keinerlei Gewinn gebracht, nicht einmal jene
fragwürdigen Vorteile, die sich eingefleischte Judenhasser davon erhofften. Wie
aber steht es mit den Verlusten und Nachteilen? -... - Unvergleichlich
viel größer ist der Verlust, der den deutschen Nachfolgestaaten dadurch
entstanden ist... - ... - Kein Versuch, die
tatsächlichen Verluste für Deutschland zu ermitteln, die durch die Judenvertreibung
und -vemichtung entstanden sind, kann sie so deutlich machen wie ein Vergleich
zwischen dem kulturellen Niveau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und dem in
den deutschen Kleinstaaten von heute. Und das Schlimmste ist", so Bemt
Engelmann: "Die Bürger scheinen gar nichts zu vermissen..." (B.
Engelmann 1979/81, S. 409ff.). - Wamm?» [E.R.W.
S. 50-52; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
|
Antihebraismus als Form der Judenfeindschaft ohne Juden; |
«'Antihebraismus' soll hier heißen die typische Form der
'Judendiskriminiemng ohne Juden', das meint zunächst nur 'ohne leibhaftige
J^den', und dieser funktioniert 'natürlich' genau so lange, wie die Antijudenjconvention
gültig ist, insofern sich das Handlungsprogramm samt seinem Sanktionsarsenal ja
eben gegen den generalisierten Fremden richtet, und zwar ganz unabhängig davon,
ob er real existiert oder nicht. Sobald das Handlungs- oder gar Verhaltensprogramm
der Negativkonvention durch ein geeignetes Signal - z.B. ein Bild, Symbol- oder
Wort - ausgelöst wird, scheint es tatsächlich zwangsläufig abzulaufen, eben
weil es sich um hochgradig konditioniertes Verhalten handelt, so wie beim
Pawlowschen Hund, der automatisch Speichel absondert, sobald die berühmte
Glocke ertönt. - Im Zusammenhang mit der Abwesenheit leibhaftiger Juden sind
nun zwei Situationen zu unterscheiden, nämlich eienseits eine Situation, in der
auch die Vergangenheit kaum Juden aufwies; hier hat die Judendiskriminierung
ohne Juden kaum eine Chance. Die besten Chancen bat Judendiskriminierung ohne
Juden in einer sozialhistorischen Situation, in der die Erinnerung an
leibhaftige Juden durchaus noch ebenso lebendig ist wie an ihre gewaltsame Vertreibung
und Vemichtung. In diesem Fall kann sich Ahneignng, Feindschaft und Haß nun
gerade auf die getöteten und toten Juden richten, vor allem weil sie als Tote
nicht sterben wollen und zusammen mit den
Überlebenden somit den unvollkommen gelungenen Massenmord symbolisieren, ewig
zwischen Tätem und Opfern diskriminierend stets das Verbrechen manifestieren
und unangreifbare Überlegenheit symbolisieren. - Das war und ist ziemlich genau
die typische Situation der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und Österreichs,
entfernte Parallelen finden sich auch in Frankreich, Polen und der
Tschechoslowakei. Was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, so wurde die
hier zu erwartende Judendiskriminierung - Abneigung, Feindschaft, Haß - auch
ohne Juden lange Zeit wahrscheinlich durch ein starkes Tabu überdeckt, das
inzwischen jedoch zunehmend an Kraft eingebüßt hat, weshalb in vieler Hinsich^
mit weiterer sogenannter 'Normalisierung' zu rechnen ist. - Antihebraismus als
Judendiskriminierung
ohne
Juden ist vor allem die Judenfeindschaft des schlechten Gewissens, ist die
klassische Form der Post-Holocaust-Judenfeindschaft, evtl. auch allgemein der
Post-Pogrom-Judenfeindschaft (vgl. A. Silbermann u. J.H. Schoeps 1986).
Antimosaismus als Judenfeindchaft ohne Juden heißt wohlgemerkt lediglich ohne leibhaftige Juden, was die soziale Wirksamkeit der 'unsterblich' toten Juden nur um so wichtiger erscheinen läßt und im übrigen eine Verstärkung durch etwaige lebendige Juden wahrscheinlich macht, insofem diese als Überlebende geradezu die Gestalt von 'wiederauferstandenen' Rückkehrern annehmen können. Deshalb wurde für diese Form der Judenfeindschaft hier die Bezeichnung 'Antihebraismus' gewählt, worin der alte Name der 'Hebräer' steckt, der sich von Abraham 'ha-Ibri' herleitet, d.h. Abraham 'der Grenzgänger'. Die toten Juden sind eine Art 'Grenzgänger', sind und bleiben 'die Grenzgänger der Zeitgeschichte'.
"Der Toten Rückkehr", nach Gerhard
Zwerenz: "Die toten Juden erheben sich aus den Massengräbem und Aschefeldem...
Eben sahen wir sie noch in langen schweigsamen Reihen Richtung Gaskammer
marschieren. Kaum wurden die Tore hinter den Opfern geschlossen, sprengt eine
unbekannte, gewaltige Kraft sie wieder auf, und die nackten Leichen schnellen,
mit dem Rücken voran, auf die Vorplätze, in die Schuppen der Gefangenenlager,
es wirft sie zurück in die Eisenbahnwaggons, deren rauchzeichenhafte Loks die
Fracht rückwärts stoßen, heim ins
Reich... - Es fehlt überall an Waggons, zumal aus Gründen der Pietät nicht wie
beim früheren Abtransport Güterwagen benutzt werden. Nein, die Rückreise soll
in menschenwürdigen Personenzügen erfolgen, laut ausdrücklicher Anweisung der
zuständigen Behörden, Abteilung Rückkehr ins Leben. ... - Es kehren Gespenster
nach Haus, murmelt die Menge, die sich an den Geleisen, auf Brücken und in
Bahnhöfen versammelt. - ... - Die Rückkehrer mustern die Fassaden der Gebäude,
in denen Ratlosigkeit herrscht, weil die Immobilien anderen Besitzern gehören
und die verlassenen Wohnungen nicht verlassen geblieben sind. - Macht auf,
drängen die ankommenden Heimkehrer, wir sind es, wir stehen vor der Tür, macht
auf! - . . . -... die Beamten sind verzweifelt, die Politiker fürchten
Überfremdung, das Parlament tagt pausenlos und findet_.keine rechtliche Lösung
des Rückkehrerstroms. Da hat man nun achtzig_Milliarden ausgegeben für
Wiedergutmachung, hat Wochen der Brüderlichkeit veranstaltet, sich in allen
Ländern der Erde um_die Hebung von Image und Ansehen bemüht, und jetzt diese
unvorhersehbare, massenhafte, anarchisch-verquere Rückkehr der Toten, wohin
soll das führen? Hat man das verdient und womit? Und weshalb gehen sie nicht
nach drüben in die DDR? Warum gerade zu uns, wo doch aus aller Herren Länder
welche bei uns um Asyl nachsuchen? - ... - Die Regierung tagt pausenlos. Sechs
Mllionen tote Juden verlangen Asyl in Deutschland und
begründen ihren Anspruch mit der erlittenen Verfolgung durch die deutsche Hand. Daran scheiden sich die Geister. Die Frage ist: Der deutsche Tod – reicht das fürs Asylgesuch aus?“ (G. Zwerenz 1986, S. 150ff.)
"Als
der Zug das erste Mal anhielt, wurden die hinteren Waggons, in denen sich die
Frauen und Kinder, also auch meine Mutter und meine Schwester befanden,
abgekoppelt", erinnert sich Samuel Pisar: "Sie entschwanden im
morgendlichen Dunst in einer friedlichen grünen Landschaft, in der es einen
gewaltigen Eisenbahnknotenpunkt mit einem primitiven Schild gab:
Treblinka." - Und "Wer hätte sich vorstellen können, daß diese wie
Vieh behandelten Menschen, diese armseligen, ohnmächtigen Jammergestalten den
strahlendsten aller postumen Siege vorbereiteten? - Diese Schatten ohne
Grabmal, diese Opfer des größten Massenniordes
in der Geschichte, appellieren noch heute und bis in alle Ewigkeit an diejenigen, die ihre
Pflicht, Mensch zu sein, immer noch versäumen: die Demokraten, weil sie zu
lasch, die Totalitären, weil sie verblendet sind. - Die Opfer
haben damals den Staat Israel geschaffen. Sie haben ihn bevölkert, bewaffnet, verteidigt. - Als ich 1967 eines Abends nach Hause kam, in meine Pariser Wohnung, sah ich das unglaubliche, unvorstellbare Ereignis im Femsehen: die Befreiung der Klagemauer in Jerusalem. Ich sah die israelischen Soldaten, die am Fuße dieses Heiligtums, dieses Symbols von soviel Leid und Hoffnung, beteten. - Plötzlich brach ich, der ich mich sonst immer in der Gewalt habe, in Tränen aus.- Die Erinnemng an das, was ich erlebt hatte, und die tausendjährigen Erinnerungen des Volkes, dem ich angehörte, hatten in einem Gefühl Ausdruck gefunden, das mich übermannte. Ja, an diesem Tag hatten die Züge nach Treblinka, nach Majdanek und nach Auschwitz endlich ihr wahres Ziel erreicht." (S. Pisar 1979, S. 48f.)
"Ein Genozid gelingt jedoch fast nie_soJotal, wie ihn Despoten seit undenklichen Zeiten geplant haben und planen. Daher lebt das jüdische Volk noch immer, seine Vitalität ist unvermindert und so fruchtbar wie nje. Der Staat Israel stellt ein neues Faktum unbestreitbarer Bedeutung dar: Löst er zwar nicht die Judenfrage, setzt er zwar der Diaspora kein Ende, so ist er doch das Ergebnis eines neuen Beginnens - Israel ist Heimat und Asyl. Dank diesem kleinen, bedrohten Staat wird es nirgends mehr so leicht sein, Juden zu morden." Und "Israel ist ein Staat wie die anderen auch, nicht das Gemeinwesen eines eines auserwählten Volkes: er darf es gar nicht sein, soll er dauem. Nein, die Nachfahren der Toten von Belzec, Majdanek und Auschwitz haben nicht mehr das Recht.Lämmer zu sein - es sei denn: Lämmer mit stählernen Gebissen." (M. Sperber 1979, S. 41 u. 96) - Wamm?!» [E.R.W. S. 52-55; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
|
Antizionismus als neuere und [isbesondere] links-politisch-ökonomische Form [zumal auch der DDR fast bis zum Ende des SED-Saates]; |
«Antizionismus ist eine neuere Form der Judendiskriminiemng, die
parallel mit Antisemitismus, Antimosaismus
und Antihebraismus 'mit oder ohne JüHen' in
Erscheinung tritt, ohne sich explizit auf Juden beziehen zu dürfen, wofür dem
verbleibenden antijudaistischen Kern der
Konvention vor allem ein idedogisch-politisches Merkmal angehängt bzw. zugefügt
wird. Der Antizionismus hat sich mit der zionistischen Beweguiig seit dem Ende
des 19.Jahrhunderts entwickelt, und zwar sogar mit einer – freilich nicht
judenfeindlichen – jüdischen Vanante, die gerade heute eher wieder verstärkt in
kleinen orthodox-religiösen Kreisen Amerikas zu finden ist. In der
nichtjüdischen Welt und vor dem Zweiten Weltkrieg schon wurden 'Zionist' und
'Zionismus' zu Schimpfworten in einem Milieu, in dem AntiJudaismus
oder Antisemitismus nicht zum guten Ton gehörten, und zwar
mit Bezug auf Juden, die zur Assimilation_oder Orthodoxie nicht bereit waren
und insofern die alte Negativkonvention auszulösen besonders geeignet
erechienen. - Der spätere Antizionismus hat von vornherein die alte
Judenfeindschaft nie ganz überdecken können, auch wenn bereits in den ersten 30
Jahren der Existenz des Staates Israel - um mit einer Metapher zu sprechen –
aus dem antizionistischen Mäntelchen ein stattlicher Mantel geworden war, der
durch die antizionistische UNO-Resolution des Jahres 1975 sogar ein
beachtliches
Markenzeichen erhielt und damit gleichsam als Konfektionsware in alle
Welt geliefert werden konnte. Fortan war Zionismus mit Imperialismus,
Kolonialismus und Kapitalismus etc. schlechthin gleichgesetzt - worin fast alle
bekannten Merkmale der Judendiskriminierung wieder versammelt erscheinen - und
auf internationaler staatlicher Ebene salonfähig, d.h. jetzt endlich
'paraleme'- und 'regierungsfähig' gemacht. - Der Antizionismus entwickelte sich
nun insbesondere als die klassische Form der Judenfeindschaft der
intellektuellen und polilischen Linken - Personen, Gruppierungen, Parteien,
Staaten-, womit sich nun vermeintlich dem Antisemitismusverdacht
entgehen ließ, um gleichzeitig dem Antiisraelismus
als neuester Form der Judenfeindschaft den Weg zu bereiten, nachdem aus Israel
als dem Staat der Juden 'der Jude unter den Staaten'
geworden war.
Nicht mehr der Jude werde abgelehnt, der als jüdischer Deutscher etwa in der Bundesrepublik leben wolle, sondern der Israeli, der im eigenen Lande als nationaler Jude den Staat Israel mit aufbaue und verteidige, so Schalom Ben-Chorin: Schon in der Zeit der Aufklärung galt die Devise: "Den Juden als Menschen alles, den Juden als Nation nichts "Der Jude in der Diasgora, der sich lange Zeit wehrlos dem Martxrium habe überlassen müssen, sei als feige verschrien worden; der Jude, der sich im Lande und Staate Israel gegenüber einer ungeheuren arabischen Übermacht erfolgreich verteidigt habe, gelte_als aggressiver^Militarist: "Wie immer sich der Jude verhält, bleibt er Zielscheibe des Judenhasses." (S. Ben-Chorin 1988, S. 106f.)
"Die antizionktische Leidenschaft der jüngeren deutschen Generation, die Verbrechen selbst noch nicht begehen konnte, ja zu ihrer Zeit nicht einmal geboren war, gelangte zur Hochblüte, als im Jahr 1967 die Welt - 20 Jahre nach dem gescheiterten Ausrottungskrieg vom 30. November 1947 (Beginn des Terrors der el Husseini-Einheiten) bis zum 20. Juli 1949 (Waffenstillstand mit Syrien) – einem weiteren Krieg gegen Israel zusieht... Bei 21 arabischen Nationen mit weit über hundert Millionen Einwohnern scheint aber alles dafür zu sprechen, daß man sie doch leicht ums Leben bringen werde. Diese Selbstgewißheit läßt den Führer der PLO, Achmed Schukeiri, sogar eine gewisse Generosität an den Tag legen, als er am 1. Juni 1967 erklärt: 'Die Juden müssen Palästina verlassen. Wir werden ihnen die Rückkehr in ihre frühere Heimat erleichtem. Die ursprüngliche jüdische Bevölkerung Palästinas kann, sofern sie überlebt, bleiben. Aber ich glaube, daß niemand von ihnen überlebt.' Bereits am 27. Mai 1967 hatte Gamal Abdel Nasser, Präsident Ägyptens, der Welt mitgeteilt: 'Unser Hauptziel wird die Zerstömng Israels sein.' Jordanien denkt nicht anders und greift in den Krieg ein. Ein weiteres Mal aber klaffen Austilgungsprogramm und Durchfühmngsfähigkeit auseinander... Aber es bleibt für unsere Analyse wichtig, daß den Antizionisten die militärische Fähigkeit Israels, seiner Ausrottung bisher zu entkommen, als schlimmster Militarismus erscheint. - ... Die arabischen Nationen verkünden am 1. September 1967 ihr bis heute im wesentlichen gültiges Programm, 'keine Anerkennung, keine Verhandlung, keinen Frieden!'" (G. Heinsohn, 7.11.1988, S. 8)
"Die Antizionisten aber folgen Jassir Arafat. Sein Vorhaben
lautet: 'Das Ziel unsres Kampfes besteht darin, das Ende Israels
herbeizuführen. Und da gibt es keinerlei Kompromisse.' Auch für seine
pazifistischen Anhänger findet Arafat eine mögliche Skrupel einlullende Formel:
'Friede heißt für uns Zerstörung Israelis. Wir stellen uns auf einen totalen
Krieg ein, der Generationen Jiindurch dauem wird... Wir werden nicht ruhen bis
zu dem Tag, an dem wir in unsere Heimat zurückkehren und an dem Israel vernichtet
wird.' ... 'Der Zermürbungskrieg gegen den zionistischen Feind wird niemals
aufhören... Es liegt in meinem Interesse, in diesem Gebiet den Krieg andauem zu
lassen, weil ich glaube, daß das
einzige Heilmittel für die Leiden der arabischen Nation in einem wirklichen
Krieg gegen den zionistischen Feind besteht.'... Der Antizionismus - soviel wird deutlich - erweist sich nicht als Reaktion auf das Schicksal von Arabem, sondem als Beteiligung an einem heute salonfähigen Angriff auf Juden, die Israel nicht seinem Schicksal überlassen wollen, also auf fast alle Juden dieser Erde." (G. Heinsohn, 7.11.1988, S. 8)
Daß der Antizionismus nur ein weiterer Mantel des AntiJudaismus war, der sogar eher 'des Kaisers neuen
Kleidem' glich, wurde 1975_nicht nur durch die Kritik der
UNO-Antizionismus-Resolution klar, sondem mehr noch 1978 durch den
überraschenden Friedensschluß Menachem Begins und Anwar el Sadats, Ägyptens und
Israels, der den jahrelang gepflegten Antizionismus auf einem seiner Höhepunkte
seines Aufhängers zu berauben schien und für einen Augenblick in sich
zusammenfallen ließ, um dann - nur gewendet - erneut der Welt präsentiert zu
werden, nun freilich in der neuesten Mode des Antiisraelismus,
- oder um eine ganz andere Metapher zu verwenden: Eine bekannte Fontäne in den
neuen Farben des Antiisraelismus aus der alten
Quelle des AntiJudaismus. - Warum?» [E.R.W.
S. 55-58; verlinkende Hervirhebungen O.G.J.]
|
Antiisraelismus schließlich als neueste, internationale politische [namentlich den - seit 1948 im Nahen Osten aufgerichteten – heutige Staat Israel meinendel Form. |
«'Antiisraelismus' ist die bislang emanzigjerteste Form des Antijudaismus, die schon mit dem Namen Israel' auf 'den Juden unter den Völkern' zielt und damit den antijudaistischen Kern aller Judendiskriminiemng besonders deutlich zutage treten läßt. Antiisraelismus ist die neueste und verbindlichste Form sich politisch gerierender Judenfeindschaft, die Vertreter nun sämtlicher politischer Lager miteinander verbinden kann und insofem ein beachtliches integratives Medium, dessen Potential gar nicht überschätzt werden kann.
Das heftige Interesse an der Zurückweisung von Schuldgefühlen für den
Judenmord, bei dem man doch mitgemacht habe, äußere sich als rastlose Suche
nach schuldigen Juden, argumentiert Gunnar Heinsohn: "Da sie am ehesten jm
verstrickten Israel gefunden werden,
wird gerade ihm daraus entschlossen ein Strick gedreht. Der Antizionist kann jüdische Bedrohung in Nahost nicht
wahrnehmen, weil er jüdische Bedroher benötigt, um die eigene Bedrohtheit fürs
Schuldiggesprochensein am Judenmörd abwehren zu können. - ... Für den Antizionisten
werden die arabischen Gegner Israels zum Rächer. Er betrachtet die Austilgung, welche an den Juden Israels vorgenommen werden soll, als gerechte Strafe ffir Leute, die für sein ungerechtfertigtes Schuldgefühl verantwortlich und doch selber nicht besser seien als die damals wirklich schuldig Gewordenen." Und "Der Antizionismus liegt heute wie ein Schutzmantel über dem Antisemitismus. Die ihm innewohnende Wut auf Juden lähmt ihn bei der Bekämpfung des traditionellen Judenhasses, aus dessen Nichtüberwindung nach 1945 er entstanden ist. Der Antizionismus ist also ein Geschöpf des Antisemitismus und könnte mit ihm ununterscheidbar verschmelzen..." (G. Heinsohn 1988, S. 8), - wenn er nicht längst schon mit ihm verschmolzen ist.
Antiisraelismus
ist die Judenfeindschaft derft der Pragmatiker quer durch alle Parteien und
Staaten, die kraft ihrer an sogenannten Friedensinteressen ausgerichteten
Politik nun gerade nach der PLO-Staatsdeklaration von Algier in Israel das
einzige Hindemis sehen, das einer Befriedung des Nahen Ostens noch im Wege
steht. So hatte etwa Bundesbildungsminister Jürgen Möllemann bereits am
I6.11.l988 gefordert, daß der soeben in Algier proklamierte palästinensische
Staat mit einer Hauptstadt Jerusalem seitens der Bundesrepublik Deutschland in
Verbindung mit dem Selbstbestimmungsrecht "logischerweise" sofort
anerkannt werden müsse, in diesem Zusammenhang überdies den Staat Israel
wörtlich als "Friedenshindemis" im Nahen Osten bezeichnet, die
offizielle israelische Ablehnung des Inhalts der Rede Arafats vom 13.12.1988 in
Genf laut Rundfunknachrichten
vom 14.12.1988 "borniert", d.h. nach Duden "geistig beschränkt" genannt. - Gerade in diesem Kontext ist auch der stenographische Bericht der 102. Sitzung des Deutschen Bundestags vom Mittwoch, 26.10.1988, lesenswert, worin nämlich die Debatte über den Verkauf von acht Kampffluszeugen MRCA Tomado seitens des Vereinigten Königreichs an das Königreich Jordanien sowie deren Finanzierung durch die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau dokumentiert ist (Plenarprotokoll 11/102 S. 6987-7003). - ("Wenn es dem internationalen Finanzjudentum innerhalb und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht..." - Vgl. Abschnitt 6.3. - Wer sagte das noch? Wer denkt das heute noch oder wieder? - Pardon, hier scheiden sich abermals die Geister...)
"Zentralrat gegen Dönhoff", lautete eine dpa-Meldung am 15.12.1988 im 'Südkurier' (Konstanz): "Einen 'Mangel an Sensibilität' gegenüber Themen zur Politik Israels und des deutsch-jüdischen Verhältnisses hat der Zentralrat der Juden in Deutschland der Herausgeberin der Hamburger Wochenzeitung 'Die Zeit', Marion Gräfin Dönhoff, vorgeworfen. Die Publizistin, der in Düsseldorf der Heine-Preis der Stadt verliehen worden war, habe es in ihrer Dankesrede an Ausgewogenheit und einer 'behutsameren Behandlung' dieser Themen mangeln lassen, hieß es in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Erklämng des Zentralrates. Ein Mitglied des Direktoriums hatte nach den kritisierten Passagen den Düsseldorfer Ratssaal verlassen. - Gräfin Dönhoff hatte kritisiert, daß es 'bei den Freunden Israels' weder 'zu einem Aufstand, noch zur Entrüstung^^omme, wenn bei den Unruhen in^den besetzten Gebieten 'Woche für Woche ein halbes Dutzend Palästinenser', darunter Kinder und Jugendliche, den Tod finde. Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa würden hingegen angeprangert. In ihrer 'gefühlsbetonten Ausdmcksweise', so der Zentralrat, habe es der Preisträgerin an Ausgewogenheit gemangelt, die sie für ihr Blatt in Anspmch nehme. - Allerdings habe es bei den von Gräfin Dönhoff geschilderten Pro- und Contra-Berichten zum umstrittenen Faßbinder-Stück dieser Ausgewogenheit nicht bedurft. denn 'in bezug auf Antisemitismus und Rassismus' verliere sie ihre Gültigkeit. Auf Unverständnis' muß nach Meinung des Zentralrates das 'Bedürfnis' der Preisträgerin stoßen, in zwei 'völlig zusammenhanglosen Beispielen jeweils die jüdische Seite als die negative herauszustellen'. Dieser Mangel an Sensibilität der Publizistin sei auch deswegen befremdlich, da Heine als Namensgeber des Preises 'ein hervorragender Vertreter des deutschen Judentums' war." (Südkurier, 15.12.1988, S. 6)
Die Gräfin hatte übrigens kaum mehr als drei Jahre nach dem Ende des Holocaust und etwas mehr als vier Monate nach der Gründung des Staates Israel, zu einer Zeit also, als dessen erster Überlebenskampf gerade noch im Gange war, nämlich im September 1948, in ihrer Zeitung einen Artikel über 'Völkischer Ordensstaat Israel' veröffentlicht, worin von der "jüdischen Regierung" die Rede ist, die in "modemer Form 'Kolonisierung'" betreibe sowie mit Bezug auf eine der Untergrundorganisationen von einer "merkwürdigen Zwiegesichtigkeit", einer "Mischung von Romantik und Brutalität, von religiösem Ethos und politischer Zweckmäßigkeit, von Zynismus und 'völkischem' Idealismus. All das kennen wir in Deutschland zur Genüge aus der Zeit der Fememorde bis zu den Ordensburgen Adolf Hitlers." Ein jüdischer Untergrundführer wird mit einem "Ordensjunker" verglichen, die Bürger_dieses Staates seien "ohnehin" von "krankhaftem Nationalismus erfüllt". Man könne nur hoffen, daß der Schock, den der Tod des Grafen Bemadotte für die verantwortlichen Männer der Regiemng Israels bedeute, "sie für einen Moment wenigstens innehalten und bestürzt erkennen läßt, wie weit sie auf jenem Wege bereits gelangt sind, der erst vor kurzem ein anderes Volk ins Verhängnis geführt hat". - Dieser Artikel mit all seinen atemberaubenden Vergleichen wurde ohne jeden Kommentar genau_40 Jahre späterhin der betreffenden Wochenzeitung wieder abgedmckt (vgl. M. Gräfin Dönhoff, 23.9.1988, S. 48). '
"Die Botschaft ist klar: Die Israeli tun den Palästinensern das an, was die Nazi den Juden angetan haben... Die Israeli nehmen die Stelle der Nazi ein, die Palästinenser die Stell eder Juden... In welches Gewand sie auch schlüpfen, sie meinen immer dasselbe: daß es doch, bitte schön, endlich erlaubt sein soll, die Juden nicht zu mögen, nachdem es 40 Jahre lang nationale Pflicht war, sie zu lieben." (H.M.Broder 1986a; vgl. R. Wistrich 1987; U. Ulfkotte, 6.9.1988, S. 6; M. Gräfin Dönhoff, 23.9.1988, S. 48; D. Strothmann, 25. 11. 1988, S. 5; etc.)
Bezeichnend
erscheint ein Beitrag von Dietrich Strothmann mit dem Titel "Fem vom
Frieden im Jordanland" in der Wochenzeitung 'Die Zeit' vom 23.12.1988,
worin es unter anderem heißt: Der derzeitige Konflikt bedrohe "vor allem
Israels moralische Integrität, seinen eigenen inneren Frieden, seine
gesellschaftliche Zukunft und sein Ansehen in der Welt, auch seine
Wirtschaftskraft und seine Innovationsfähigkeit. - ... - Israel wäre - unter
bestimmten Bedingungen – auch jn seinen alten Grenzen überlebensghig und sicher.
Ein Groß-Israel mit einer Art
Soweto am
Jordan aber bliebe \veltweit auf sich allein gestellt." - Die
Palästinenser hätten inzwischen in der Welt Verständnis gefunden, sogar bei
ansehnlichen Teilen des amerikanischen Judentums, aber: "Wo es angeblich
um Israels Sein oder Nichtsein geht, wo sich sogar der Regierungschef in aller
Öffentlichkeit dazu versteigt, jedem die Hand abhacken' zu wollen, der sich an
'Jerusalems Einheit' vergehen sollte, beweist solche offenherzige und
ungeschminkte Selbstkritik den noch immer hohen Standard politischer,
militärischer und menschlicher Moral. In welchem arabischen Land kämen wohl
Soldaten vor den Kadi, weil sie im Übereifer einen rebellischen Juden
erschossen oder erschlagen hätten? Wo sonst äußerten hohe Offiziere ihre
ernsten Bedeaken gegen die pqlitische Führung, diskutierte ein Präsident
stundenlang mit betroffenen Reservisten, gingen Zeitungen so entschieden mit
den eigenen Militärpraktiken ins Gericht? Darin unterscheidet sich Israel eben
noch immer deutlich von seinen Nachbarn. Da leuchtet das 'Licht' noch, das die
Juden nach Ansicht mancher ihrer bedeutenden Wortführer in alle Welt bringen
sollten. Aber sein Schein wird sghwächer...
-... - Muß Israel etwa vor sich selbst in Schutz genommen, vor sich selber gerettet werden? ... Was aber haben die Israelis - von verwegenen biblischen Ansprüchen abgesehen - in Westjordanien und im Gaza-Streifen heute noch verloren? - ... - Es brechen schwierige Zeiten für den Judenstaat an." - Aber: "1989 kann vielleicht doch ein Jahr werden, wo der Friede anfängt am Jordan." (D. Strothmann, 23.12.1988, S. 3). - Schwierige Zeiten für den "Judenstaat".
Tatsächlich, so könnte man argumentieren, tritt schon im Begriff des 'Anti-Israelismus^ der Kern der AntiJudaismus-Konvention mit besonderer Deutlichkeit zutage: Denn 'Israel' ist ja nicht nur der Name des heurigen jüdischen Staates^vielmehr war 'Israel' zuerst der Ehrentitel Jaakovs, des 'Fechters Gottes', der um sein Dasein nicht weniger kämpfte als der heutige Staat Israel, wobei die Frage der Unterschiedlichkeit der Gegner hier einmal außer Betracht bleiben muß (vgl. 1 Mose 32, 25-32). Im Antiisraelismus jedenfalls ist der ursprüngliche Antijudaismus bis heute zu seiner größten Kenntlichkeit gelangt, könnte man argumentieren, insofern in ihm die Existenz Israels', des Stammvaters Jaakovs samt seiner Nachkommenschaft gemeint ist und damit zugleich die Existenz des Gottes Abrahams, Isaaks und Jaakovs, - vom religiösen Standpunkt betrachtet selbstverständlich ein absurdes und ansonsten selbstmörderisches^Jntemehmen, wenn man den Namen dieses Gottes bedenkt, wie er sich für sein Volk im Dombusch dem Mose offenbarte: "Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Jitzhaks, der Gott Jaakovs...- Wohl, ich werde dasein bei dir... - Ich werde dasein, als der ich dasein werde... - Das ist mein Name in Weltzeit..." (2 Mose 3,1-17; vgl. S. Marcus in E.R. Wiehn 1988b).
Von dieser delikaten theologischen Tiefen-Dimension oder -Interpretation einmal abgesehen, zeigen_sich also beim Antiisraehsmus jedenfalls die altbekannten Merkmale der Judenfeindschaft unverwechselbar aufs neue, nämlich nach Schalom Ben-Chorin: "Der Haß gegen die als fremd empfundenen Eindringlinge in das eigene Land, der Haß gegen die Ungläubigen, der Haß gegen eine zivilisatorisch überlegene Gmppe und schließlich der Haß gegen die in anderen Ländern Verfemten." Denn "Die Fremdheit zwischen Juden und Arabem wurde nicht genügend abgebaut, so daß die alte Kettenreaktion einsetzte: Fremdheit erzeugt Mißtrauen, Mißtrauen erzeugt Haß, Haß erzeugt Gewalttat", - woraus sich "das tragische Bild einer Transformation der Judenfrage" ergibt (S. Ben-Chorin 1988, S. 101 u. 104). - Warum?» [E.R.W. S. 58-62; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
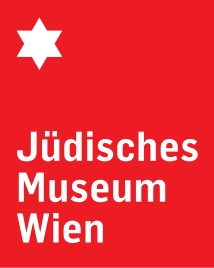 'Philosemitusmus'
(zum, auch der Wikipedia bekannten,
Begriff vgl. Hans Joachim Schoeps,
Philosemitismus im Barock. Religions- und geistesgeschichtliche Untersuchungen,
Tübingen 1952) als Formepalette jener wohlmeinden und/oder
immerhin so erscheinen wollenden Persdonen, die Juden so
gerne haben (oder zu lieben, bis sogar lieben zu
müssen, vermeinen/überzeugt sind), dass sie diese – zumal von und vor deren Judensein / Judenbleiben –
schützen / bewahren und retten s/wollen, respektive müssen. - Tendenzen die sich ebenfalls
bis mindestens in die Apostolischen Schriften des sogenanten 'Neuen Testaments' zurück belege, bis damit begründen,
aber gerade auch daselbst (namentlich ausgerechnet von
und mit Paulus, der Herkunft und Zugehörigkeit Jesu/Jeschuas der Jünder und der
zeitgenössischen Bevölkerung ihrer Sprech- und Denkweisen etc. pp.)
widerlegen, lassen. - Womit 'Philosemitismus' also nicht allein jene Vareianten
der Judenfeinschaft bezeichent, die aus Gründen säkularer und/oder religiöser
Oportunität/Nützlichkeit respektive tabulastiger Fermd- oder suggestiver
Selbsttäuschung 'judenfreundlich' wirken sollen, bis müssten, ohne dies zu
sein. Auch – und gerade besonders aufrichtiges,
bis engagiertes – Bedaueren - zumal von
Greuletaten, gleich gar kaum vorstellbaren. unfallsichen - bleibt eine
durchaus ambivalente – und Ungeheierlichkeiten kaum verhindernde(vermindernde -
Angelegenheit. - Frank Stern beginnt seinen wichtogen Beitrag: „Der geschönte
Judenfleck: Antisemitismus als Philosemitismus“ insbesondere zu dessen
'weltlichen' Varianten nach und seit 1945 damit, dass nach der unmenschlichsten
Form der Judenfeindschaft, ihrer staatlisch autoirisierten und
undustrialisierten physischen Verscichtung, und als „nach der Befreiung der Konzentrationslager
'Philosemitusmus'
(zum, auch der Wikipedia bekannten,
Begriff vgl. Hans Joachim Schoeps,
Philosemitismus im Barock. Religions- und geistesgeschichtliche Untersuchungen,
Tübingen 1952) als Formepalette jener wohlmeinden und/oder
immerhin so erscheinen wollenden Persdonen, die Juden so
gerne haben (oder zu lieben, bis sogar lieben zu
müssen, vermeinen/überzeugt sind), dass sie diese – zumal von und vor deren Judensein / Judenbleiben –
schützen / bewahren und retten s/wollen, respektive müssen. - Tendenzen die sich ebenfalls
bis mindestens in die Apostolischen Schriften des sogenanten 'Neuen Testaments' zurück belege, bis damit begründen,
aber gerade auch daselbst (namentlich ausgerechnet von
und mit Paulus, der Herkunft und Zugehörigkeit Jesu/Jeschuas der Jünder und der
zeitgenössischen Bevölkerung ihrer Sprech- und Denkweisen etc. pp.)
widerlegen, lassen. - Womit 'Philosemitismus' also nicht allein jene Vareianten
der Judenfeinschaft bezeichent, die aus Gründen säkularer und/oder religiöser
Oportunität/Nützlichkeit respektive tabulastiger Fermd- oder suggestiver
Selbsttäuschung 'judenfreundlich' wirken sollen, bis müssten, ohne dies zu
sein. Auch – und gerade besonders aufrichtiges,
bis engagiertes – Bedaueren - zumal von
Greuletaten, gleich gar kaum vorstellbaren. unfallsichen - bleibt eine
durchaus ambivalente – und Ungeheierlichkeiten kaum verhindernde(vermindernde -
Angelegenheit. - Frank Stern beginnt seinen wichtogen Beitrag: „Der geschönte
Judenfleck: Antisemitismus als Philosemitismus“ insbesondere zu dessen
'weltlichen' Varianten nach und seit 1945 damit, dass nach der unmenschlichsten
Form der Judenfeindschaft, ihrer staatlisch autoirisierten und
undustrialisierten physischen Verscichtung, und als „nach der Befreiung der Konzentrationslager
die Greuel, Verbrechen und das Leiden in der Öffentlichkeit bekannt
wurden,“ sich durch „Bilder und Dokumentarfilme die Wahrheit nicht länger
verheimlichen ließen,“ viele Menschen
annahmen, gar überzeugt waren, dass „auch das Ende des Antisemitismus gekommen
wäre. Der tradidonelle Antisemitismus, so schien es, sei ein für allemal als
antihumanistische und in der Konsequenz verbrecherische Tradition aus dem Leben
der Völker zu bannen, in den politischen Kulturen zu_ächten und unter Strafe zu
stellen. In den meisten europäischen Staaten erfolgte in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Art Tabuisierung des
Andsemitismus.
Öffentlich
zumindest waren antisemitische Bekundungen nicht mehr so rechte konsensfähig,
zum Teil sogar unter Strafe gestellt. In den Besatzungszonen Österreichs und
Deutschlands, insbesondere in den amerikanischen
Zonen
entdeckten viele Bürger, die sich notgedrungen Entnazifizierungsprozessen
unterwerfen mußten oder sich
um offizielle Bescheinigungen bemühten, daß es - nach allem, was
geschehen war - nicht ungünstig war, sich auf ehemalige jüdische Nachbarn oder Freunde zu berufen, denen man in
»jenen Zeiten« geholfen hätte.
Das
schien mit dem Zeitgeist übereinzustimmen, demzufolge nach der bürokratisch
organisierten Vernichtungspolitik während der Zeit des Nationalsozialismus nun
nach 1945 über Juden kein Makel der Ausgrenzung, Verfolgung, des Negativen mehr
lag. Überdies waren die aus der Vergangenheit zitierten jüdischen Freunde und
Nachbarn aus bekannten Gründen in der Regel nicht anwesend, konnten also auch
nichts Gegenteiliges bekunden. [...] Sich beim Umgang mit den
Besatzungsbehörden auf ein persönliches positives Verhältnis zu Juden zu
beziehen, schien opportun und war auch schwer zu widerlegen. Ein derart
zweckgebundener Bezug auf Juden, der meist privater oder semi-offizieller Natur
war, verband sich mit neuen Nuancen in öffentlichen Reden und Stellungnahmen.
In nicht wenigen Sonntagsreden von Nachkriegspolitikern,
Kirchenvertretern,
in Äußerungen und Veröffendichungen von Schriftstellern und Akademikern wurden
- wenn
es vermeintlich erfordedich schien – die großen Verdienste von jüdischen Persönlichkeiten hervorgehoben. Bezüge auf Juden in solchen Äußerungen waren voll von Adjektiven, in denen alles Jüdische in den höchsten Tönen gelobt, sozusagen auf ein moralisch erhöhtes Podest gesetzt wurde. Jüdische Nobelpreisträger wurden genannt, Reminiszenzen an das verlorene jüdische Wien oder Berlin beschworen, die vergangenen Beiträge von Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern jüdischer Herkunft hoch gelobt.
Ein neuartiger Philo[semitiosmus ...] begann den tradierten
Antisemitismus abzulösen. Allerdings hatten alle diese so hervorgehobenen Juden
eins gemeinsam - sie waren entweder tot oder lebten in Übersee. Die Beobachter
der amerikanischen Besatzungsbehörden und kritische Intellektuelle kamen
bereits in den späten vierziger Jahren
zu der Auffassung, daß sich hier ein neues Phänomen, ein neuartiger
Philosemitismus entwickle.
Dieser trat vornehmlich in der Öffentlichkeit auf, in privaten und
halböffendichen Äußerungen hingegen hinderte nichts das Weiterwuchern
antisemitischer Kontinuitäten, die sich zwar vornehmlich gegen die jüdischen
displaced persons in Österreich und Deutschland richteten, vor aus dem Ausland
zurückkehrenden Juden aber auch nicht haltmachten. Zunächst scheute man dies allerdings in der Öffendichkeit, verstummte
eher in bezug auf alles, was eine jüdische Bedeutung hatte, ja vermied
möglichst das Wort »Jude« oder »jüdisch«. Es war eine Art kollektive Amnesie
eine antisemitische Stille entstanden aus Unsicherheit, umhüllt mit
sozialpsychologischen Versatzstücken wie »unbegreifbare Katastrophe«, »am Rand
des Abgrunds«, »Stehen vor dem Nichts«, »Schicksalsschlag«. Nichts wurde
hiermit erklärt, aber alles schien erklärbar.
Die Kehrseite jener einvernehmlichen Nachkriegsstereotype waren Anekdoten, aus denen der einzelne »anständig« hervorging und die sich auf den schlichten Satz reduzieren ließen: »Vater war im Krieg« oder in das achselzuckende Bekenntnis mündeten: »Wir konnten ja nichts tun.« Derartige Reaktionsweisen wurden in_Deutschland noch dadurch erleichtert, daß mit den Nürnberger Prozessen scheinbar die Hauptyerantwortlichen der Vernichtungspolitik verurteilt worden waryn und in Österreich mit dem hilfreichen und alles umhüllenden Gründungsmythos der Zweiten Republik - der These von Österreich als erstem Opfer Hitlers - eine Hintertür in die ehrbare Nachkriegsgesellschaft gefunden worden war. Bei .so viel Opfern konnte man sich auf eine Stufe mit den Juden stellen und sich mit dem Märtyrerschein gemeinsamen Leidens versehen. Es ist daher nicht erstaunlich, daß der Philosemitismus der unmittelbaren Nachkriegszeit vornehmlich in Deutschland grassierte.
In
offiziellen philosemitischen Normsetzungen drückt sich der ambivalente
Charakter
philosemitischer
Einstellungen aus. Diese sind nach wie vor zwischen nichtantisemitischen
und demokratischen
Finstellungen auf der einen Seite und latenten und manifesten antisemitischen
Elinstellungen auf der anderen Seite anzusiedeln. Womit wir bei diesem Phänomen
konfrontiert werden, ist folglich eine außerordentlich ambivalente Metamorphose
der Einstellungen und Haltungen zu Juden und jüdischen Themen zwischen
Antisemitismus,
Philosemitismus und eindeutig demokratischen und nicht-antisemitischen Positionen. Es wäre daher verfehlt, seit 1945 entweder nur antisemitische Kontinuitäten im Sinne traditioneller anü-jüdischer Vorurteile und hartnäckiger Stereotype oder allein philosemitische Neuerungen zu sehen. Beide Tendenzen sind nur Schichten in einer gesellschafdichen Wirklichkeit, in der jedes jüdische Thema von Anfang an eine sozialpsychologische, po!itische und sogar internationale Qualität besitzt [...]
Wie
bereits erwähnt, nahm seit dem Frühjahr 1945 in der Bevölkerung - insbesondere
in der amerikanischen Besatzungszone - die Auffassung zu, daß die Einstellung
zu Juden in der öffendichen Sphäre eine wesentliche Rolle spiele, wenn es um
die eigene und vielleicht auch um die Zukunft Deutschlands gehe. Viele suchten
nach einem adäquaten Ausdruck und entsprechenden Assoziationen bei Kontakten
mit der neuen Obrigkeit, die eine öffentliche Identifizierung mit der
offiziellen politischen Ablehnung des Antisemitismus ermöglichen
sollten.
Die Unsicherheiten und Unwägbarkeiten jedoch, was überhaupt in bezug auf Juden
gesagt werden konnte, führten zu einer Reihe von Übertreibungen – wenn es nicht
überhaupt angebracht schien, dieses Thema zu_yermeiden. Darüber hinaus begann
ein seltsamer Widerspruch im Nachkriegsalltag in Erscheinung zu treten.
Die
eindeutige und offensichtliche Diskreditierung des Antisemitismus in den für
die Öffentlichkeit bestimmten Verlautbarungen und Aktivitäten implizierte
keinesfalls mit Notwendigkeit individuelle oder Gruppenaktivitäten gegen den
Antisemitismus. Es gab schlicht eine andere Möglichkeit: Eine positive
pro-jüdische Bekundung konnte an die Stelle einer offenen und entschiedenen
Zurückweisung oder einer prinzipiellen Abrechnung mit denen treten, die
antijüdische Auffassungen vertraten oder sogar weiterverbreiteten. Solch ein
philosemitisches
Bekenntnis wurde im scheinbar engen Rahmen akzeptabler politischer
Optionen
anerkannt und als analog zu formalen demokratischen Bekenntnissen betrachtet.
Die sozialen Kosten eines derartigen Bekenntnisses waren gering, und die
moralische Bekundung war außerdem abstrakter Natur, nicht weiter bindend.
Bereits der Symbolcharakter des Bekenntnisses implizierte eine gewisse
Distanz,die noch dadurch vergrößert wurde, daß das Objekt der Bekundung in der
Regel nicht gegenwärtig, sondern ermordet oder vertrieben war. Der abstrakte
Philosemitismus bedurfte nicht des konkreten Juden, was die kleine Zahl
überlebender Juden jedoch nicht vor der Jagd nach »Persilscheinen«
· Bescheinigungen, wonach der Betreffende kein Nazi gewesen sei – schützte.
Philosemitische
Bekundungen betrafen vor allem die österreichischen und deutschen
Juden -
gegenüber der Masse, der jüdischen displaced persons aus Osteuropa, die
vorübergehend
in und außerhalb von besonderen Sammellagern lebten, wurde im
wesentlichen
der alte Antisemitismus tradiert. Insbesondere ökonomische, soziale und
kulturelle Stereotype, die den herkömmlichen antisemitischen Bildern von Juden
entsprachen, hatten eine ahre Konjiinktur in Wien, Linz, Salzburg, in und um
München. Frankfurt und Berlin, um nur einige Orte zu nennen, in denen
vorübergehend jüdische displaced persons lebten. Latente antisemitische Einstellungen
konnten hier angesichts überlebender Juden
erneut in
offene Judenfeindschaft umschlagen.
Philosemitische
Haltungen zeichnen sich hingegen vor allem dadurch aus, daß sie des konkreten
Juden nicht bedürfen_abstrakte und abstruse Vorstell ungen dessen, was jüdisch
sei, reichen hier völlig aus. Philosemitische Meinungen, Einstellungen,
Haltungen und Äußerungen entsprechen überhaupt in vielem den antisemitischen
Stereotypen, indem sie diese schlicht ins überhöhend Positive umkippen. Da war
[bis ist; O.G.J.] von der besonderen »wirtschaftlichen Veranlagung« die Rede,
und es wurde bald gemeint, der Weg zu besseren
Wirtschaftsbeziehungcn
mit den USA füh£e ülier Jerusalem. Juden wurde ein politischer
und
gesellschaftlicher Einfluß unterstellt, der doch so hilfreich für die
Entwicklung der Nachkriegsgesellschaft sein könnte. Die politische Einstellung
zu Juden schwankte, soweit nicht Antisemitismen geäußert wurden, zwischen
Bekenntnissen zur Demokratie und einem Denken in Kategorien unmittelbarer oder
langfristiger Nützlichkeit. Was dem einzelnen eine neue antinazistische
Identität gegenüber den Besatzungsorganen verschaffen sollte, wurde in den
folgenden Jahren aber auch von der gesellschaftlich-staatlichen in die
staatlich-außenpolitische Ebene gehoben. .Gegenüber einer skeptischen Welt
konnte so der demokratische Charaktgr des Staates auf dem Weg zur Souveränität
bekundet
werden.
Die Neuordnung des Verhältnisses zu den Juden erschien Politikern der ersten Stunde
oftmals als conditio sine qua non einer Neuordnung in Bündnis-, Militär- und
Wirtschaftsfragen. Die Westintegration und Erlangung der Souveränität der
Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel waren von den sogenannten
Wiedergutmachungsverhandlungen
zwischen
Westdeutschland und den Vertretern jüdischer Organisationen und des Staates
Israel nicht zu trennen. Und das deutet [...] auf eine starke
Funktionalisierung der
Haltung zu Juden hin, auf eine ideologische und polidsche Dimension, die über das anti- oder projüdische Vorurteil bei der unmittelbaren Bewältigung der Alltagsnöte hinausging. Von derartigen Erwägungen hielt sich die Zweite Republik [Osterreich] schlicht fern, philosemitische Bekundungen im Bereich der Politik tauchen eher seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auf und sind meist mit Gedenktagen verbunden.
Allerdings
würde man es sich zu leicht machen, die Haltung zu Juden und deren
Metamorphosen nur unter funktionalem Aspekt zu betrachten und auf eine schlicht
opportunistische Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist zu reduzieren. Die
Haltung zu Juden wurde“ in der Nachkriegszeit „zu_einem gesellschaftlich
akzeptierten und einsetzbaren
moralischen
Faktor, der das öffentliche Spannungsverhältnis zwischen der sich polidsch und
ökonomisch formierenden neuen Gesellschaft und,ihrer Vergangenheit in allen
Schichten des geistigen Lebens und der politischen Kultur charakterisierte.
Dies
erklärt auch die Fortexistenz des philosemidschen Syndroms über die zwei ersten
Nachkriegs
Jahrzehnte hinaus. Eine entscheidende Bedeutung bei der Betrachtung des
Philosemitismus kam und kommt dem kulturellen Stereotyp zu. Der jüdische
Beitrag in Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft wurde zum zentralen Gegenstand
öffentlicher überhöhender Darstellung des Bildes vom Juden, zur Gestalt des
Juden schlechthin. Die Art und Weise, wie »große« Juden in allen Darstellungen
sinnbildlich auf einen Sockel und damit
unter
Denkmalschutz gestellt wurden, trug nicht nur zu deren Stilisierung, sondern
auch zn deren Neutralisierung bei. Hinzu kam, daß diese Überhöhung der Juden
als Kulturträger sehr bald in einer Atmosphäre des allgemeinen
Antiintellektualismus stattfand. Abgesehen davon erfolgte eine selektive
Idealisierung. Zwar wurde von Walther Rathenau gesprochen, nicht aber von Rosa
Luxemburg. Vom jüdischen Beitrag zu Revolutionen war - bis auf einige
Reden
sozialdemokratischer oder sozialistischer Politiker - genausowenig die Rede wie
von der Rolle jüdischer Arbeiter, Handwerker oder Gewerbetreibender. Aber auch
jüdische Rechtsanwälte, Bankiers oder Großunternehmer tauchen in diesen
philojüdischen Lobeshymnen selten oder gar nicht auf. Die Inhalte des
Philosemidsmus waren durch und durch respektabel, die jüdischen
Nobelpreisträger eben jeder Diskussion entzogen. Vom jüdischen Professor wurde
viel gesprochen, vom jüdischen Schuhmacher überhaupt nicht. Es
wurden
und werden mit den“ warum auch immer gewählten/verwendeten [O.G.J.] „philosemitischen Sprachregelungen,
wie der Soziologe Alphons Silbermann betont, unweigerlich Gewinn- und Verlustrechnungen
impliziert,
und vom Reden über den Beitrag der Juden zum Kulturleben ist
es nach
wie vor nicht weit zum Wort vom »Juden als Fremden«, einem Fremdling,
der -
ohne dazuzugehören - dem deutschen Kultnrkreis nur etwas hinzugefügt
hat. [...]
Ähnlich verhielt es sich mit der Entwicklung religiös eingebetteter
philosemidscher Argumentationsweisen. Hier erfolgte eine Idealisierung der
Juden als Leidende und Opfer, die aus chrisdicher Überzeugung und Verpflichtung
geliebt werden mußten. Der abstrakte Jude, fast eine metaphysische Idee, wurde
einerseits zum religiösen Gegenstand, zum Objekt christlicher Nächstenliebe,
andererseits wurde die Vernichtungspolitik bis 1945 [wenn auch nicht allein
religiöserseits; O.G.J.] zu einer Art Opfergang des jüdischen Volkes stilisiert
und mit einem höheren heilsgeschichdichen Sinn_versehen. Es erfolgte sozusagen
eine religiöse Idealisierung der Juden als leidendes »auserwähltes Volk«. Im
christlichen Philosemitismus kann man dies bis heute beobachten. Gleichzeitig finden
sich im chrisdichen Philosemitismus seit 1945 aber auch Elemente einer
christlichen Besinnung auf die alttestamentarischen[sic!] Wurzeln des Christentums und das Bemühen um
einen chrisdich-jüdischen Dialog, der
jedoch trotz aller Versuche über erste Schritte nicht hinausgekommen ist. Diese Tendenzen gehen nicht nur in die Zeit vor dem Dritten Reich zurück, sondern knüpfen zum Teil an den bei Pietisten und anderen evangelischen Richtungen in vergangenen Jahrhunderten verbreiteten Philosemitismus an.
Eine
philosemitische oder projüdische Äußerung konnte, und kann, kurz gesagt in
Negation eines antisemitischen Arguments erfolgen, sie kann aber auch
bedingt-antisemidsche Meinungen mitschwingen lassen oder auf betonte Weise
einer nicht-antisemidschen Haltung Ausdruck verleihen. Philosemitische
Bekenntnisse, Bekundungen und Symbolhandlungen überdecken nach dem
Nationalsozialismus die [sic!] wirklichen Probleme im Verhältnis zu Juden, in
der öffentlichen Darstellung jüdischer Themen und vor allem in der
Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung. Die philosemitische Ambivalenz
ersetzt die wirkliche[sic!] gesellschafthche Konfrontation mit jüdischer
Vergangenheit und zeitgeschichtlicher Erfahrung. Die Juden erhielten [sic!] im
Philosemitismus wieder [sic!] einen Platz in der kulturellen Vorstellungswelt,
aber so,_daß sie - ob sie wollten oder nicht – zur Exkulpation, zur Flucht vor
der geschichtlichen Verantwortung beitragen mußten.
Im
Philosemitismus werden die Juden nicht »verdrängt«, sondern romantisiert,
monummentalisiert, respekzabel neutralisiert und damit kulturell erneut
stigmatisiert und ausgegrenzt. Auch die vermeintlich positive Umkehrung des
Antisemiüsmus mach die Juden zu Fremden; nur daß der Gelbe Fleck jetzt geschönt
ist, freundlich glänzt. Daß sich dies in nicht wenigen Repräsentadonen des
Bildes von Juden niederschlägt, läßt sich - bis auf wenige Ausnahmen - durch
einen Gang durch jene Museen und Galerien illustrieren, die jüdische Geschichte
einzig als Geschichte der jüdischen Religion oder des jüdischen Beitrages zur
Kultur darstellen und den Philosemitismus
damit bildhaft bleibend als Ruhekissen des schlechten Gewissens inszenieren.“ (Frank Stern in Jüdisches Museum der Stadt Wien (Hg.),Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen. Wien 1995, S. 398-404; Quellenangaben daselbst, verlinkende Herborhebungen O.G.J.) - Warum?
«Die Wohlmeinenden» so fasste etwa Ignaz bibis s.A. seine Diskriminierungserfahrungen, auch als langjähriger vVorsotzender des Zentrarates der Juden in Deutschland, zusammen: «sind am schlimmsten.»
"Nicht, daß die Juden nichts zu leiden gehabt hätten, solange es noch kein Christentum gab", argumentiert der Verfasser: "Doch litten sie, weil sie ihre Feinde unterschätzt, die falsche Bündnispolitik betrieben hatten oder irgendwelchen Großmächten im Wege waren - aber nicht, weil sie Juden waren." Hingegen stecke in der Behauptung, daß ein gewisser Jesus von Nazareth der Christus sei, von vornherein ein antijüdischer Impuls, und in dem Maße, wie diese Behauptung zur Weltgeltung aufgestiegen sei, habe sich auch nämlicher Impuls zu einer prinzipiellen Haltung verfestigt: "Die Juden? Das waren doch die, die ihren eigenen Messias verkannt, verhöhnt und zum Tode verurteilt hatten, obwohl nur ihnen die Voraussetzung dafür gegeben war, ihn zu erkennen: die heiligen Schriften, die ihn geistig vorbereiteten. Der Unglaube der Juden war nicht jener unwissende der Heiden, die keine Ahnung davon hatten, was ein Christus sei, bis christliche Missionare kamen und es ihnen auf ihre Weise erklärten. Es war vielmehr Unglaube wider besseres Wissen: Verhärtung, Verstocktheit. Sie waren dagegen, weil sie Juden waren – Antichristen aus Prinzip. Und dieses Prinzip, ein hochmütiges, unbelehrbares Nichterkermenwollen, Nichtglaubenwollen - war das nicht das Böse schlechthin?" - Das Christentum sei die Wendung des Judentums gegen sich selbst, - der antijüdische Impuls im Christentum sei nie zur Ruhe gekommen.
"Ist ein Messias, der die Wiederkunft nötig hat, um sich aller Welt als Messias zu offenbaren, nicht so gut wie einer, dessen Ankunft noch gar nicht stattgefunden hat? Solche Fragen nagten auch, wo sie gar nicht ausdrücklich gestellt wurden. - ... da schaute die Christenheit in den Juden ihren leibhaftigen Selbstzweifel an, da wurde sie gewaltsamer gegen die Juden denn je, weil ihr eigenes jüdisches Gewissen betäubungsbedürftiger denn je war. - Wo die Juden als unbelehrbare, unheilbare Antichristen aus Prinzip gelten und dafür büßen müssen, traut der christliche Glaube seiner eigenen geistigen Heilkraft nicht mehr über den Weg und läßt an ihnen die Wut über seine eigene Unglaubwürdigkeit aus. In solchen Exzessen ist er selbst schon Übergang zu modernem Antisemitismus, den es ohne Christentum nicht gegeben hätte und der doch kein eigentlich christlicher mehr ist: vielmehr ein zum antijüdischen Ressentiment entleertes, erstarrtes Christentum, desinteressiert an den christlichen Glaubensinhalten und daher skmpellos genug, die jüdischen zu ignorieren. Den jüdischen Geist reduziert es auf die Natur der jüdischen Rasse, den theologischen Einspmch gegen das Christentum auf angeborene Widergesetzlichkeit und Zersetzungsmanie, die gewaltsame weltweite Zerstreuung der Juden verdreht es zur jüdischen Weltverschwömng." - Der antijüdische Impuls im Urchristentum sei eben nicht ohne Ambivalenz immer auch schlechtes Gewissen gegen die Juden, daher auch Skmpel, nicht nur Haß, auch Sympathie, nicht nur Überheblichkeit... Solche Ambivalenz stecke selbst noch in den Geburtsgeschichten Jesu: Sie erschlichen seine Messianität, aber zeigten sich gerade dabei dem messianischen Gedanken verpflichtet und erfüllten ihn mit neuer Bedeutung. Sie veranstalteten einen Übergriff auf jüdische Tradition - und stünden gerade dabei zu ihrer Herkunft aus ihr... Diese Geschichte sei nicht zuletzt deshalb so heillos verwickelt, weil der messianische Gedanke sich von keiner der beiden Konfessionen glatt vereinnahmen lasse: "Er ist selbst so etwas wie ein ewiger Jude, der unerlöst durch die Welt geistert und sich nur durch deren vemünftige Einrichtung - die sie dem messianischen Stand so weit, wie es menschenmöghch ist, annähert – annähernd befriedigen ließe." (Ch. Türcke, 23.12.1988, S. 40) - Der "messianische Gedanke" als eine Art "ewiger Jude"?
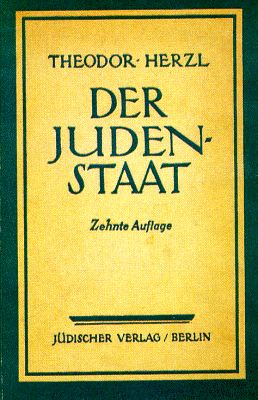 "Aber
ich will in dieser Schrift keine Verteidigung der Juden vornehmen",
schrieb Theodor Herzl 1896 in der Einleitung zu seinem 'Judenstaat': "Sie
wäre nutzlos. Alles Vernünftige und sogar alles Sentimentale ist über diesen
Gegenstand schon gesagt worden." Doch "Die Judenfrage besteht. Es
wäre töricht, sie zu leugnen. Sie ist ein verschlepptes Stück
Mittelalter..." Die Judenfrage bestehe überall, wo Juden in merklicher
Anzahl lebten; wo sie nicht sei, da werde sie durch hinwandemde Juden
eingeschleppt: "Wir ziehen natürlich dahin, wo man uns nicht verfolgt;
durch unser Erscheinen entsteht dann die Verfolgung." - Theodor Herzl
glaubte, den Antisemitismus als eine vielfach komplizierte Bewegung zu
verstehen: "Ich glaube zu erkennen, was im Antisemitismus
roher Scherz, gemeiner Brotneid, angeerbtes Vorurteil, religiöse Unduldsamkeit
– aber auch, was darin vermeintliche Notwehr ist." Wer der
Fremde sei, das könne die Mehrheit entscheiden; es sei eine Machtfrage, wie
alles im Völkerverkehre: "Im jetzigen Zustande der Welt und wohl noch in
absehbarer Zeit geht Macht vor Recht. Wir sind also vergebens überall brave
Patrioten, wie es die Hugenotten waren, die man zu wandern zwang. Wenn man uns
in Ruhe ließe... - Aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen."
(Th. Herzl 1978; vgl. C. Lomborosso 1894) Darin sollte sich Theodor Herzl nicht
geirrt haben, wohingegen jedoch inzwischen vielleicht bezweifelt werden darf,
ob seine Einschätzung richtig war, wenn er vor rund 90 Jahren meinte: "Ich
halte die Judenfrage weder für eine soziale, noch für eine religiöse... Sie ist
eine nationale Frage, und um sie zu lösen,
müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen..." (Th.
Herzl 1978, S. 200ff.). - Dazu ist sie indessen tatsächlich längst geworden,
dieser Tage einmal mehr.
"Aber
ich will in dieser Schrift keine Verteidigung der Juden vornehmen",
schrieb Theodor Herzl 1896 in der Einleitung zu seinem 'Judenstaat': "Sie
wäre nutzlos. Alles Vernünftige und sogar alles Sentimentale ist über diesen
Gegenstand schon gesagt worden." Doch "Die Judenfrage besteht. Es
wäre töricht, sie zu leugnen. Sie ist ein verschlepptes Stück
Mittelalter..." Die Judenfrage bestehe überall, wo Juden in merklicher
Anzahl lebten; wo sie nicht sei, da werde sie durch hinwandemde Juden
eingeschleppt: "Wir ziehen natürlich dahin, wo man uns nicht verfolgt;
durch unser Erscheinen entsteht dann die Verfolgung." - Theodor Herzl
glaubte, den Antisemitismus als eine vielfach komplizierte Bewegung zu
verstehen: "Ich glaube zu erkennen, was im Antisemitismus
roher Scherz, gemeiner Brotneid, angeerbtes Vorurteil, religiöse Unduldsamkeit
– aber auch, was darin vermeintliche Notwehr ist." Wer der
Fremde sei, das könne die Mehrheit entscheiden; es sei eine Machtfrage, wie
alles im Völkerverkehre: "Im jetzigen Zustande der Welt und wohl noch in
absehbarer Zeit geht Macht vor Recht. Wir sind also vergebens überall brave
Patrioten, wie es die Hugenotten waren, die man zu wandern zwang. Wenn man uns
in Ruhe ließe... - Aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen."
(Th. Herzl 1978; vgl. C. Lomborosso 1894) Darin sollte sich Theodor Herzl nicht
geirrt haben, wohingegen jedoch inzwischen vielleicht bezweifelt werden darf,
ob seine Einschätzung richtig war, wenn er vor rund 90 Jahren meinte: "Ich
halte die Judenfrage weder für eine soziale, noch für eine religiöse... Sie ist
eine nationale Frage, und um sie zu lösen,
müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen..." (Th.
Herzl 1978, S. 200ff.). - Dazu ist sie indessen tatsächlich längst geworden,
dieser Tage einmal mehr.
Denn überblickt man die Situation mit Schalom Ben-Chorin, "so
ergibt sich das tragische Bild einer 'Transformation der Judenfrage'": Der
Zionismus habe die Schaffung eines Judenstaates und damit die Lösung der
Judenfrage angestrebt'"; die Schaffung des Judenstaates sei gelungen, aber
die Judenfrage sei dadurch nicht gelöst, sondern transformiert und
transportiert worden: "Die Transformation besteht darin, daß aus dem
Problem einer Minderheit in der Diaspora das Problem einer Mehrheit im eigenen
Staate wurde, aber das Problem hat dadurch nichts von seiner Schärfe verloren.
- Der Jude in der Diaspora war und blieb ein nicht integrierbarer Faktor, ein
religiös-nationaler Fremdkörper, der immer wieder Randspannungszonen
auslöste, in welchen es zu Zusammenstößen und blutigen Verfolgungen bis zur
physischen Vernichtung kam. Der Staat Israel ist heute ein Fremdkörper unter
allen Staaten geblieben, insbesondere in der ihn umgebenden Region der
arabischen Länder. - So wie der Jude als der Fremde in den Ländern der Diaspora
empfunden und verfemt wurde, so wird der Judenstaat inmitten der arabisch-moslemischen
Welt als Fremdkörper abgewiesen. Das ist die Transformation des Problems. - Die
Transportation des Problems besteht darin, daß ihr Herd sich von Europa nach
dem Mittleren Osten verlagerte." Der Judenhaß sei in allen bekannten Formen
auf den Judenstaat übertragen worden,
ohne freilich daß er in der Diaspora abgebaut würde: "Man sieht also, daß gewisse gängige Grundvorstellungen vom Juden die Wirklichkeit überschatten. Eine alte Erfahrung lehrt uns, daß der mythische Jude stärker ist als der empirische Jude." Und "Das auserwählte Volk war als jüdische Gemeinde unter den Völkern ein Skandalon (Ärgernis) und blieb es in der Form des Judenstaates Israel." (S. Ben-Chorin 1988, S. 104f., 108, 112, 118; vgl. B. Lewis 1987; W. Sulzbach 1959; I. Deutscher 1977) - Aber nicht nur in dieser Form und nicht nur im Heiligen Land.
"Die Gründe für diese gesellschaftliche Erscheinung sind oft
erforscht worden, aber eine endgültige Antwort gibt es wohl bis heute
nicht", sagte Heinz Galinski in seiner Eröffnungsrede vor dem
Antisemitismus-Kongreß der Grünen im Herbst 1988 in Frankfurt: "Fest
steht, daß der Antisemitismus in allen seinen
Erscheinungsformen
seit den ältesten Zeiten aus einer Mischung aus Mißtrauen, Unkenntnis,
Vorurteilen und der Unfähigkeit, das Anderssein des Gegenübers zu ertragen,
besteht." Genauso fest stehe, daß der Antisemitismus insbesondere in
neuerer
Zeit im politischen Leben vielfach als ein Mittel mißbraucht worden sei, um die
Massen demagogisch über die niedrigsten menschlichen Instinkte zu manipulieren,
sie über die tatsächlichen Realitäten des gesellschaftlichen Lebens zu täuschen
und sie dadurch als politisch handelnde Individuen praktisch zu entmündigen:
"Es ist kein Zufall, daß man in den verschiedenen Erscheinungsformen des
Antisemitismus innere Zusammenhänge erkennen kann, auch wenn sie
jahrzehntelang, ja manchmal jahrhundertelang voneinander entfernt liegen... Ein
besonderer Aspekt, eine besondere Erscheinungsform des heutigen Antisemitismus
ist die Art und Weise, wie in weiten Kreisen - ... - auf die Ereignisse
im Nahen Osten und auf die Politik der israelischen Regierung reagiert wird.
Wir lassen uns nicht durch die fadenscheinige Argumentation täuschen, daß die
heutigen verbalen und konkreten Angriffe auf
Israel 'nur antizionistisch' und nicht antisemitisch zu verstehen seien. - Die
konkreten Angreifer verfolgen unverhohlen das alte Ziel des Antisemitismus -
nämlich die Vernichtung der Juden - mit neuen Mitteln und im neuen Gewand... -
AntiJudaismus, Antisemitismus,
Antizionismus,
Judenhaß - das sind viele Namen für ein Übel, das in jahrhundertelanger
Laufzeit Millionen von Menschen unermeßliches Leid zugefügt hat, ein Übel mit
hartnäckigen und scheinbar unbesiegbaren Wurzeln." (H. Galinski,
1L11.1988, S. 1; vgl. z.B. A. Silbermann 1982) - Die ärgerliche Tatsache der
Judendiskriminierung - der Abneigung, der Feindschaft, des Hasses – besteht.
Denn "Der Antisemitismus will nur sich selber", hatte Hermann Bahr
zur Zeit Theodor Herzls vermutet: "Er ist nicht etwa ein Mittel zu einem
Zwecke. Der einzige Zweck des Antisemitismus ist der Antisemitismus. Man ist
Antisemit, um Antisemit zu sein. Man schwelgt in diesem Gefühle... Der
Antisemitismus ist der Morphinismus der kleinen Leute... Wer Antisemit ist, ist
es aus der Begierde nach dem Taumel und dem Rausche einer Leidenschaft. Er
nimmt die
Argumente,
die ihm gerade die nächsten sind. Wenn man sie ihm widerlegt, wird er sich
andere suchen, wenn er keine findet, wird es ihn auch nicht bekehren, er mag
den Rausch nicht entbehren... - Wenn es keine Juden gäbe, müßten die
Antisemiten sie erfinden, sie wären sonst um den Genuß einer kräftigen Erregung
gebracht...", - und in seinen 'Betrachtungen zur Judenfrage' fand
Jean-Paul Sartre rund 50 Jahre später: "Wenn es keinen Juden gäbe, der
Antisemit würde ihn erfinden"; auch er hielt den Antisemitismus vor allem
für eine "Leidenschaft" (vgl. H.M. Broder 1986, S. 23 u. 28ff; vgl.
H. Bahr 1979; W. Böhlich 1988). - Leidenschaft, Leiden, Krankheit? - In den
Veröffentlichungen über Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg ist
bemerkenswerterweise immer wieder 'pathologisierend' von der
"antisemitischen Krankheit" die Rede, von einer
"Vorurteilskrankheit", von einem "internationalen
Ausschlag", vom "kleinbürgerlichen Vorurteil", von einer
"Irrlehre". Die Juden werden dabei wiederholt als "Spiegel"
bezeichnet, worin sich die "Widersprüche" und die
"innere Zerrissenheit der Deutschen" widerspiegele, im Antisemitismus finde die Schlechtigkeit des Menschen ihren Ausdruck, "in uns allen" stecke ein wenig Antisemitismus, "Juden als Pfahl im Fleisch", und sogar der "abwesende Jude" wird gehaßt; denn "Jude bleibt Jude" ... - Feindschaft bleibt Feindschaft?
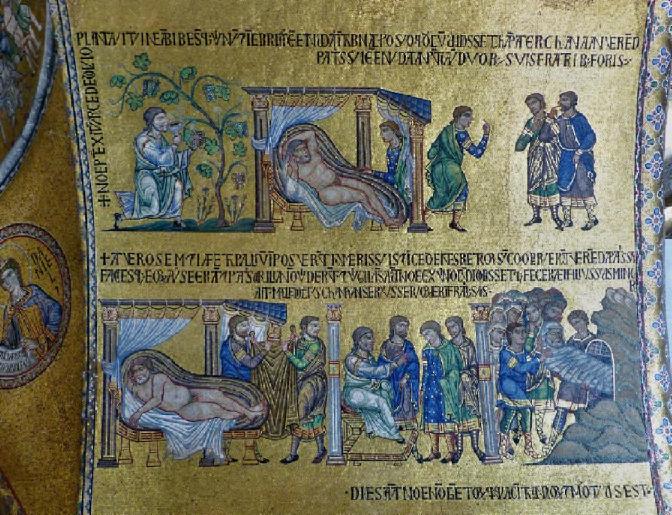 [Es existieren durchaus Semiten
im nicht-biologistischen Sinnen von
Nachkommenschaft / Hervorbringungen des ‚Noahsohnes‘ Sem, ohne deswegen/dazu Juden (oder etwa
Araberinnen) sein/werden zu müssen. – Deren, gleich gar
Buchstabenschriftgelehrtheit insbesondere deswegen viel zum Hass jntellektueller
Bildung beträgt, wo/wenn diese (solches Lernen) durch die Fähigkeit (gleich gar von/der Tochter/n) qualifiziert
wird: Die eigenen, bis vorgegebenen, Überzegtheiten in Beziehungsrelationen zu
sehen/setzen (zu relativieren), bis begründet ändern zu dürfen]
[Es existieren durchaus Semiten
im nicht-biologistischen Sinnen von
Nachkommenschaft / Hervorbringungen des ‚Noahsohnes‘ Sem, ohne deswegen/dazu Juden (oder etwa
Araberinnen) sein/werden zu müssen. – Deren, gleich gar
Buchstabenschriftgelehrtheit insbesondere deswegen viel zum Hass jntellektueller
Bildung beträgt, wo/wenn diese (solches Lernen) durch die Fähigkeit (gleich gar von/der Tochter/n) qualifiziert
wird: Die eigenen, bis vorgegebenen, Überzegtheiten in Beziehungsrelationen zu
sehen/setzen (zu relativieren), bis begründet ändern zu dürfen]
|
«Antisemitismus ist, wenn man die Juden noch weniger leiden kann, als es an sich natürlich ist.» (H. M. Broder 1986) |
lautet Henryk M. Broders inzwischen sattsam bekannte, von Amerika kolportierte Kalauer-Definition aus seinem an sich bedrückenden Buch 'Der ewige Antisemit - Über Sinn und Funktion eines beständigen Gefühls' aus dem Jahre 1986. - Der ganz normale Antisemitismus bestehe nicht darin, daß Juden gejagt, geprügelt und umgebracht würden, seine banale Alltagsversion zeichne sich vielmehr dadurch aus, daß Juden per se mehr zugemutet werde als anderen, und daß sie sich weniger herausnehmen dürften als andere: "Das heißt, sie müssen als Opfer geduldiger, wehrloser, leidensbereiter sein und werden, umgekehrt, als Täter einer viel strengeren Beurteilung unterzogen. Was Juden angetan wird, zählt nur halb, sie sind eja Opfer von Natur aus, was sie selber anderen antun, zählt doppelt..." - Henryk M. Broder hält den Antisemitismus nicht für abweichendes Verhalten, für "keine Ausnahme von der Regel, er ist der Normalfall des gesellschaftlichen Verhaltens Juden gegenüber - die Regel eben". Nicht derjenige, der die Juden nicht leiden könne, verhalte sich abweichend von der Norm, sondern derjenige, der nichts gegen die Juden habe: "So etwas gibt es auch, und das sind dann die Ausnahmen..." - Antisemitismus sei "ein emotionaler Selbstbedienungsladen", der tiefsitzende Bedürfnisse erfülle, habe also nichts mit dem Verhalten von Juden zu tun, weil jedes jüdische Verhalten jeweils andere Sorten von Antisemitismus aktiviere; Antisemitismus habe auch nur bedingt etwas mit leibhaftigen Juden zu tun und komme im Zweifelsfall auch ohne sie aus (H.M. Broder 1986, S. 148, 30f u. 35). - Was nun, was tun?
 Was
ist schließlich von all diesen Argumenten, Begründungen und Definitionen zu
halten?
Was
ist schließlich von all diesen Argumenten, Begründungen und Definitionen zu
halten?
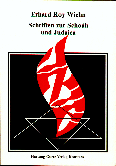 Sehr
einfach: Sie sind teils richtig, teils halbrichtig, teils falsch, teils
vielleicht sogar gefährlich, und sie lassen sich aus soziologischer Perspektive
etwa folgendermaßen beurteilen:
Sehr
einfach: Sie sind teils richtig, teils halbrichtig, teils falsch, teils
vielleicht sogar gefährlich, und sie lassen sich aus soziologischer Perspektive
etwa folgendermaßen beurteilen:
Die "Judenfrage" und der Antisemitismus sind nicht "ein verschlepptes Stück Mittelalter", und nicht nur dort zu finden, "wo Juden in merklicher Anzahl leben", es handelt sich in erster Linie nicht um eine "nationale Frage" (Th. Herzl). - "Der Antisemitismus will" nicht "nur sich selber"; "Der einzige Zweck des Antisemitismus ist" nicht "der Antisemitismus"; "Man ist" nicht nur "Antisemit, um Antisemit zu sein"; er ist nicht "der Morphinismus der kleinen Leute", nicht unbedingt "Begierde", "Taumel" oder "Rausch einer Leidenschaft" (H. Bahr u. J.-P. Sartre). - Der Antisemitismus ist keine "Krankheit" und kein "Ausschlag", ist nicht nur ein "kleinbürgerliches Vorurteil"; nicht "einfach eine Irrlehre", er steckt sicher nicht in allen, und die Juden sind auch kein "Spiegel" für die "Widersprüche" und "innere Zerrissenheit" anderer etc. etc. ... - Antisemitismus ist auch weder "natürlich" noch ein "beständiges Gefühl", es gibt keinen "ewigen Antisemiten" , er ist nicht "die_Regel", ist kein "emotionaler Selbstbedienungsladen, der tiefsitzende Bedürfimse erfüllt" etc. etc. (H.M. Broder). Und Antisemitismus ist auch als "ökonomisch-sozialpsychologisches Phänomen" nicht zu fassen. - Antisemitismus ist aber in der Tat eine Art "vielfach komplizierter Bewegung" und sicher auch eine Machtfrage (Th. Herzl), denn Juden scheint wirklich "mehr zugemutet" zu werden als anderen; und sie dürfen sich "weniger herausnehmen" als andere; als Täter wie als Opfer werden sie einer je besonderen Beurteihmg unterzogen; Antisemitismus hat_wahrlich "nichts mit dem Verhalten von Juden zu tun" , weil tatsächlich "jedes jüdische Verhalten jeweils andere Sorten von Antisemitismus aktivieren" und im Zweifelsfall durchaus ohne "leibhaftige Juden" und evtl. sopar "ohne Antisemiten" auskommen kann (H.M. Broder; vgl. dazu B. Tichatschek 1976; G. Zwerenz 1986, S. 7). - Soviel zur Publizistik; die Wissenschaft?
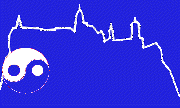 Von sozialwissenschaftlicher Seite wurde
Antisemitismus für eine "Gruppenfeindschaft"
Von sozialwissenschaftlicher Seite wurde
Antisemitismus für eine "Gruppenfeindschaft"
gehalten und seine Ursachen in "Fremdheit" (G.
Simmel) bzw. "Fremdärtigkeit" (Z. Rudy) gesehen, womit man dem
Problem wahrscheinlich am nächsten kam, wie bereits dargelegt
wurde. In soziologischen Lexika erscheint
Antisemitismus als "feindselige bis haßerfüllte, auf Isolierung,
Vertreibung oder gar Vernichtung hin orientierte Einstellung und Haltung
gegenüber Juden". die Basis dafür wird in "objektiven ges. u. pol.
Verhältnissen ebenso wie im Bewußtsein u. Unbewußten der breiten
Bevölkerungsmassen" erblickt, wenn auch seine Ursachen "im wesentl.
nicht bei den durch den A. Verfolgten, sondern eindeutig bei den Verfolgern"
liege, und zwar in "soz. Unsicherheits- u. Krisensituationen", wobei
insbesondere "die autoritäre Persönlichkeit für A. Anfällig" sei
(vgl. G. Hartfiel). - Femer ist Antisemitismus als "Bezeichnung.für das
stereotype Vorurteil gegenüber Juden" zu finden, "durch das diese_als
minderwertige und gefährliche Fremdgruppe" definiert werden, und zwar als
"Bestandteil der rechtsradikalen
und nationalistischen Ideologien" in den meisten von christlicher
Tradition geprägten Gesellschaften; der Ausdruck 'Antisemitismus' sei
allerdings "eine ungenaue Begriffsbildung insofern, als er
Vorurteilshaltungen gegenüber nichtiüdischen semitischen Gruppen (z.B. Arabern)
nichf' meine (vgl. W. Fuchs et al.). - Zuletzt werden
"Fetischtheorie", "Sündenbocktheorie", "Anthropologisierung",
"Entpolitisierung" und "Naturalisierung" abgelehnt, Antisemitismus "zureichend in seiner
Doppelfunktion als 'ökonomischsozialpsychologisches Phänomen" nur
"gesellschaftstheoretisch in einer 'materialistischen'
oder kritischen Gesellschaftstheorie" für bestimmbar.gehalten, kurz: als Problem der Psychoanalyse und der politischen Psychologie (vgl. W. Bergmann 1988' S. 217-234; vgI. D. Diner 1988)". - Und als "soziologisches Problem?
Das soziologische Problem besteht. Judenfeindschaft ist eine große wissenschaftliche Herausforderung. Vielleicht wird sie als solche neu oder überhaupt erst noch richtig erkannt. Hier war nicht mehr als ein begrenzter Klärungsversuch versprochen, und der muß mehr als begrenzt erscheinen, wenn man die sensibilisierenwollenden Überlegungen nun kurz zusammenzufassen sucht:
Judendiskriminierung in den Graden von Abneigung, Feindschaft oder Haß
sowie in allen ihren je zeitgenössischen, aufeinander folgenden oder
gleichzeitigen Formen und Transformationen vom Antijudaismus
über den Antisemitismus, Antimosaismus,
Antihebraismus, Antizionismus
bis zum Antiisraelismus – ist eine oder
vielleicht sogar die ärgerliche soziale^Tatsache schlechthin und als solche vor
allem auch ein soziologisches Problem, ein Kernproblem sozialer Ungleichheit,
ein Paradigma par excellence. - Im Sinne einer soziologischen Problematisierung
wurde Judendiskriminierung daher hier als ein variables Handlungs- bzw.
Verhaltensprogramm mit negativem Sanktionspotential definiert, und zwar bezogen
auf den potentiellen bzw. virtuellen Umgang mit Juden als
imaginären generalisierten Fremden, deren fallweise sogar dämonisiertes
Anderssein ("credo non quod, sed quia absurdum est" (Augustinus)) als
ebenso bedrohlich wie minderwertig und daher unerträglich empfunden wird,
insofern diesen verfremdeten Anderen für wesentlich gehaltene Merkmale des
jeweils eigenen, und deshalb einzig richtigen und wahren Menschenbildes zu
fehlen scheinen, da sie djese 'natürlich' nicht besitzen kötmen, eben weil sie
sie konventionellerweise gar nicht besitzen dürfen. - Judenfeindschaft als
soziologisches Problem soll also heißen, sie in allen bisher bekannten Graden
und Formen als tnehr oder weniger starke Handlungs- bzw. Verhaltens-Konvention
zu begreifen, die nahezu jederzeit multifunktional und ubiquitär aktivierbar
ist, Natur-Charakter annehmen kann, sich aufweinen 'ideal-typischen'
Rollen-Plural bzw. 'pluralen Singular' (A. Hitler!) bezieht, mit Abneigung
beginnt und sich über Feindschaft bis zum dämonisierenden Haß steigern kann,
der seinerseits stets zur virtuellen und dann realen Objektvemichtung
überzugehen neigt. Somit wird schließlich vorgeschlagen, Judendiskriminiemng
als eine Negativkonvention zu verstehen, historisch durch Macht- und
Herrschaftsinstanzen etabliert, durch diese immer wieder intensiviert und
insofern auch tief intemalisiert, die als soziale Konvention jedoch prinzipiell
veränderbar war und ist. - Im
Prinzup wenigstens aber? Ein soziales und soziologisches Problem, aber keinerlei Lösung in Sicht. Dennoch Prinzip Hoffnung oder hoffnungslose Aporie? (Vgl. D. Claussen 1987) - Vielleicht nicht vollenden, aber beginnen.
Das soziologische Probletn bleibt mindestens solange bestehen, solange die ärgerliche Tatsache der Judenfeindschaft besteht: "Nein, nein, wir sind also nirgends gern gesehen", so sagt eine Jüdin in diesen 80er Jahren mit den Erfahrungen eines über 80-jährigen Lebens in der Schweiz, "das ist (nun) mal so. Obwohl wir wirklich, ich muß schon sagen, nicht anders aussehen als normale Menschen. Wir wollen ja gar nicht mehr als anerkannt werden, als Menschen anerkannt werden, mit unseren guten und unseren schlechten Eigenschaften wie ... andere auch. Wir wollen ja gar nicht mehr! Ich meine, es gibt sicher Leute, die vielleicht unangenehm sind, aber die gibt's überall. Aber wenn's eben der Jud macht, dann ist es nicht der Jude, dann sind es die Juden! Das ist eben der Unterschied!" (E.R. Wiehn 1988a, S. 27) - Doch "'Das ist sehr merkwürdig, daß alle Feinde der Kinder Jsraels ein_so schlechtes Ende nehmen", fand Heinrich Heine (1797-1856) im Jahre 1840: "Wie es dem Nebukadnezar gegangen ist, wissen Sie, er ist in seinen alten Tagen ein Ochs geworden und hat Gras essen müssen. Sehen Sie den persischen Staatsminister Haman, ward er nicht am Ende gehenkt zu Susa, in der Hauptstadt? Und Antiochus, der König von Syrien, ist er nicht bei lebendigem Leibe verfault, durch die Läusesucht? Die späteren Bösewichter, die Judenfeinde, sollten sich in acht nehmen... Aber was hilft's, es schreckt sie nicht ab, das furchtbare Beispiel, und dieser Tage habe ich wieder eine Broschüre gegen die Juden gelesen, von einem Professor der Philosophie... Er wird einst Gras essen, ein Ochs ist er schon von Natur...'" (H. Heine 1964, S. 20f.). - Ja "Was für schreckliche Verrenkungen, was für akrobatische Gemütsübungen müssen vollbracht werden", meint Henryk M. Broder, "um einem Unbehagen Ausdruck zu verleihen, das der ehrliche Antisemit Wagner ganz ungeniert aussprach: 'Sieht man einen Juden, stellt sich einem sofort ein unmittelbares Gefühl der Abneigung ein.' - Es kann noch lange dauern, bis ein Jude einen Antisemiten treffen wird, dem er seine Koffer anvertrauen mag." (H.M. Broder 1986a) - Nebbich.» [E.R.W. S. 62-70; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.]
Es soll bereits eine
Christin einer Jüding (gar
einem ...) geglaubt haben, auch eine Jüdin
habe schon einer Christin vertraut – sogar davon, dass
Christen dieser/einer Jüdin ... (was auch immer
haben) ... gibt es Berichte.
|
Die bedingt jüngere Ekklesia äàøé-úéá könnte der durchaus älteren Synagoge úñðë-úéá (die ihr - kaum ernstlich bezweifelbar - dient) noch einiges schuldig sein. |
Soweit und da die erst seit/unter griechischem Einfluss als 'Synagoge' bezeichenten Einrichtungen mindestens bis auf das jüdische Exiel in Babylon zurück gehen, sind sie älter als christliche Gemeineorganisationsformen (und gleich gar Kirchen). Wärend sich die bis heute vorfindlichen Formen 'rabbinischen Judentums' so 'diasporadisch' erst wärend bis nach/durch Abgrenzungen zu/von und der Christentümmer belegen lassen. |
Auf, dass 'die Juden' dieser Jüdin, oder sogar 'die Christen' jeder Christin, glauben (können) – immerhin Christen Juden vertrauen, bis Juden Christen glauben, werden - nicht (länger höchstens) allein Juden jener Christin / einem Christen?
|
Lawrence Kushner's «Mittagessen mit Jesus [sic!] |
|||||||
|
Wie wenig ich [L.K.] von Jesus weiß, das hat mir [L.K.] Robert [Trache]
gezeigt. Er war es, der mir [L.K.] vor
über einem Vierteljahrhundert geholfen hat zu verstehen, wie Gott wirklich Mensch werden kann. Beide waren wir damals
junge Geistliche [sic! mit L.K.
(aner)kennt/verwendet allerdings gerade hebräisches Denken die 'griechischen'
Dichotomisierungen 'Geist
versus Matreiie' nicht; vgl. daselbst S. 7 f.], er war Priester
bei der Episkopalkirche und ich L.K.] war Rabbiner einer kleinen
Stadt in New England. Vorsichtig begannen wir, uns für den Glauben[svorstellungen
und Lebenswelten; O.G.J.] des anderen zu interessieren. Wir
besuchten uns gegenseitig, ich war in seiner Kirche und er in unserer
Synagoge; wir besucliten uns auch zu Hause. [...] |
|||||||
|
Von da an gingen wir einmal im Monat zusammen zum Mittagessen [sic!]. Wir beschlossen, jeden Monat für den anderen einen einseitigen Essay zum jeweils selben Thema zu schreiben. Auf diese persönliche Art wollten wir die andere Religion besser kennenlernen. Die Themen waren absehbar: Gott, die Bibel, Israel, Erlösung. Die einzige Bedingung, die wir uns auferlegten, war, vollkommen offen und ehrlich zu sein. Beim sechsten oder siebten Mal meinten wir, so weit zu sein, um über Jesus zu schreiben. Folgenden Text habe ich [L.K. ...] für Robert geschrieben: |
|||||||
|
|
Ich
empfinde Argwohn gegenüber Jesus. Nicht wegen irgendeiner seiner Lehren oder wegen
der Vorstellungen, die seine Jünger von ihm haben. (Obwohl einiges, was der
Verfasser des Johannesevangeliums über mich und mein Volk geschrieben hat,
für immer aus dem Kanon der Lektüre gestrichen werden sollte, wenn man die
Nächstenliebe für wichtig hält.) Ob sie geirrt haben oder nur voreilig waren
- die Vorstellung, dass Gott schließlich Menschengestalt angenommen hat, dass
die gegenseitige sehnende Teilhabe von Gott und Mensch sich in einer Person
fokussiert, das ist eine absolut verlockende Vision: Das Wort ist Fleisch
geworden. Seit Jahrhunderten bemühen wir Juden uns um die umgekehrte Richtung: von unten nach oben. Wir streben nach dem Ideal der Lehre der Tora. Das Judentum will die einfachen Menschen dazu bringen, das Heilige zu begreifen, das Fleisch ins Wort zu verwandeln. Dann kam das Christentum und lehrte, dass Jesus den Versuch darstellt, das Sehnen von der anderen Richtung aus zu verstehen. Um die Wahrheit zu sagen: Bis jetzt hat sich keine Tradition durchgesetzt. Ich
empfinde Argwohn gegenüber Jesus wegen der Geschichte und wegen dem, was
meinem Volk angetan wurde von so vielen, die an ihn zu glauben behauptet
haben. Das Christentum, so könnte man sagen, hat Jesus für mich verdorben. Über die Jahrhunderte haben sich auf irgendeine Weise das Leiden Jesu
und das Leiden des jüdischen Volkes, meines
Volkes, mit meinem Leiden vermischt. Das ist der Grund für meine Probleme mit
Jesus. Sein Tod wurde sogar ursächlich mit einer Weigerung von meiner Seite
in Verbindung gebracht. Und das wiederum wurde als Rechtfertigung für mein
Leiden missbraucht. So
gesehen, stellt Jesus für mich nicht denjenigen dar, der um der Sünden [sic!] der Welt willen gelitten hat, sondern
denjenigen, um dessentwillen ich leiden muss. (Will wirklich irgendjemand die
Zusammenhänge zwischen dem christlichen Europa und dem Holocaust leugnen?)
Das meiste meines früh erworbenen Wissens über Jesus habe ich von Juden
übernommen, die ihre Verletzungen nicht verbergen konnten und Jesus unbewusst
[sic!] als Feind gezeichnet haben. Nichtsdestotrotz glaube ich an das Kommen eines Gesalbten, eines Erlösers [sic!], der durch das Vorbild [sic!] seines Lebens die vollkommene Menschlichkeit bewirken und sogar die verbohrtesten Zyniker zu der Überzeugung bringen wird, dass hier ein Mensch ist, in dem die ewige Sehnsucht nach der bewussten Selbsterkenntnis zuletzt gesiegt [sic!] hat. Die große Lehre vom Sinai hat sich zuletzt erfüllt. |
|
|||||
|
Diesen
Text gab ich [L.K.] Robert, als wir uns
zum Essen setzten. Was
dann geschah, verstehe ich [L.K.] erst
im Rückblick. Er las die Seite zu Ende, ließ das Blatt sinken und sah mich
an. Sein Gesicht war aschfahl. Ich [L.K.] zuckte zusammen und
meinte, eine Grenze überschritten verletzt zu haben. Aber zu meiner
Überraschung flüsterte Robert nur: „Bitte vergib mir, vergib uns. Es kann
nicht Jesus gewesen sein, dem
diese Christen nachgefolgt sind.“ Seine Augen waren tränenfeucht; er konnte sein Mitleid nicht
verbergen, es schien direkt aus
seinem Glauben zu kommen. „Deine Religion“, fragte ich [L.K.], „will, dass du dich in einem solchen Maß um mich sorgst?“ „Ja“, versicherte er mir. „Siehst du nicht, dass ich ständig Gott in jedem Menschen finden muss? Jesus ist nur der Anfang. Bei dir, Lawrence, ist es einfach. Aber das Jetzte Ziel ist es, meinen Herrn in jedem zu finden, auch in Menschen, die ich viel weniger mag als dich, sogar in Menschen, die ich gar nicht mag oder sogar verachte.“ |
Und da dämmerte es mir [L.K.]: Das ist damit gemeint, dass Gott Menschengestalt annehmen kann. Jenes Ereignis in der Vergangenheit erlegte Robert eine Pflicht für die Zukunft auf. Und jede Begegnung von Menschen ist eine neue Möglichkeit auf dem Weg zu dem letzten Ziel. Genau hier, mir gegenüber am Tisch, saß ein wahrhaft heiliger Mann, in dem der Geist Fleisch geworden war! Und so segneten wir gemeinsam die Mahlzeit, die wir miteinander teilten. |
||||||
|
Die
folgenden Seiten Lawrence Kushner» [in ders., Jüdische Spiritualität, München 2001, S. 9-14; verlinkende Hervorhebungen; O.G.J.] |
|||||||
|
Bitte finden Sie eine/Ihre ... (gar mit uns)! |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
Gegenreaktionen sind unvermeidlich und solle sich - wofür eben nicht nur postulierte Zusagen einer Seite (welcher auch immer) sprechen, sondern auch der bisherige Verlauf solcher Auseinandersetzungen - die Allmacht (gar richtend) einmischen, sind sie noch prekärer. - Zwar mag sich mancher, leicht(fertig selbst) dazu berufbarer, 'Herrenmensch' dazu versteigen, zu beurteilen, wer oder was auszurotten sei, ob er dies aber auch vor ihm tatsächlich überlegenen Instanzen zu rechtfertigen vermag, kann sich erst heraustellen, wenn die Handlungskonsequenzen bereits irreversibel geworden sind. |
|
|||
|
|
|
Spätestens der (bereits psycho-logische) Imperativ, dass der/die/das Andere auch (wo nicht sogar gerade) 'in' mir/mich/uns selbst sein/werden kann (falls er/sie/es nicht sogar unvermeidlich mit uns vernunden ist) macht dies unausweichlich (respektive sich selbst-negierend, bis vernichtend). |
||||
|
|
|
Denkformen und Wert(e)strukturen, die .... alles nur auf die von mir/Ihnen erkannte Art und Weise zulassen wollen/können ... sind unzureichend – gar als soclhe bemerkbar. |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
hat weder dazu geführt, dass die Auseinandersetzung unterbleibt - vgl. etwa das (gar omnipräsente) Phänomen des 'Antisemitismus ohne Juden' und der ('sonstigen') Ketzerei ohne Heretiker. |
|
|||
|
|
|
noch ist es in einer (und sei es nur qua Informations- und/oder Bevölkerungswachstum - gleich gar bei andauernder Wanderung) kleiner (und enger) werdenden Welt durchhaltbar. |
|
|||
|
|
|
Notwendigerweise konfligiert es mit Imperativen der Modalitäten unserer Wirklichkeit(en), insbesondere der physikalischen wie der sozialen und ökonomischen. |
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
Das gar wechselseitge Erkennen, womöglich auch erst/noch Grüssens, ... |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
Erfahrungsgemäss beginnt es / beginnen diese mit (ökonomischem) Tausch |
|
|||
|
|
|
und geraten i.d.R. bald über den Handel hinaus zu zwischenmenschlichen mehr als bloßen Gruss-Verhältnissen. |
|
|||
|
|
|
Was, auch schon mal bis (häufiger) zur kulturübergreifenden Verehelichung der eigenen Kinder und/oder Enkel geraten kann. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
Weitere 'Inhalte' solcher/dieser (Denk-Richtungs-)Konflikte
finden sich auch auf unserer |
||||
|
«... worum es geht, nämlich Spuren zu sichern, zu sammeln und zu dokumentieren, alsdann so gut wie möglich zu beschreiben und zu erklären, um dadurch Erinnerungen wachzuhalten und aus den dunklen wie hellen deutsch-jüdischen Lebenswelten für Gegenwart und Zukunft lernbar zu machen, was vielleicht gelernt werden kann. Darüber hinaus muß immer wieder Flagge gezeigt und öffentlich Stellung genommen werden, nicht nur angesichts des neuen alten ordinären Antisemitismus, sondern auch hinsichtlich neuerlicher Relativierungs- und Verdrängungsversuche, ... Geschichte ist irreversibel, Vergangenheit vergeht nicht, die Zukunft hat immer schon begonnen. Die Schoáh bleibt ein präsenter Teil der deutschen und europäischen wie der Weltgeschichte überhaupt und somit auch die Frage, wie bis jetzt und insbesondere künftig im neuen Deutschland damit umgegangen wird. Genau darin besteht aller 'Entsorgungs'-Versuche der Vergangenheit zum Trotz, die verbleibende, die wirklithe 'deutsche Frage' als einzigartige Frage der Deutschen an sich selbst, die bis heute keineswegs endgültig beantwortet sein dürfte. Lernen aus Geschichte erscheint also in vieler Hinsicht fraglich und doch als notwendige Hoffnung. Denn es gibt nicht nur die Vergangenheit, sondern eben immer auch Zukunft, und es gibt jene unendlich kurze, aber entscheidende Brücke, die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet, nämlich den Augenblick der Gegenwart. Eingedenk alles Vergangenen die Augenblicke jeglicher Gegenwart als Möglichkeit des Anfangs [vgl. Imanuel Kant's Definition/Beschreibung qualifuzierter Freiheit, die genau darin besteht einen Anfang machen/setzenn zu können; O.G.J. Mit A.K.] einer besseren Zukunft zu nutzen, darin liegt die Chance einer konstruktiven, kreativen, produktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, des Lernenwollens und Lernenkönnens aus Geschichte, das stets mit vergegenwärtigender Erinnerung beginnt und mitnichten zu einem Holocaustkult führen muß. Dabei geht es nicht zuletzt auch um Verantworteng und persönliche Verantwortlichkeit heute, wo man ... in der Welt fassungslos mit ansehen muß, wie bei einer schrecklichen Barbarei wiederum fast tatenlos zugewartet wird. Um so mehr kann also die Lehre der Schoáh nur lauten: Erinnern und Gedenken, Lernen und Handeln, mit allen guten Kräften ein neues europäisches Haus und eine menschlichere _Welt auch unter Berücksichtigung jüdischer Ethik zu verwirklichen suchen, im kleinen wie im großen an einer gerechteren Lebensordnung mitwirken helfen, die kaum ein Begriff besser zu fassen vermag als 'Schalom'.» [E.R.W. S. 7 f.] |
||||
|
|
Kommentare und Anregungen sind willkommen: (unter webmaster@jahreiss-og.de) |
||
|
|
|
by |